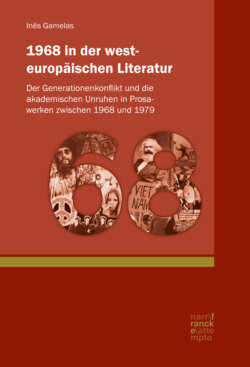Читать книгу 1968 in der westeuropäischen Literatur - Ines Gamelas - Страница 8
1.2 Die Bundesrepublik: die Herausbildung einer Alternativkultur
ОглавлениеAm Anfang der 1960er-Jahre war die Bundesrepublik eine junge Republik, die erst wenig älter als eine Dekade war. Sie erlebte eine Realität, die durch eine solide Regierung und durch eine ungehemmte Kraft der Industrie geregelt wurde, angetrieben vom Wirtschaftswunder der 1950er-Jahre. Dieses Phänomen großen wirtschaftlichen Wachstums, das in den Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft fundiert war (vgl. Ambrosius, 1989: 56f.), hatte direkte soziale Auswirkungen. Sie bestanden nicht nur in einem allgemeinen finanziellen Wohlstand, sondern auch im Wandel der Sitten und des Lebensstils vieler deutscher Familien, die die Gelegenheit hatten, die Annehmlichkeiten der Konsumgesellschaft zu erleben und die bürgerlichen Konzepte der »Kultur des Scheins« anzunehmen.1
Mitte der 1960er-Jahre begann jedoch der wirtschaftliche Optimismus erste Zeichen eines Abflauens zu zeigen. Die Prognosen eines Einbruchs des ökonomischen und finanziellen Booms – und dessen unheilvollen Konsequenzen im sozialen Bereich – führten zu einer Infragestellung sowohl der kapitalistischen Grundfesten der Überflussgesellschaft als auch der politischen Realität des Landes. Rolf Uesseler beschreibt diesen historischen Wendepunkt:
Die Bundesrepublik und die meisten westlichen Länder befanden sich Mitte der 60er Jahre in einer Situation, in der auf einmal – aus scheinbar unerfindlichen Gründen – all das nicht mehr funktionieren wollte, was bis dahin so reibungslos geklappt hatte: steigender Wohlstand, Vollbeschäftigung, Abwesenheit von Wirtschaftskrisen, allseits vorhandener moralischer Grundkonsens und somit allgemeine Zufriedenheit und ein verbindendes Wir-Gefühl. (Uesseler, 1998: 15)
Seit dem Anfang der Ära Adenauer im Jahre 1949 war die Christlich Demokratische Union (CDU) – entweder allein oder in Koalitionen – an der Macht und seitdem bestimmte sie die Politik der Bundesrepublik der 1950er- und 1960er-Jahre. Mit dem Verfall des wirtschaftlichen Aufschwungs und dem Beginn der »ersten wirklichen Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit« (Ambrosius, 1989: 63) im Jahre 1966 wurde diese Mitterechtspartei zur Zielscheibe der Kritik. Diese Kritik kam hauptsächlich von Studenten, die entschlossen waren, einen Protest, den Knut Hickethier als »Protest gegen den CDU-Staat« bezeichnete, in Angriff zu nehmen: »[ein Staat; IG], den man nicht nur als vermufft und angestaubt, sondern auch als zu wenig offen, zu wenig weltläufig und zu wenig modern fand« (Hickethier, 2003: 19). Die Proteststimmung wuchs Ende 1966 mit der Entstehung einer neuen Koalitionsregierung aus den beiden größten Parteien der Bundesrepublik: die Christlich Demokratische Union (CDU) und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). Diese »Große Koalition«, als die sie damals bekannt wurde, wurde zu einem Symbol der Verständigung zwischen zwei politischen Parteien, die ursprünglich unterschiedliche Ideologien und Perspektiven für die Regierungsarbeit hatten. Mit ihrer Bildung wurde jedoch zugleich auch ein Problem geschaffen, denn dadurch fehlte im Parlament gegenüber der absoluten Mehrheit eine tatsächliche Opposition. Dieses einheitliche politische Bild rief auch außerhalb des Parlaments Oppositionsbewegungen hervor. Die bedeutendste war die Außerparlamentarische Opposition (APO), eine Bürger- und Studenteninitiative, die zusammen mit dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) in den Universitäten die Avantgarde der soziopolitischen Alternative bildete.2
Es war in diesem aufgeladenen Kontext, dass im Sommer 1967 anlässlich des Schahbesuchs ein Ereignis stattfand, das den Auslöser für die deutsche Studentenbewegung bildete: der Tod des Studenten Benno Ohnesorg. Ohne Vorwarnung wurde Ohnesorg am 2. Juni von der Polizei erschossen, als er an einer vom SDS organisierten Demonstration persischer und deutscher Studenten teilnahm.3 Seine Tötung führte zu einer beispiellosen Protestwelle (vgl. Klimke, 2008: 97): Studenten, Intellektuelle und Kritiker des Establishments drückten ihre Missbilligung der Brutalität des Polizeiansatzes aus und nahmen an großen Demonstrationen teil, die 1967 und 1968 in vielen Universitätsstädten der Bundesrepublik stattfanden.
Im Prozess der Mobilisierung der jungen Generation für mehr Teilhabe am politischen Leben muss die Rolle des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS) hervorgehoben werden. Unter der Führung von Rudi Dutschke, der Hauptfigur der westdeutschen Studentenrevolte bis zu dem Moment eines Attentatsversuchs auf ihn im April 1968, orientierte sich der SDS an sozialistischen und marxistischen Leitlinien. Sie sollten zu einer radikalen Umgestaltung der Gesellschaft führen, und zwar durch Sichtbarmachung der repressiven Züge im Bildungswesen, im soziopolitischen Bereich und auch in den Familien.4 Aus der Perspektive der jungen Protestler, die das sogenannte Dritte Reich entweder überhaupt nicht oder nur in der Kindheit erlebt hatten, fehlte der Bundesrepublik sowohl eine Demokratisierung als auch ein Auseinandersetzen mit der NS-Vergangenheit, die sie vom »Muff der 1000 Jahre« (zit. nach Kraushaar, 2000: 196) des Nationalsozialismus befreien konnte.5 Aus diesem Grund beharrte der SDS darauf, dass die unantastbare Autorität der Hochschullehrenden abgeschafft wurde. Dagegen und wegen drängender politischer Themen wie der Besuch des Schahs und die umstrittenen Notstandsgesetze organisierte er Demonstrationen.6
Im Rahmen des Kampfes für die freie Meinungsäußerung protestierten die Studenten dabei vor allem gegen die Springer-Presse, den übermächtigen Zeitungskonzern, der ihrer Meinung nach die Wahrhaftigkeit und die Unabhängigkeit eines Informationsmediums verstieß (vgl. Frei, 2008: 124). Am Ende der 1960er-Jahre war die Berichterstattung traditionell konservativer Zeitungen dieses Verlags durch den Stil der sensationslüsternen Klatschpresse geprägt. Unter ihnen stach besonders die auflagenstarke Bild-Zeitung hervor, die die Proteste der jungen Generation öffentlich diskreditierte und das Vorgehen der Autoritäten gegen die sogenannten »Rebellen«, d.h. gegen die Studenten und die Kritiker der gegenwärtigen Politik, unterstützte. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Kampagne des SDS gegen den Springerkonzern Erfolg bei den jungen Menschen hatte, die in den großen Städten wie Berlin, Hamburg oder München vor den Redaktionen und Verlagstoren demonstrierten, um die Auslieferung und den Verkauf der Bild-Zeitung zu verhindern.7
Neben der Kritik an der Innenpolitik war der Vernichtungskrieg der USA gegen die Guerillakämpfer der Vietcong der Hauptgrund für das internationale Engagement der deutschen Studentenbewegung (vgl. Dahmer, 1998: 25).8 In den 1960er-Jahren diskutierten und kritisierten die jungen Leute zentrale Ereignisse wie den Bau der Berliner Mauer und die Kubakrise zwar schon fernab eines einfachen, polarisierenden Ost-West-Gegensatzes, der ausschließlich zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion existierte.9 Jedoch wurde mit dem Vietnamkrieg der Ton der Kritik gegen die Legitimation der Großmächte, sich in innere Angelegenheiten der sogenannten Entwicklungsstaaten einzumischen, viel schärfer und die USA und die Bundesrepublik wurden dabei von den Protestierenden zunehmend als Symbol einer Politik angesehen, die ökonomische Interessen über die Menschenrechte stellte. Im Jahre 1968 – das als das symbolische Jahr des Aufruhrs in der Bundesrepublik und im Westen gilt (vgl. Uesseler, 1998: 282) – wurde die transnationale Dimension der Protestbewegung offenkundig, indem die jungen Deutschen sich auch für viele internationalen Ereignisse interessierten. Sie befürworteten die revolutionären Ideen des Pariser Mai und solidarisierten sich mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA (diese wurde von Martin Luther King angeführt, der 1968 ermordet wurde). Dazu kämpften sie ebenfalls für die Befreiungsbewegungen in den sogenannten Dritte-Welt-Ländern und demonstrierten für die von Alexander Dubčeks vorgeschlagenen Reformen im Rahmen des »Prager Frühlings«.10
Wie in anderen Ländern Westeuropas beschränkte sich die Utopie des Wandels der jungen Deutschen nicht auf politischen Aktivismus: Durch die kosmopolitischen und städtischen Studenten erlebte die Bundesrepublik die Herausbildung einer »Alternativkultur« (Hickethier, 2003: 26) – eine Kultur, die im Rock’n’Roll und in der Popmusik Inspiration für die von Unbefangenheit und Kampfgeist geprägte Geisteshaltung der jungen Leute fand. Wie Volker Brand ausführt:
Die neu entstandene musikalische Popkultur der Jugendlichen äußerte sich immer mehr als Affront gegen die materielle, spießig-versteinerte Erwachsenenwelt. Dafür spricht jedenfalls der Erfolg von Rockgruppen wie »The Who« oder »The Rolling Stones«, die bewußt provozierend gegen die »guten Sitten« der Gesellschaft verstießen. (Brand, 1993: 134)
Begierig auf ein modernes Leben, das ihnen gleichermaßen neue Erfahrungen und einen von moralischen Vorhaltungen freien Lebensstil ermöglichte, entschieden sich viele deutsche Studenten am Ende der 1960er-Jahre auch für andere Wohnformen. Sie verließen die engen Zimmer in Studentenheimen und zogen in sogenannte gemischte Wohngemeinschaften, wo junge unverheiratete Männer und Frauen ohne Verpflichtungen zusammenlebten.11 Wegen des eindeutigen Verstoßes gegen die herrschende soziale Norm überrascht es nicht, dass die konservativeren gesellschaftlichen Kreise und die öffentliche Meinung von skandalösen Zuständen sprachen, insbesondere aufgrund der sogenannten »sexuellen Revolution« und des ihrer Meinung nach promiskuitiven und unmoralischen Verhaltens der jungen Generation.
Der Versuch, Ende der 1960er-Jahre in der deutschen Gesellschaft eine »Alternativkultur« zu implantieren, hatte laut Helmut Dahmer andauernde politische und soziokulturelle Folgen:
Die Jugendrevolte der sechziger Jahre hat in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft neue »Werte« kreiert und eine Änderung der Mentalität und Lebensweise durchgesetzt. Sie bereitete damit den (Bildungs- und Rechts-)Reformen und den neuen »sozialen Bewegungen« der siebziger und achtziger Jahre (der feministischen, der pazifistischen und der »grünen«) den Weg. In der Nach-68er-Bundesrepublik ließ es sich freier atmen, der Horizont der Gesellschaft schien bedeutend erweitert, und es gab einen neuen Toleranz-Spielraum für »alternative« Denk- und Lebensweisen. (Dahmer, 1998: 33)
Die 1968er-Generation trat für einen Bruch mit der Vergangenheit und für das Entwerfen neuer Horizonte ein und versuchte, sich als alternative Kraft für die Gestaltung der jungen Bundesrepublik zu profilieren. Dabei betonte sie ein von Grund auf neues Ethos, das sich sowohl von den geerbten autoritären Tendenzen des Nationalsozialismus als auch von den konservativen gesellschaftlichen Zügen der Ära Adenauer radikal unterscheidet. Das junge Engagement hinsichtlich der antiautoritären Bewegung zusammen mit dem Willen, die Gesellschaft für die neuen Zeiten zu öffnen, waren Leitmotive der deutschen Studentenbewegung und trugen bei zur Bekräftigung von 1968 als dem Jahr der Jugendrevolte, das nach der Meinung von Wolfgang Kraushaar große Veränderungen in der Bundesrepublik nach sich zog (vgl. Kraushaar, 1998: 323).