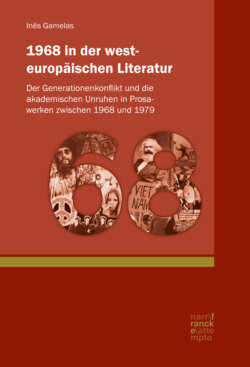Читать книгу 1968 in der westeuropäischen Literatur - Ines Gamelas - Страница 16
2.1.2 Erzählstrategien
ОглавлениеEingerahmt von der »Neuen Subjektivität« der 1970er-Jahre sind Lenz und Heiβer Sommer zwei Werke, die ähnliche narratologische Optionen wählen. Sie tragen gemeinsame Züge einer literarischen Strömung, die sich durch die Vorherrschaft des Ich-Gefühls, durch die subjektive Verarbeitung der alltäglichen Erfahrungen und durch die Selbstbestimmung auszeichnet (vgl. Meid, 2004: 486).
Es ist besonders der individuelle, nach innen gerichtete Blick auf die historische Aktualität jener bewegten Zeit, die Lenz zu einem der Schlüsselwerke der »Neuen Subjektivität« macht (vgl. Platen, 2006: 28):
Man feierte den »Lenz« als literarischen Fürsprecher einer Neuorientierung, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, den verhärteten Kurs der linken Kadergruppen zu korrigieren und die Bewegung wieder an ihre ursprüngliche Idee, die Verbindung von Politik und Sensibilität, zu erinnern. Für die Literaturkritik ist denn der »Lenz« auch der literarische Markstein eines Umdenkens innerhalb der Bewegung, nicht nur was das inhaltliche Bekenntnis, sondern auch, was die literarische Darstellung betrifft. (Prinz, 1990: 213)
Als Eine Erzählung betitelt, ähnelt Lenz einer Chronik ohne konkrete Datumsangaben. Die Eintragungen scheinen nicht nur die Erlebnisse des Protagonisten in der unmittelbaren Zeit nach der Hauptphase der 1968er-Revolte, sondern auch auf eine intime und persönliche Weise seine Überlegungen und Beunruhigungen darzustellen.1 Interessanterweise ist Lenz dennoch keine autobiographische Erzählung – so wie viele andere Werke der »Neuen Subjektivität«, in denen in der ersten Person erzählt wird.2 Entsprechend der Terminologie von Franz Stanzel gibt es in Lenz eine Er-Erzählsituation, in der der Protagonist nah an der Rolle einer »Reflektorfigur« ist (Stanzel, 2008: 16).3 Alle Ereignisse der Erzählung werden durch die Wahrnehmung von Lenz gefiltert und nur das, was der Protagonist weiß, erlebt und denkt, wird bekannt gegeben. Zu dieser Nähe zwischen dem Erzähler und dem Protagonisten trägt die erlebte Rede bei: »Die Erzählung ist in erlebter Rede von einem Erzähler erzählt, der sehr selten den Blickwinkel des Protagonisten überschreitet« (Platen, 2006: 42).
Auch in Heißer Sommer verknüpfen sich die Zeichen der zeithistorischen Wirklichkeit der 1968er-Revolte mit den für die »Neue Subjektivität« kennzeichnenden Zügen:
Trotz der Nähe des Romans zum […] Konzept des politischen Realismus, gibt es auch in Heißer Sommer eben jene poetischen Durchschüsse, die auf eine subjektive Erfahrungsebene jenseits des ideologischen Überbaus verweisen. (Fuchs, 2003: 229)
So wie in Lenz entsteht diese subjektive Darstellung der Erlebnisse der Studentenbewegung in Heißer Sommer durch die Er-Erzählsituation, in der der Erzähler zurücktritt. Nach einem ersten Versuch, den Roman in der Ich-Erzählsituation zu verfassen, wählte Uwe Timm eine andere narrative Perspektive, die sich nah am autodiegetischen Fokus befindet. Darin übernimmt der Protagonist die Funktion des »Reflektors« (Stanzel, 2008: 16) und der Leser sieht die Welt durch Ullrichs Augen.4 In Heißer Sommer dominiert die Darstellung (nach Stanzel) und der Erzähler beschränkt sich darauf, die Narrative zu organisieren, und verzichtet auf wertende oder reflektierende Interventionen. Diese Unmittelbarkeit des Erzählten trägt dazu bei, die Zeichen von einer Vermittlung seitens des Erzählers zu mindern.
Im Verlauf des Romans folgt der Erzähler nicht nur anderthalb Jahren von Ullrichs Lebenslauf, sondern er begleitet auch die Überlegungen des Protagonisten über das, was passierte, und das, was er erlebte. Die Erinnerungen Ullrichs an seine Erlebnisse während der Studentenbewegung ebenso wie jene der Kindheit und Jugendzeit werden mithilfe von Analepsen vorgestellt, die direkt vom Protagonisten abhängen. Diese Analepsen ermöglichen die Darstellung einer individualisierten Perspektive der Zeit des Umbruchs 1968, da sie Ullrichs Anstrengungen bei seiner Identitätsfindung zeigen.
Diese Identitätsfindung und die Suche nach emotionaler Reife beider Protagonisten in bewegten Zeiten – einer Reife, die ihnen zu mehr Gelassenheit im Rahmen der von ihnen gemachten Erfahrungen während der Studentenrevolte (und danach) verhilft – sind ein Zeichen der Interdependenz zwischen dem Psychologischen und dem Politischen, die Peter Schneiders und Uwe Timms Werke charakterisiert. Sowohl Ullrichs als auch Lenzʼ Handeln wird nicht nur durch die historischen Ereignisse geprägt, sondern beide Protagonisten werden auch durch ihre introspektive Haltung und ihre Reflexionen, durch ihre emotionale Unzufriedenheit gestaltet, die sie antreibt und wachsen lässt. Wie im Folgenden dargestellt wird, versuchen beide, in Zeiten von Tumult und Agitation sowohl im Rahmen des politischen Aktivismus als auch der sexuellen Revolution und des Sittenwandels ihr Gleichgewicht und innere Ruhe zu finden.