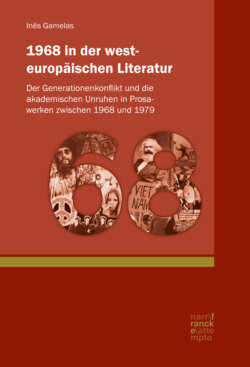Читать книгу 1968 in der westeuropäischen Literatur - Ines Gamelas - Страница 15
2.1 Lenz von Peter Schneider und Heißer Sommer von Uwe Timm 2.1.1 Peter Schneider und Uwe Timm: die literarisierte Revolte in der Bundesrepublik
ОглавлениеNach dem Klima der Agitation, das an den Universitäten und auf den Straßen der Bundesrepublik 1967 und 1968 herrschte, erhielten die liberale Haltung der jungen Generation und ihre Erfahrung bei den Ereignissen des akademischen, politischen und soziokulturellen Aufruhrs Platz in der literarischen Szene. Sie zeigten sich in der literarisierten Revolte, d.h. in einer Reihe von Texten, die sich der fiktiven Darstellung der Studentenbewegung Ende der 1960er-Jahre widmeten.1 Herausgefordert durch die allmähliche Auflösung der Außerparlamentarischen Opposition (APO), durch das Auftauchen tiefer ideologischer Unterschiede, die zur Auflösung des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) führten (vgl. Scott Brown, 2013: 106), sowie durch das Abflauen der Mobilisierung der jungen Generation für die Erneuerung der politischen und soziokulturellen Strukturen Westdeutschlands, wurde die antiautoritäre Protestkultur als literarisierte Revolte fortan in den Bereich der Literatur verlagert.2 Die literarische Produktion, die im Kontext der literarisierten Revolte erschien, entstand vor allem in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre durch eine neue Autorengeneration. Diese literarische Produktion fand in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre ihren inhaltlichen Schwerpunkt und sie konzentrierte sich sowohl auf die politischen als auch auf die soziokulturellen Erfahrungen, die die junge Generation während und nach der Revolte machte:
Es ist eine Zeit-Literatur im genauen Sinn des Wortes: Reflex persönlicher Geschichten und gesellschaftlicher Entwicklung, Verarbeitung von Erlebnissen und Wandlungsprozessen, auch Kritik und Distanzierung festgefügter Standorte und Positionsbestimmungen. (Schnell, 2003: 388)
Im literarischen Milieu debütierend und vereint durch die Erfahrungen im Rahmen der intensiven Jahre der Studentenbewegung von 1968 (vgl. Talarczyk, 1988: 143), bemühte sich die neue Autorengeneration darum, Zeugnis des Erlebten abzulegen. Gleichzeitig reflektierte jeder Autor individuell über die ersehnten Utopien vom Wandel, über die sowohl im öffentlichen wie im privaten Bereich erreichten Veränderungen und auch über die persönliche und kollektive Erfolglosigkeit im Rahmen der Studentenbewegung.3 Weit über eine bloße Dokumentation der Jugendrevolte hinaus nahm sich diese junge Autorengeneration vor, der westdeutschen Literatur eine neue Richtung zu geben. Sie zielte auf eine politische Ausrichtung, die der linken Ideologie nahestand, und auf eine ausgeprägte soziale Verantwortung. Dieser Vorschlag der jungen Autoren der 1970er-Jahre distanzierte sich gleichermaßen von der »bourgeoisen« Sichtweise der »etablierten« Literatur – die sie lediglich als Unterhaltungsliteratur ohne eine politisch oder sozial engagierte Dimension ansahen (vgl. Bullivant, 1989: 37) –, wie von der Richtung einer politisierten Literatur der Gruppe 47.4 Sie schrieben der literarischen Produktion der neuen Dekade eine aktivere und zeitgemäßere Funktion von gesellschaftlicher Intervention zu, in der sie gleichermaßen zur Reflexion über die Fragen der Studentenbewegung anregen wie sich als Motor politischer und soziokultureller Veränderung präsentieren sollte.5
Trotz der starken dokumentarischen Komponente, die mit den historischen Ereignissen der 1960er-Jahre verbunden ist, beschränkt sich das literarische Ethos der literarisierten Revolte nicht auf ein realistisches Abbild der akademischen Unruhen und auch nicht auf einen mobilisierten Appell, um die Massen zum politischen Aktivismus und zur Umgestaltung der Gesellschaft zu bewegen. Es wird deutlich, dass dieses »minor genre« (Preece, 1992: 301)6 der 1970er-Jahre weder einem politischen noch einem vereinheitlichten literarischen Programm folgte, sondern sich durch individuelle Tendenzen und Stile leiten hieß (vgl. Hubert, 1992: 17): Dabei wurde die persönliche, subjektive Sichtweise eines jeden Autors auf die Unruhen am Ende der 1960er-Jahre bevorzugt. Diese persönliche Ansicht der politischen und soziokulturellen Ereignisse jener Zeit, die von einem starken autobiographischen Register bestimmt wurde, entspricht der individuellen und introspektiven Fokussierung der »Neuen Subjektivität« oder »Neuen Innerlichkeit«, einer literarischen Strömung der 1970er-Jahre, die als Reaktion auf die politisierte Literatur der Studentenbewegung entstand.7 In ihr befanden sich viele der Autoren der 1968er-Generation, die über ihre Erfahrungen mit der Studentenbewegung und über ihre jeweilige Suche nach Identität in dieser zugleich öffentlich wie privat bewegten Zeit schrieben:
»Neue Subjektivität« […] weist auf eine Distanzierung hin: Man will sich dezidiert absetzen von der Literatur der vorausgegangenen Phase, und zwar durch prononcierte Ichhaftigkeit und Emotionalität. Akzentuiert wird der Gegensatz zur »Literatur der Politisierung«, die im Kontext oder Gefolge der studentischen Revolte der sechziger Jahre entstanden war. Mit der neuen Schreibweise soll nun der Erwartungshorizont des Lesers, der auf politische Literatur fixiert war, überschritten werden, und zwar in Richtung auf ein bisher tabuiertes Thema, nämlich das der persönlichen Empfindungen, das in den Jahren der Revolte als besonders obsolet gegolten hatte. (Gerlach, 1994: 9f.)
Es ist daher nicht verwunderlich, dass die literarisierte Revolte eine in Form und Inhalt vielfältige Produktion hervorbringt, die offen für verschiedene Weltanschauungen jener Epoche ist:
Denn diese Autoren schreiben Romane, Erzählungen, Prosatexte, Autobiographien, die Entwicklungsprozesse vorführen, nicht selten ihre eigenen: Politisierungen, Einstellungsveränderungen, den Zusammenhang und Widerspruch von Privatheit und Öffentlichkeit, von theoretischer Reflexion und politischem Handeln. Es findet sich in dieser Literatur auch ein Moment der Selbstkritik, der Abrechnung mit eigenen Fehlern und Versäumnissen. (Schnell, 2003: 389)
Es gibt in der Tat zahlreiche Gemeinsamkeiten in der narrativen Fiktion der Autoren der 1968er-Generation. Die während der literarisierten Revolte geschriebenen und veröffentlichten Werke haben als diegetisches Zentrum die aufrührerische Zeit der Revolte an den Universitäten und die Zeitspanne der individuellen und intellektuellen Introspektion nach 1968. Darüber hinaus beschäftigen sie sich mit den Themen dieser Epoche, wie zum Beispiel dem Konflikt zwischen Eltern und Kindern, oder zwischen Professoren und Studenten, dem Versuch eines Bruches mit dem Establishment, der Infragestellung des Engagements für den politischen Aktivismus, dem Erlebnis der sexuellen Befreiung und nicht zuletzt der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Mal direkter, mal indirekter zeigen sich diese zentralen Fragen in der Erzählung Lenz (1973) von Peter Schneider und im Roman Heißer Sommer (1974) von Uwe Timm, beide von der Kritik als Schlüsseltexte der literarisierten Revolte bezeichnet (vgl. Cornils, 2000: 116). Betrachtet als Kultbücher jener Zeit – nicht nur wegen der Verkaufszahlen, sondern auch im Urteil der Leserschaft und der Kritik (vgl. Götze, 1981: 369) –, markieren Lenz und Heißer Sommer den Aufstieg der jungen Autoren Schneider und Timm in der literarischen Szene der Bundesrepublik der 1970er-Jahre.8 Sie verschafften ihnen einen hervorstechenden Platz unter der Autorenschaft der Zeit, die versuchte, das soziopolitische Umfeld von Krise und Agitation innerhalb der jungen Generation am Ende der 1960er-Jahre literarisch zu verarbeiten (vgl. Rinner, 2013: 35).9
1940 geboren, hatten Schneider und Timm einen Start ins Leben, der dem vieler Angehöriger der 1968er-Generation ähnelte. Während ihrer Kindheit erlitten viele tagtäglich nicht nur die Entbehrungen und Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg, sondern teilten auch die Abwesenheit des Vaters im Haushalt, der im Dienst der Wehrmacht stand. Als Angehöriger der Generation der Trümmerkinder erlebten Schneider und Timm die Vertreibung aus ihren Geburtsorten, um vor den Bombardierungen während des Zweiten Weltkrieges zu fliehen: Die Familie Schneider sah sich gezwungen, nach Grainau umzuziehen (vgl. Riordan, 1995: 13); die Familie Timm, nachdem sie ihr Haus in den Hamburger Bombenangriffen 1943 verloren hatte, musste nach Coburg übersiedeln (vgl. Hielscher, 2007: 10). Außer diesen traumatischen Erfahrungen gab es in beiden Familien ein weiteres Kriegsmerkmal: Die Väter beider Autoren waren beide Soldaten – Timms Vater ging freiwillig zur Luftwaffe (vgl. Hielscher, 2007: 14) und Schneiders war Signalgeber (vgl. Riordan, 1995: 13) – und beide waren nach der Kapitulation Deutschlands Kriegsgefangene.10 Nach dem Ende des Nationalsozialismus und während der ersten Schritte einer demokratischen Regierung erlebten sie in den 1950er- und 1960er- Jahren das ökonomische Wachstum sowie soziokulturelle Veränderungen durch das Wirtschaftswunder und die Konsumgesellschaft in der Bundesrepublik. Noch größere Ähnlichkeiten bestehen jedoch in den biographischen Laufbahnen dieser zwei damals jungen Autoren in der Zeit ihres Studiums und der 1968er-Studentenrevolte.11
Nach kurzen Aufenthalten in Freiburg und in München schrieb sich Peter Schneider 1962 an der Freien Universität Berlin für Germanistik, Geschichte und Philosophie ein. Während dieses Jahrzehntes kombinierte er das Studium mit Tätigkeiten beim Rundfunk und nachher bei Zeitungen und Zeitschriften, wo er Essays und Literaturkritiken veröffentlichte, was ihn in den Intellektuellenkreisen Westberlins zunehmend bekannt machte.12 Später, im Jahre 1967, entwickelten sich Beziehungen zu Rudi Dutschke und dem Schriftsteller und Vordenker der Studentenbewegung Hans Magnus Enzensberger.13 Im weiteren Verlauf nahm Schneider eine immer herausragendere Stellung innerhalb des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) sowie als Redner und Koordinator des »Springer Tribunals« ein. Das »Springer-Tribunal« war eine studentische Protestaktion, um die Voreingenommenheit und die Manipulation von Information durch den Springerkonzern in der medialen Öffentlichkeit anzuprangern (vgl. Scott Brown, 2013: 193). Schneider war auch Autor unterschiedlicher Reden, Flugblätter und Essays, die die Ideen der jungen Protestler inner- und außerhalb der Universitäten verbreiteten.14 Trotz seiner Zweifel bezüglich der Leitprinzipien und der antiautoritären Kampfformen der Studenten, die er Anfang 1968 zu spüren begann (vgl. Riordan, 1995: 16), blieb Peter Schneider der Studentenbewegung bis zum Ende der 1960er-Jahre verbunden. Aufgrund seines herausragendes Rufes in der deutschen Szene wurde er aufgefordert, auch an der italienischen Studentenrevolte in Trient teilzunehmen (vgl. Schneider, 2008: 309), und, nachdem er 1969 nach Berlin zurückgekehrt war, beteiligte er sich an Arbeitsgruppen, die die Arbeiterklasse mithilfe der Veränderungsideale der Studentenbewegung zu mobilisieren versuchten.15
Seine Erfahrung der Studentenbewegung machte Uwe Timm nicht in Berlin, sondern hauptsächlich in München, wo er sich 1963 für Germanistik und Philosophie einschrieb. Wie viele andere jener Zeit kam er Ende der 1960er-Jahre in Kontakt mit den akademischen Unruhen in den Universitäten. Seine Erfahrung als Promotionsstudent an der Sorbonne noch vor dem Ausbruch des Mai 68 in Frankreich, wo er seine Doktorarbeit voranbrachte, machte ihn vertraut mit Themen wie dem Vietnamkrieg, der Lage in der sogenannten Dritten Welt und den Protesten gegen das kapitalistische System, die die internationale Studentenbewegung kennzeichneten (vgl. Timm, 2007: 109). Aber es war vor allem nach dem Tod Benno Ohnesorgs am 2. Juni 1967 und der daraus resultierenden Protestwelle, die die Bundesrepublik erfasste, dass Uwe Timm für die Ideale des antiautoritären Kampfes entbrannte.16 Nach diesem einschneidenden Ereignis in seinem Leben beschließt er, in den SDS einzutreten, und schon in München entscheidet er sich dazu, Flugblätter zu verfassen, Teach-ins zu organisieren und an Fakultätsbesetzungen und Demonstrationen teilzunehmen (vgl. Hielscher, 2007: 64). Das Ziel, den Status quo zu verändern und die Menschen zu mobilisieren, das Uwe Timm im Protestimpetus seiner Generation fand, brachte ihn auch dazu, Straßentheaterstücke zu organisieren und Protestgedichte zu schreiben (vgl. Kraft, 1993: 1086). Auf diese Weise vertiefte er seinen Glauben an die gesellschaftsverändernde Rolle der Literatur und an die Wichtigkeit des politisch engagierten Schriftstellers (vgl. Bullivant, 1989: 35).17
Die Bedeutung des Erlebnisses des Aufruhrs von 1968 für Peter Schneider und Uwe Timm zeigte sich nicht nur in den Erstlingswerken, sondern blieb auch lebenslang in ihren anderen Romanen und Texten sichtbar. Nach dem Erfolg von Lenz (1973) erregte Schneider Aufsehen mit …schon bist du ein Verfassungsfeind (1975), einer Erzählung, die ein akutes und für viele der 1968er-Generation bekanntes Thema behandelte: die Frustration derjenigen, denen aufgrund ihrer Vergangenheit als Aktivisten die Aufnahme ins Beamtenverhältnis per Gesetz verboten wurde.18 Später in Paarungen (1992) thematisiert er die Beziehungsprobleme der inzwischen 50-Jährigen der Studentenbewegung und in Eduards Heimkehr (1999) beschäftigt er sich mit den Leitlinien der Studentenrevolte anhand eines ehemaligen 1968er-Aktivisten, der seine alten Überzeugungen der letzten Phase der 1960er-Jahre überprüft, als er sich in einem wiedervereinten Berlin mit dem Erbe des Nationalsozialismus auseinandersetzt (vgl. Rinner, 2013: 45).19 Bei Uwe Timm tauchen die historischen Ereignisse der 1968er-Generation regelmäßig auf: In Kerbels Flucht (1980), wo das Scheitern der Utopien von 1968 problematisiert wird, danach in Rot (2001) und in Freitisch (2011), zwei Werken, die den Hoffnungsvollen und Desillusionierten der Studentenbewegung Ausdruck geben – dies geschieht in einer Retrospektive ehemaliger Protestler, die in die Jahre gekommen sind. Ein weiteres wichtiges Zeugnis ist die autobiographische Erzählung Der Freund und der Fremde (2005), in der, ausgehend von den Erinnerungen Uwe Timms und seines Freundes Benno Ohnesorg aus der Jugend- und Studentenzeit, ein Bild der 1968er-Bewegung in der Bundesrepublik und in Frankreich gezeichnet wird (vgl. Nicklas, 2015: 81).20
Lenz und Heißer Sommer konzentrieren sich auf die utopischen Hoffnungen und auf die Erfahrungen der Enttäuschung oder Desillusionierung, die eine ganze Generation kennzeichnen. Beide Texte prägen die literarische Laufbahn beider Autoren, die sich durch ein akzentuiertes geschichtliches Bewusstsein, eine intensive Sozialkritik und die Neubetrachtung der Vergangenheit als Infragestellung des Verhaltens der jungen Generation am Ende der 1960er-Jahre charakterisieren lässt.21 Dieses Interesse für die verschiedenen Wertvorstellungen der Protestkultur zusammen mit einer ständigen Reflexion machen Schneider und Timm zu Autoren der 1968er-Generation par excellence. Beide machten aus der Studentenbewegung eine Art Leitmotiv ihrer literarischen Produktion (vgl. Durzak, 2006: 603) und erreichten schon in ihren Erstlingswerken eine problematisierende und in Frage stellende Darstellung der Studentenbewegung auf ihrem Höhepunkt.