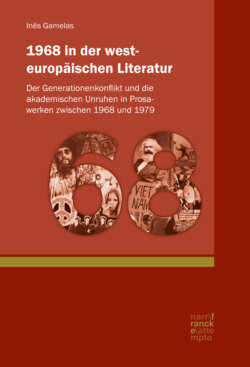Читать книгу 1968 in der westeuropäischen Literatur - Ines Gamelas - Страница 7
1.1 Das soziokulturelle Brodeln im Westeuropa der späten 1960er-Jahre
ОглавлениеDie 1968er-Studentenbewegung und die Protestkultur der jungen Generation am Ende der 1960er-Jahre nahmen weltweit eine einzigartige Gestalt an und wurden somit zur »ersten globalen Revolte« (Kraushaar, 2000: 19) nach dem Zweiten Weltkrieg.1 Die Vielzahl der Protestorte, die Originalität der Protestaktionen und die Intensität der Unruhen sind prägende Zeichen der 1968er-Studentenbewegung. Sie erreichte ihren symbolischen Höhepunkt 1968, das als Schlüsseljahr des Aufruhrs bekannt wurde (vgl. Marwick, 1998: 585). 1968 war nicht nur für den Protest gegen die etablierten Werte entscheidend, sondern gab auch ein Zeichen für eine einzigartige soziokulturelle Wende der westlichen Welt. Provokation, Konfrontation und Widerstand internationalisierten sich und verwandelten sich in Parolen der jungen Menschen. Sie gaben der erneuernden Geisteshaltung Ausdruck, die eine ganze Generation zusammengebracht hat. Wie Mark Kurlansky in 1968: The year that rocked the world (2004) schreibt:
What was unique about 1968 was that people were rebelling over disparate issues and had in common only that desire to rebel, ideas about how to do it, a sense of alienation from the established order, and a profound distaste for authoritarianism in any form. […] The rebels rejected most institutions, political leaders, and political parties. (Kurlansky, 2004: xvii)
Diese »Rebellen« waren vorwiegend junge Menschen in ihren Zwanzigern, hauptsächlich Studenten, deren Familien meist der Mittel- und Oberschicht angehörten und die sich als Kraft politischer und soziokultureller Veränderung behaupten wollten, indem sie sich von den etablierten Weltanschauungen, Lebensstilen wie auch von den verschiedenen Formen, in Gemeinschaft zu sein, zu unterscheiden beabsichtigten. Diese jungen Protestler der 1960er-Jahre gehörten zwar verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen soziokulturellen Wirklichkeiten an und hatten daher auch landesspezifische Protestziele. Aber der Wille, die Gesellschaft zu verändern und mit dem Status quo zu brechen, vereinte die junge Generation auf der Suche nach einer Utopie von transnationalem Wandel. Die Grenzen jedes Landes überschreitend hat sich diese Utopie teils latenter, teils offenkundiger in vielen westeuropäischen Ländern verbreitet.2 Trotz der bestehenden Divergenzen in den politischen Systemen wurde der Kampf der Aktivisten überall spürbar, sowohl in den demokratischen Gesellschaften als auch in Ländern, die sich in Westeuropa noch unter dem diktatorischen Joch befanden – was der Fall in Spanien und Portugal war. In der Sichtweise der europäischen Protestler basierte das Hauptproblem auf der Diskrepanz zwischen der Realpolitik, die von ihnen als dysphorisch wahrgenommen wurde, und dem Bild von Ruhe und Wohlstand, welches durch die Regierung verbreitet wurde. Ende der 1960er-Jahre waren die Bundesrepublik, Frankreich und Italien – zusammen mit dem Vereinigten Königreich – die am höchsten entwickelten Ökonomien in Westeuropa. Sie alle wurden von Verfechtern des Kapitalismus und konservativen Regierungen, parlamentarischen Mehrheiten oder großen Koalitionen geführt, so dass die rebellierenden Studenten sie als autoritär, manipulierend und desinteressiert an der Schaffung von Alternativen kritisierten. Selbst im totalitären Spanien und Portugal hatte sich dieses Bild von friedlichen und wohlhabenden Ländern verbreitet. Hier jedoch war der Begriff, den die jungen Menschen von Propaganda und Manipulation hatten, ein ganz anderer und trotz der Repression demonstrierten sie und organisierten verschiedene Protestaktionen gegen die herrschenden Regime.3
Diese gemeinsame Widerstandsbereitschaft kennzeichnet wiederum die ideologische und soziokulturelle Generationenspaltung jener Zeit. Für die jungen Menschen repräsentierte die ältere Generation real und symbolisch die herrschende Ordnung, die von bürgerlichen, traditionellen und konservativen Vorstellungen geleitet wurde. Sie sahen in dieser Ordnung eine Kultur der Oberflächlichkeit und des Scheins, die sie beenden wollten, und profilierten sich als Verteidiger einer Erneuerung. Ihr Ziel war es, eine neue Welt zu erbauen, eine Welt, die auf Kreativität, Freiheit und auch auf politischem und gesellschaftlichem Engagement beruht. Diese neue Ordnung predigte das Ende des West-Ost-Konfliktes des Kalten Krieges und somit eine gerechtere und humanere globale Gesellschaft. Wie Rudi Dutschke, einer der Anführer der westdeutschen Studentenbewegung am Ende der 1960er-Jahre, behauptete:
Jede radikale Opposition gegen das bestehende System, das uns mit allen Mitteln daran hindern will, Verhältnisse einzuführen, unter denen die Menschen ein schöpferisches Leben ohne Krieg, Hunger und repressiver [sic!] Arbeit führen können, muß heute notwendigerweise global sein. Die Globalisierung der revolutionären Kräfte ist die wichtigste Aufgabe der ganzen historischen Periode, in der wir heute leben und an der menschlichen Emanzipation arbeiten. (Dutschke, 1968: 85)
Zur Entstehung der Widerstandsbereitschaft der jungen Generation und ihrer Kritik an der Gesellschaft trugen historische, soziopolitische und kulturelle Faktoren bei, die sich überall in Westeuropa manifestierten und die jungen Leute vereinigten. In seiner Analyse der Vorläufer von 1968 charakterisiert Laurent Joffrin den ökomischen Kontext der Nachkriegszeit und hebt ähnliche Merkmale dieser jungen Generation vor:
Dans l’après-guerre occidental, les « baby-boomers » reçoivent d’emblée, par le hasard de l’histoire, des traits marquants, communs à des millions d’enfants sur trois continents. Ils ne connaîtront plus la guerre sur leur sol […]. Ils grandiront dans une atmosphère de croissance rapide et régulière. Ils vivront tous les effets, culturels, bienfaisants ou pervers, de la « société d’abondance ». […] Nés dans la pénurie, les « baby-boomers » sont nubiles dans un début d’abondance et adultes dans la prospérité. (Joffrin, 2008: 36f.)
[In der Nachkriegszeit im Westen haben die »Babyboomer« sofort, durch historischen Zufall, markante Züge bekommen, die Millionen von Kindern auf drei Kontinenten gemeinsam sind. Sie werden keinen Krieg im eigenen Land kennen lernen […]. Sie werden in einem Umfeld schnellen und beständigen Wachstums groß werden. Sie werden alle Effekte, kulturell, wohltuend oder pervers, der »Überflussgesellschaft« erleben […]. In Mangelzeiten geboren, wurden die »Babyboomer« in einem anfänglichen Kontext von Überfluss zu Jugendlichen und im Wohlstand Erwachsene.]
Der Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg folgte in Europa eine Zeit des physischen und psychischen Wiederaufbaus. Sie war angetrieben durch Bevölkerungswachstum in städtischen Bereichen und durch eine beispiellose Industrialisierung.4 Das Klima von allgemeinem Wachstum, Wohlstand und Sicherheit (vgl. Flores/De Bernardi, 2003: 92) verbunden mit der Wahrnehmung von soziopolitischer Stabilität der 1950er-Jahre bereitete den Boden für die Entstehung der Überflussgesellschaft. Die Babyboomer, die in der Konsumgesellschaft erzogen wurden, in der der Kapitalismus und standardisierte Verhaltensregeln dominierten, hatten die Gelegenheit, nicht nur den technologischen Fortschritt zu verfolgen, sondern auch die Vorteile des modernen Luxus zu genießen. Viele von diesen Vorteilen wurden durch die Industrialisierung für einen Großteil der Bevölkerung zugänglich. Der Fernseher, zum Beispiel, wurde damals zum allmächtigen Massenkommunikationsmittel und Unterhaltungsmedium (vgl. Marwick, 1998: 80f.). Außerdem wurden Vorteile wie schicke Modekleidung, Urlaubsreisen ins Ausland, der Kauf eines eigenen Autos und andere äußere Statusmerkmale zu Symbolen einer Scheinwelt, die die Mentalität der bürgerlichen Schichten im Europa der 1950er- und 1960er-Jahre prägten. Gemäß der anerkannten Standards des American way of life wurde das materielle Besitztum conditio sine qua non sowohl für einen außergewöhnlich hohen Sozialstatus als auch für einen vom Komfort geprägten Lebensstil.5 Dieser Lebensstil sollte durch ein konservatives Verhalten, durch Moralvorstellungen und gutes Benehmen eingehalten werden.6
Auf der einen Seite ermöglichte der wirtschaftliche Aufschwung eine allgemeine Verbesserung der Lebensbedingungen in Westeuropa, aber auf der anderen Seite endete er in einem ideologischen Zwiespalt, der ein erstes Zeichen war für den Antagonismus zwischen Eltern und Kindern. Die Herausbildung einer Kultur des Konsums und der bürgerlichen Werte in den 1950er-Jahren und bis zur Mitte der 1960er-Jahre (vgl. Judt, 2010: 485), das verbreitete Szenario politischer Stagnation sowie ein Paradigmenwechsel im Wirtschaftsbereich waren in den Augen der jungen Menschen zentrale Aspekte, die Ende der 1960er-Jahre den Weg für Aufruhr bereiteten.7
1966, 1967 und 1968 erlebten die Bundesrepublik, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Italien – alle damaligen Antriebskräfte der westeuropäischen Ökonomie – eine Rezession, die der erste systemische Krisenmoment des Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg war. Nach dem Klima des wirtschaftlichen Optimismus der 1950er- bis zur Mitte der 1960er-Jahre, die für viele der goldene Zeitraum des Kapitalismus war (vgl. Flores/De Bernardi, 2003: 22), folgte eine Verlangsamung der Industrialisierung in ganz Europa, die direkte Auswirkungen im Finanzsektor dieser Länder hatte. Da die Regierungen sich gezwungen sahen, das Haushaltsdefizit zu kontrollieren, investierten sie weniger in den Sozialstaat und in den öffentlichen Sektor und optierten sie für Lohnsenkungen und für Steuererhöhungen bei den Arbeiterklassen. Diese waren es, die am meisten unter der Krise litten. Die negativen Folgen dieser Politik manifestierten sich im Anstieg der Arbeitslosenzahlen, in einer starken Inflationsrate und in der Verschlechterung der Lebensbedingungen der Ärmsten.
All diese Maßnahmen und ihre sozialen Konsequenzen brachten eine Unzufriedenheit in die Gesellschaft, die ein wichtiges Fundament der 1968er-Studentenbewegung wurde. Angesichts der Unfähigkeit der Regierungen, auf die ökonomische Krise zu reagieren und grundlegende Änderungen in der parteipolitischen Ideologie vorzunehmen, wurde die Unzufriedenheit der jungen Generation zuerst im akademischen Milieu und danach auf den Straßen großer Städte lauter. Diese Generation drückte ihre Empörung über den zunehmenden sozialen Abstieg und ihren Willen zu einer radikalen Transformation der vorherrschenden Institutionen aus.
Der Protest der jungen Leute Ende der 1960er-Jahre in Westeuropa wurde in den Universitäten entzündet, wo die Studenten nach einer grundlegenden Reform der akademischen und administrativen Strukturen des Hochschulsystems verlangten.8 Unter den Fahnen des Studentenkampfes verbreiteten sich besonders die Forderungen nach einer größeren Anpassung des Curriculums an die außeruniversitäre Wirklichkeit, nach Öffnung des Lehrkörpers zu dringenden Themen der Aktualität und nach mehr Investitionen im Bildungsbereich.9 Auf der anderen Seite wurden die hohe Zahl von Studenten pro Professor, das Fehlen von Stipendien und die geringe Rate von Neueinstellungen aufgrund von Kürzungen im Bildungsetat als Zeichen des Niedergangs der europäischen Hochschulen identifiziert. Die Universitäten beruhten auf veralteten Modellen, die nicht zu den neuen Zeiten passten, die der zunehmenden Zahl von Studenten kaum eine Ausbildung mit Qualität boten und ihnen die Teilhabe an Hochschulpolitik verwehrten. In einem Manifest, das 1968 veröffentlicht wurde, beschrieb der italienische Studentenführer Guido Viale die Wirklichkeit der damaligen Universitäten (in Italien und nicht nur dort), wie sie die Studenten erlebten:
[…] per la maggioranza degli studenti […] l’Università funziona come strumento di manipolazione ideologica e politica teso ad instillare in essi uno spirito di subordinazione rispetto al potere (qualsiasi esso sia) ed a cancellare, nella struttura psichica e mentale di ciascuno di essi, la dimensione collettiva delle esigenze personali e la capacità di avere dei rapporti con il prossimo che non siano puramente di carattere competitivo. (Viale, 2008: 77)
[[…] für die Mehrheit der Studenten […] funktioniert die Universität als Instrument für ideologische und politische Manipulation und dies mit dem Ziel, ihnen einen Geist von Unterordnung unter die Macht (egal welcher Art) einzutrichtern sowie die kollektive Dimension der persönlichen Forderungen und die Fähigkeit, mit dem Nächsten Beziehungen zu führen, die nicht nur rein kompetitiv sind, aus der psychischen und mentalen Struktur jedes Studenten zu löschen.]
Geleitet durch einen reformistischen Geist setzten sich die Studenten für eine demokratische Erneuerung der Universitäten ein und forderten öffentlich eine höhere Autonomie der Hochschulen bei den Verwaltungsentscheidungen, die frei von staatlichen Einflüssen bleiben sollten.10 Durch originelle Protestformen, wie Barrikaden, Sit-ins, Fakultätsbesetzungen, Parolen und Massendemonstrationen auf den Campus der Universitäten, versuchten sie, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die ihrer Auffassung nach fehlende Freiheit der Meinungsäußerung – sowohl innerhalb der akademischen Welt als auch in der Öffentlichkeit – zu erregen und rebellierten sie gegen die pseudodemokratische Farce, in der sie zu leben glaubten.11
Sowohl im Kampf gegen den Autoritarismus des Establishments als auch durch die Zurückweisung des standardisierten bürgerlichen Lebens – welches sie als konservativ, kleinlich, beklemmend und repressiv betrachteten (vgl. Morin et al., 2008: 14) – verlangten die jungen Leute mehr Transparenz und Befreiung der sozialen Kommunikationsmedien.12 Sie forderten auch die Herabsetzung des Wahlalters – damals durfte man erst mit 21 Jahren wählen –, so dass sie aktiv am nationalen Entscheidungsprozess teilnehmen konnten. Außerdem solidarisierten sie sich mit den Arbeitern und Angestellten bei Streiks und Demonstrationen für mehr soziale Gerechtigkeit. Dies erwähnen Martin Klimke und Joachim Scharloth in ihrer Einführung zum Sammelband 1968 in Europe: A History of Protest and Activism (2008):
Decrying the alienation and the lack of democratic participation in their societies, students from Western Europe largely blamed capitalism for the rise of technocratic and authoritarian structures. […] In this process, the universities could serve as «centers of revolutionary protest» to prevent domestic repression, connect to the working class, and transform the underlying roots of society […]. (Klimke/Scharloth, 2008: 1)
Entscheidend für die Vereinigung der europäischen jungen Leute und für die Verbreitung ihrer Proteststimmung war auch die Rolle der Studentenführer. Einer linken Ausrichtung treu, sei diese marxistisch, kommunistisch oder anarchistisch, engagierten sie sich auch in den Medien für eine Verstärkung des Aufruhrs. Rudi Dutschke, Daniel Cohn-Bendit, Mario Capanna oder Tariq Ali gaben Ende der 1960er-Jahre der Proteststimmung ein Gesicht. Und dank ihrer Stimmen und ihrer Initiativen wurden Mobilisierungsformen entwickelt und die Koordination der gemeinsamen Ideen und ihrer Verbreitung in den verschiedenen nationalen Bewegungen geleistet.13
Es sei daran erinnert, dass der allerorts vorhandene Zugang zu den verschiedensten Informationen in den Medien ̶ vor allem im Fernsehen14 – zum Interesse der Studenten für die Probleme der unterdrückten Völker und sozial Marginalisierten beitrug. So vereinten sie sich bei internationalen Protestaktionen. Der Kampf gegen Rassendiskriminierung und die Forderungen nach dem Ende der diktatorischen Regime, die selbst in europäischen Ländern wie Spanien und Portugal fortbestanden, sind Beispiele des Aufstands der jungen Menschen für eine gerechtere, freiere und egalitärere Gesellschaft. Außerdem fügten sich die Unterstützung von Befreiungsbewegungen der sogenannten Dritten Welt und die Verehrung von revolutionären Führern wie Che Guevara und Fidel Castro in den antiautoritären Kampf der jungen Generation damals ein. Dessen Ziel war es, koloniale und imperialistische Unterdrückung und Tyrannei, besonders in Afrika und Lateinamerika, zu beenden.15
Im Kontext des antiimperialistischen Engagements der jungen Generation stand kein historisches Ereignis der 1960er-Jahre so sehr im Fokus der Kritik wie der Vietnamkrieg. Beim Hinterfragen der Legitimität der amerikanischen Bombenangriffe auf Vietnam, die sowohl durch das Fernsehen seit 1965 als auch durch Fotos weltweit übertragen wurden, betrachteten die Studenten diesen Krieg als den Katalysator des Protestes gegen die weltweite US-Hegemonie (vgl. Kraushaar, 2000: 24). Arthur Marwick beschreibt es folgendermaßen:
The Vietnam War – the attempt of the Americans to bolster the corrupt regime in South Vietnam against Communist North Vietnam and the Communist Vietcong in South Vietnam – waging a brutal campaign against ordinary villagers, killing hostages, using napalm, defoliants and other poisons, and then carrying the bombing raids to North Vietnam was the biggest single cause of protests and demonstrations [in the USA and Western Europe; IG]. (Marwick, 1998: 15)
Sprechchöre und der dabei wiederholte Ausruf des Namens des vietnamesischen Widerstandsführers Ho-Chi-Minh in den Hörsälen verschiedener westeuropäischer Hochschulen (vgl. Frei, 2008: 213) sowie die Verbreitung des Mottos »Make love, not war« waren sowohl für die US-amerikanischen jungen Protestler als auch für die europäischen ein Ventil für ihre Empörung gegen den Vietnamkrieg. Tatsächlich, und gemäß der Prophezeiungen Herbert Marcuses,16 der damals als der geistige Vater der internationalen Studentenbewegung betrachtet wurde (vgl. Joffrin, 2008: 95), sollte die rebellierende europäische junge Generation in die Fußstapfen der US-amerikanischen treten und in die Haut junger Revolutionäre schlüpfen:
Diese Jungen und Mädchen teilen nicht mehr die repressiven Bedürfnisse nach den Wohltaten und nach der Sicherheit der Herrschaft – in ihnen erscheint vielleicht ein neues Bewußtsein, ein neuer Typus mit einem anderen Instinkt für die Wirklichkeit, fürs Leben und fürs Glück; sie haben die Sensibilität für eine Freiheit, die mit den in der vergreisten Gesellschaft praktizierten Freiheiten nichts zu tun hat und nichts zu tun haben will. (Marcuse, 1967: 6)
Der politische Aktivismus der 1968er-Studentenrevolte wurde von einer kulturellen Revolution begleitet, in der verschiedene Experimente im Rahmen eines interkontinentalen Phänomens gemacht wurden. Dieses wurde als »Gegenkultur« bekannt und umfasst laut Arthur Marwick die verschiedenen Formen, Aktivitäten und Verhältnisse, die von den Lebensweisen und Werten der sogenannten mainstream culture abweichen oder diese in Frage stellen (vgl. Marwick, 1998: 12).17 Die Vorliebe der jungen Menschen für Provokation und für die Zurückweisung der etablierten Sitten und Gebräuche – die sowohl in den USA als auch in Westeuropa als Quintessenz der 1968er-Gegenkultur betrachtet wurde (vgl. Tanner, 2008: 75) – war charakteristisch für die Suche nach kreativen und avantgardistischen Alternativen zu der Doktrin des traditionellen und konservativen Ethos ihrer Eltern. Indem sie der Vorstellungskraft Raum gab, fand die junge Generation durch bunte und gewagte Kleidung, durch den Schock der visuellen Künste und den subversiven Klang des Beats und des Rock’n’Rolls die Ausdrucksformen einer internationalen Protest- und Widerstandssprache. Jeans und lange Haare, die Ausstrahlung der pazifistischen Strömung flower power ebenso wie die frenetischen Rhythmen der Beatles und Rolling Stones, neben den Protestliedern von Bob Dylan und Joan Baez, sind nicht nur einige Zeichen des Verschmelzens der Popkultur mit politischen Motivationen, sondern sie trugen auch zur Kennzeichnung der jungen, rebellischen 1968er-Generation bei. Darüber hinaus kannte das Westeuropa der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre eine wachsende Hippiebewegung, in der Musikgruppen mit psychedelischer Musik und Erfahrungen mit Drogen – unter anderem mit LSD – bei den jungen Leuten beliebt waren. Damit strebten die jungen Männer und Frauen nach einer Horizonterweiterung jenseits der Welt ihrer Eltern.18
Es war in diesem Kontext intensiver Provokation und Proteste gegen konservative Sitten und Gebräuche, dass die sexuelle Revolution stattfand – eine Revolution, die im Streben der jungen Menschen nach Freiheit und Emanzipation verankert war. Was vorher ausschließlich in die Privatsphäre gehört hatte, wurde öffentlich gemacht. Teile der jungen Generation machten spontanes Ausleben von Sexualität öffentlich und machten aus Permissivität ein Schlüsselelement der Gegenkultur der 1960er-Jahre im Westen: »‹Permissiveness› […] [refers to; IG] a general sexual liberation, entailing striking changes in public and private morals and […] a new frankness, openness, and indeed honesty in personal relations and modes of expression« (Marwick, 1998: 18).
Mit einer Verknüpfung von Öffentlichem und Privatem, von Persönlichem und Politischem kam es Ende der 1960er-Jahre in Westeuropa zu einer Verbreitung des hedonistischen peace & love – einer Weltanschauung, die vom Genießen der Empfindungen und von der Hervorhebung der Emotionen und Instinkte geprägt war. Das Erleben des gegenwärtigen Augenblicks, des Hier und Jetzt, wurde zu einem Imperativ, der die freie Liebe verteidigte, d.h. das Erleben von Beziehungen ohne Beschränkungen, Verbote oder Verbindlichkeiten.19 Dem zementierten rigiden Lebensentwurf der Älteren, so sahen es die Jungen, stellten sie ihr alternatives Modell entgegen: eine tolerantere und offenere Gesellschaft angesichts der sexuellen Freiheiten des Einzelnen, frei von moralischen Vorurteilen. Unter der Schirmherrschaft von Transparenz und Öffnung der Mentalitäten wurden nicht nur Tabuthemen wie die Pille, Kondome und Abtreibung, die zum Alltagsleben vieler Menschen der jungen Generation gehörten, sondern auch Fragen bezüglich Rollenstereotypen und Familienmodellen öffentlich diskutiert.
Dank der Infragestellung soziokultureller Konventionen und einer Zurschaustellung des Intimlebens der 1968er-Generation hat der Feminismus am Ende der 1960er-Jahre an Bedeutung gewonnen. Noch mehr Widerhall bekam er in den 1970er-Jahren (vgl. Schulz, 2008: 281f.). Aktivistinnen wie die Französin Simone de Beauvoir, die Deutschen Alice Schwarzer und Helke Sander, die Italienerin Carla Lonzi und die Britin Sheila Rowbotham brachten die nationalen Feministinnengruppen zu einem gemeinsamen Anliegen zusammen. Sie orientierten sich an einem Kampf für das Engagement der Frau in der Gesellschaft, für die Gleichheit der Rechte zwischen Männern und Frauen, für gleichen Lohn in den Fabriken und im Dienstleistungssektor und für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch.20
Durch mehr oder weniger durchdachte politische Überzeugungen motiviert oder lediglich um einen Gegensatz zu einer ihrer Meinung nach ökonomisch entfremdeten Gesellschaft zu setzen, wurde die Kultur des sex, drugs & rock’n’roll zu einem verbreiteten, identifizierenden Merkmal der jungen Generation Ende der 1960er-Jahre.21 Kühn und vielfältig verstärkte die Gegenkultur den Aufruf zum Widerstand der 1968er-Generation und präsentierte sich damit als moderne Alternative zum reaktionären und traditionsverhafteten Establishment im Europa der Nachkriegszeit:
Sovversione e protesta hanno coinvolto la sfera pubblica e quella privata, la dimensione collettiva e lo spazio individuale. Politica e musica, droga e religione, arte e sesso hanno formato per il mondo giovanile un intreccio che ha cambiato in profondo la propria vita: era inevitabile che la baby boom generation riversasse quel mutamento sull’intera società, e cercasse di farlo rapidamente e dovunque. (Flores/De Bernardi, 2003: 115; Hervorhebung im Original)
[Subversion und Protest erreichten die öffentliche und private Sphäre, die kollektive Dimension und den persönlichen Raum. Politik und Musik, Drogen und Religion, Kunst und Sexualität verknüpften sich so auf eine Weise in der Welt der jungen Menschen, die das Leben selbst so tief veränderte: Es war unvermeidlich, dass die Baby-Boomer-Generation diese Veränderungen in die ganze Gesellschaft trug und dies schnell und überall.]
Wie die Historiker Marcello Flores und Alberto De Bernardi im letzten Zitat aufzeigen, kannte der revolutionäre Charakter der jungen Europäer keine Grenzen. So sehr die Art Protest auszudrücken auch variierte, sie beruhte doch immer auf derselben Utopie von Veränderung. Es war diese Utopie, die die Identität der jungen Deutschen, Franzosen, Italiener, Spanier und Portugiesen am Ende der 1960er-Jahre definierte.
Nach der Präsentation der allgemeinen historischen, politischen und soziokulturellen Umstände und Bedingungen des generation gap Westeuropas soll jetzt eine detaillierte Darbietung des »extratextuellen Kontext[es; IG]« (Danneberg, 2007: 334) folgen. Dieser Kontext liegt den Darstellungen des studentischen Aufruhrs und des Generationenkonfliktes in den einzelnen Prosawerken zugrunde und stellt den Hintergrund ihrer Narrative dar.