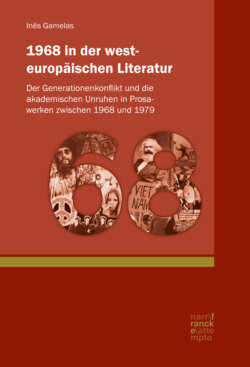Читать книгу 1968 in der westeuropäischen Literatur - Ines Gamelas - Страница 5
Einleitung
ОглавлениеDie Atmosphäre der Unruhen und der Jugendrevolte, die sich in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre verstärkte und ausbreitete, war ein beispielloses weltweites Phänomen. Junge Menschen aus zahlreichen Ländern rebellierten gegen das Establishment und führten eine Protestkultur an, die die ältere Generation auf den verschiedensten Ebenen in Frage stellte: Familie, tradierte Lebensweisen, gesellschaftliche Vorgaben, sexuelle Normen, Universität, nationale und internationale Politik, Konservatismus, Autoritarismus, alles wurde kritisiert. Der Diskurs des Widerstands internationalisierte sich dank der weltweit durch die Medien verfügbaren Informationen. Er fand in der provokativen Haltung der Jungen den Antrieb, der dazu beitrug, aus dem Jahr 1968 ein mythisches Jahr zu machen. 1968 war in der Tat ein Jahr, in dem die herrschenden Werte auf eine explosive Weise herausgefordert waren und ein Jahr eines einzigartigen Generationenkonfliktes, der historisch zum Symbol der Befreiung der Jugend wurde.1 Zuerst in den Universitäten und danach auf den Straßen der großen Städte bekundeten die jungen Menschen ihren Willen, die Gesellschaft auf der politischen Ebene zu verändern und mit dem Establishment zu brechen. Diese Spaltung wurde auch im Privatleben deutlich, wo die junge Generation sei es durch die Musik, durch die Kleidung oder sei es durch die sexuelle Befreiung alternative Verhaltensweisen auslebte. Trotz der Unterschiede zwischen den politischen Systemen und Lebenswirklichkeiten der verschiedenen Länder sowie zwischen den Protestzielen, die in jedem Land von den jungen Menschen ausgewählt wurden, um ihre Empörung zu äußern, sticht doch eine gemeinsame Widerstandshaltung der jungen Generation Westeuropas hervor.2 Diese Neigung zum Widerstand und zum Protest kennzeichnet den Generationenkonflikt jener Epoche. Aus der Sicht der jungen Menschen verkörpern die Eltern die herrschende soziale Ordnung, während die neue Generation vorgibt, der Motor des gesellschaftlichen Wandels zu sein, indem sie sich am Aufbau einer erneuerten und von dem Wertekanon der älteren Generation befreiten Welt beteiligt.
Die Literatur blieb nicht unberührt von dieser Welle der Rebellion. Es gibt eine beachtliche Anzahl von Prosawerken in verschiedenen nationalen Literaturen in Westeuropa, die den Generationenkonflikt und die Studentenrevolte in den Vordergrund rücken. In diesen Werken, die ab 1968 und im Laufe der 1970er-Jahre erscheinen, werden die individuellen und die kollektiven Erfahrungen von Jungen und nicht mehr Jungen verarbeitet, die das soziopolitische Umfeld von Krise und Aufruhr am Ende der 1960er-Jahre in allen seinen zahlreichen Facetten erleben. Der diegetische Fokus jedes einzelnen dieser Texte betont den nationalen Raum, in dem sich die mit der Revolte verbundenen Ereignisse abspielen, was aber eine Öffnung zur anderen Seite der Grenzen nicht ausschließt. Gerade weil die 1968er-Bewegung und die Protestkultur am Ende der 1960er-Jahre einen transnationalen Charakter haben, gibt es Berührungspunkte, die sich auf verschiedenen Ebenen durch diese Werke ziehen.
In der vorliegenden Arbeit unternehme ich es, die Darstellung der Jugend und die literarische Verarbeitung des Generationenkonfliktes am Ende der 1960er-Jahre in Westeuropa durch eine exemplarische Auswahl von Prosawerken, die zwischen 1968 und 1979 geschrieben und/oder publiziert wurden, zu untersuchen und zu vergleichen. In der Reihe der ausgewählten Prosatexte sind dies Werke aus der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal. Es sind fünf Räume mit einem unterschiedlichen soziopolitischen Kontext, in denen aber durchgehend die junge Generation, der die Protagonisten der verschiedenen Texte angehören, die Führungsrolle des Widerstands und des Protestes gegen den Status quo einnimmt. Das Ziel ist die Durchführung einer interdisziplinären und transnationalen Studie, die sich mit der »literarisierte[n; IG] Revolte« (Schnell, 2003: 388) in den ausgewählten Texten beschäftigt, d.h. eine Untersuchung der literarischen Darstellungen der Studentenunruhen und des Generationenbruchs sowie der soziokulturellen und politischen Spaltungen jener Epoche. Der Begriff literarisierte Revolte, der von Ralf Schnell geprägt wurde, erscheint zum ersten Mal im Band Literatur der Bundesrepublik: Autoren, Geschichte, Literaturbetrieb (1986). Schnell identifiziert eine Reihe von Texten (vor allem Romane und Erzählungen), die die politischen und soziokulturellen Ereignisse der Studentenbewegung von 1968 in der Bundesrepublik zum Thema der Literatur machen (vgl. Schnell, 2003: 388f.). In meiner Arbeit wird dieser Begriff im weiteren Sinne verwendet, da er über die Grenzen der deutschen Literatur hinausgeht und für Prosawerke aus Westeuropa gilt, die ebenfalls die Protestkultur, die Studentenrevolte und den Generationenkonflikt am Ende der 1960er-Jahre fiktionalisieren. Indem das Konzept der literarisierten Revolte erweitert wird, werden die Gemeinsamkeiten und Einzelheiten, wie auch die Unterschiede und Ähnlichkeiten der Darstellung des Generationenkonfliktes und der akademischen Unruhen in den Texten der deutschen, französischen, italienischen, spanischen und portugiesischen Literatur erforscht.
Der komparatistische Ansatz fokussiert die literarische Behandlung verschiedener Fragen, die alle Texte durchziehen. Unter diesen Fragen sind besonders relevant: die Zeichen von Bruch und Spaltung, die die Beziehung zwischen den Generationen in den 1960er-Jahren prägen; der politische Aktivismus der jungen Menschen und ihr Wille, die Gesellschaft zu verändern; das Ausleben der sexuellen Revolution; und schließlich die narrativen Optionen bei dem Aufbau der Erzählung, die eher die Fiktionalisierung der turbulenten Zeiten vor und nach 1968 oder eher die Reflexion über diese Zeiten in den Vordergrund stellen. In dieser komparatistischen Gegenüberstellung werden ebenfalls die Erzählstrategien im Hinblick auf die Erzählsituationen, den narrativen Aufbau und den Diskurs betrachtet.
Bevor ich die Auswahlkriterien des literarischen Korpus dieser Arbeit erkläre, werde ich kurz die Gründe nennen, die zum Ausschluss der in den Staaten des Warschauer Paktes veröffentlichten Texte aus dieser Zeit geführt haben. Der erste Grund liegt in meinen Kenntnissen von Fremdsprachen: Da ich die Sprachen dieser Länder nicht beherrsche, wäre es unmöglich gewesen, jene Texte – und die entsprechende Sekundärliteratur – im Original zu lesen. Der zweite Grund liegt in der politischen Lage. Unbestreitbar erlebten auch einige der Staaten des kommunistischen Lagers wie Ungarn, Polen und die Tschechoslowakei im Jahre 1968 einen sogenannten Frühling der Jugendrevolte, mit Zusammenstößen zwischen Studenten und den Ordnungskräften. Dennoch war die Lebenswirklichkeit in diesen Ländern eine andere als in der Mehrzahl der westeuropäischen Länder. Die deutlichen Unterschiede in der Geschichte, Politik und Kultur der Länder des Warschauer Paktes und Westeuropas in den Zeiten des Kalten Krieges würden eine eigene Untersuchung erfordern.
Selbst im westeuropäischen Raum gibt es große Variationen in der literarischen Verarbeitung der Studentenrevolte. Als deutlichstes Beispiel dafür sei Großbritannien genannt. Auch in die englische Literatur fanden die Studentenunruhen von 1968 Eingang, vor allem in campus novels wie Changing Places (1975) von David Lodge und The History Man (1975) von Malcom Bradbury.3 Aber der satirische Blick dieser und anderer englischer Romane auf die akademische Welt und auf die Studentenbewegung (vgl. Moseley, 2007: 110) ist weit entfernt von der vorherrschenden engagierten Orientierung der Erzählprosa Kontinentaleuropas. Aus diesem Grund wird die englische Literatur in dieser Studie nicht berücksichtigt.
Für die Auswahl jedes Werkes in das Textkorpus dieser Arbeit gab es diverse Kriterien. Das Hauptkriterium liegt in der Zentralität des Generationenkonfliktes und des von der jungen Generation angeführten akademischen und politischen Aufruhrs in der Diegese jedes Werkes. Außer diesem Kriterium sei bemerkt, dass nur zwischen 1968 und Anfang der 1970er-Jahre verfasste Werke ausgewählt wurden. Daher sind alle behandelten Werke gleich 1968, also noch im Jahr der Studentenrevolte, oder einige Jahre später geschrieben.4 Diese zeitliche Eingrenzung zielt darauf ab, einen Vergleich der Verarbeitung des Generationenkonfliktes und der Studentenrevolte zu ermöglichen, der die zeitliche Nähe des Verfassens der Texte zu den Ereignissen von 1968 mitberücksichtigt. So fiel die Wahl auf die folgenden Werke: Lenz (1973) von Peter Schneider, Heißer Sommer (1974) von Uwe Timm, Derrière la vitre (1970) [Hinter Glas] von Robert Merle, I giorni del dissenso (1968) [Die Tage des Dissenses] von Giorgio Cesarano, Condenados a vivir (1971) [Zum Leben verurteilt] von José María Gironella und Sem Tecto, entre Ruínas (1979) [Ohne Dach, zwischen Ruinen] von Augusto Abelaira.5
Gemeinsamkeiten in den Biographien oder in der literarischen Laufbahn der Autoren und ihrer Werke boten sich auch für die Analyse als interessant an, waren aber kein ausschlaggebendes Auswahlkriterium. Nachdem sie Ende der 1960er-Jahre als Studenten aktiv an der Studentenbewegung in Westdeutschland beteiligt waren, veröffentlichten Peter Schneider und Uwe Timm mit Lenz und Heißer Sommer zwei Werke, die die Studentenrevolte literarisch verarbeiten und in denen sich einige autobiographische Spuren ihrer Erlebnisse im Widerstand finden. Giorgio Cesarano und Augusto Abelaira waren am Ende der 1960er-Jahre schon ältere Autoren, beide in ihren Vierzigern und mit mehreren Veröffentlichungen. Sie verfolgten aufmerksam die Proteste der jungen Menschen in Italien, in Portugal und auch in ganz Westeuropa. Das war auch der Fall von José María Gironella, zu der Zeit schon über fünfzig, und Robert Merle mit über sechzig, zwei Schriftsteller mit einer etablierten literarischen Karriere. Trotz der Altersunterschiede ist ihnen jedoch allen gemeinsam eine mehr oder weniger sichtbare Sympathie mit den Idealen der politischen Linken (die einzige Ausnahme ist der spanische Autor) und das Interesse, die zeitgeschichtlichen Ereignisse in die Literatur zu tragen. Darüber hinaus teilen sie eine literarische Grundeinstellung, die von einem auffallenden historischen Bewusstsein und von der Verbindung der Literatur mit der Gesellschaft gekennzeichnet ist.
Wie zu bemerken ist, umfasst das Textkorpus dieser Arbeit wenigstens jeweils ein Werk der analysierten literarisch-kulturellen Räume. Der Grund für die stärkere Präsenz deutscher Werke liegt im besonders häufigen Vorkommen der literarisierten Revolte in der deutschsprachigen Literatur. Obwohl die Jugendrevolte in Europa am Ende der 1960er-Jahre (und Anfang der 1970er-Jahre) sich quer durch viele Länder zieht, hat ihre literarische Verarbeitung mehr Bedeutung im deutschen Raum, wo die Anzahl von Werken, die sich diesem Thema widmen, ungleich größer ist als in den anderen Literaturen Westeuropas. Mit Lenz und Heißer Sommer wurden zwei Werke ausgewählt, die von der Kritik als die repräsentativsten Texte der literarisierten Revolte in der Bundesrepublik angesehen werden (vgl. Cornils, 2000: 116). Außerdem ergänzen sich beide Texte auf gewisse Weise im Hinblick auf die fiktionale Darstellung der 1968er-Zeit (vgl. Götze, 1981: 379; Rinner, 2013: 36). Von den französischen Romanen, die gleich nach 1968 die diversen Facetten der Studentenbewegung und die Erfahrungen der jungen Aktivisten während des Mai 68 in Frankreich verarbeitet haben, ist Derrière la vitre der einzige, der bei der Fiktionalisierung der Revolte das universitäre Milieu betont (vgl. Combes, 1984: 148; Combes, 2008: 161; Eichelberg, 1987: 23). Für Italien fiel die Wahl auf I giorni del dissenso von Giorgio Cesarano, eines der wenigen Beispiele der italienischen Literatur, das die Universitätsrevolte von 1968 in Mailand herausstellt. In Spanien und in Portugal sind Condenados a vivir und Sem Tecto, entre Ruínas Einzelfälle von Werken, die noch in den 1970er-Jahren die Atmosphäre des Widerstands der jungen Generation in die Literatur einfließen lassen. Sie stellen nicht die Proteste und die Stimmung des Aufruhrs in den Universitäten in den Mittelpunkt, sondern eher den Generationenkonflikt und die unterschiedlichen Weltsichten von Eltern und Kindern in der spanischen und portugiesischen Gesellschaft der 1960er-Jahre.
Bis heute wurde noch keine vergleichende Studie zur literarischen Bearbeitung der Studentenunruhen und der Generationenkonflikte in den 1960er-Jahren in Westeuropa durchgeführt, die mehrere Werke aus verschiedenen nationalen Literaturen betrachtet. Auch sonst gibt es nur wenige literaturwissenschaftliche Studien zu diesem Thema.6 Darüber hinaus beziehen sich die wenigen diesbezüglichen Veröffentlichungen auf einen einzelnen literarischen Raum und beschränken sich in der Regel auf die Analyse eines einzigen Werkes. Im Folgenden wird die wichtigste Sekundärliteratur vorgestellt, die sich mit den in dieser Arbeit untersuchten Prosawerken befasst.
Die meisten Studien über Werke und Autoren der 1968er-Jugendrevolte sind bislang in Deutschland erschienen. Die Aufmerksamkeit der Germanistik begann in den 1970er-Jahren, kurz nach dem Erscheinen von Klassenliebe (1973) von Karin Struck, Lenz (1973) und Heißer Sommer (1974), Werken, die im Laufe der Jahren emblematisch werden (vgl. Schnell, 1986: 284f.).7 In den zwei darauffolgenden Jahrzehnten gibt es mit der Ausnahme von Ralf Schnell – der in einem kurzen Unterkapitel in seinen Literaturgeschichten nach 1945 über die literarisierte Revolte schrieb; vgl. Die Literatur der Bundesrepublik: Autoren, Geschichte, Literaturbetrieb (1986): 284–288 und Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945 (1993): 420–4248 – nur wenige Untersuchungen über den Widerhall der Studentenrevolte in der bundesdeutschen Literatur. Dennoch gibt es fünf umfassende Studien, die Werke verschiedener deutscher Autoren vergleichend analysieren.9 Die erste, von Keith Bullivant verfasst und betitelt Realism Today. Aspects of the Contemporary West German Novel (1987), befasst sich mit Texten, die die Erfahrungen der jungen Menschen während der Unruhen am Ende der 1960er-Jahre im Rahmen der »Neuen Subjektivität« oder »Neuen Innerlichkeit« in den Vordergrund rücken. Die zweite ist die Dissertation des polnischen Germanisten Andrezej Talarczyk, der 1988 an der Universität Stettin mit der Arbeit Die Studentenbewegung als Thema der Literatur der BRD promovierte.10 Eine weitere Studie, Der poetische Mensch im Schatten der Utopie: Zur politisch-weltanschaulichen Idee der 68’er Studentenbewegung und deren Auswirkung auf die Literatur (1990) von Alois Prinz, beschäftigt sich mit der Frage der Utopie, die sich durch die Prosawerke über die Studentenbewegung von Peter Schneider und Uwe Timm sowie durch Nicolas Borns Die erdabgewandte Seite der Geschichte (1976) zieht. In Politisierung der Literatur – Ästhetisierung der Politik (1992) konzentriert sich Martin Hubert auf Heißer Sommer, Lenz und Die Reise (1977) von Bernward Vesper. Zwei Jahre später wird das Buch Abschied von der Revolte: Studien zur deutschsprachigen Literatur der siebziger Jahre (1994) veröffentlicht. Ingeborg Gerlach analysiert darin Texte von Autoren wie Karin Struck, Peter Schneider, Uwe Timm und Peter-Paul Zahl (unter anderen) und ordnet sie der »Neuen Subjektivität« zu.
Abgesehen von diesen Studien ist das Interesse der Germanisten an der literarisierten Revolte bis zum Ende der 1990er-Jahre gering ausgeprägt. Erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts nimmt es wieder zu.11 Ingo Cornils ist einer der Forscher, die sich dieser Thematik am intensivsten gewidmet haben. Von besonderer Bedeutung sind ›(Un-)erfüllte Wirklichkeit‹. Neue Studien zu Uwe Timms Werk (2006) – eine zusammen mit Frank Finlay herausgegebene Sammlung, die sich ausschließlich mit dem Werk von Uwe Timm befasst – und Writing the Revolution: The Construction of ‹1968› in Germany (2016).12 Susanne Rinner ist eine weitere wichtige Forscherin. In ihrem Aufsatz »From Student Movement to the Generation of 1968: Generational Conflicts in German Novels from the 1970s and the 1990s« (2010) analysiert sie die deutsche Studentenrevolte der 1960er-Jahre in Lenz und Heißer Sommer und untersucht sie diese vergleichend mit späteren Werken der beiden Autoren. Diese komparatistische Gegenüberstellung wird in der Studie The German Student Movement and the Literary Imagination: Transnational Memories of Protest and Dissent (2013) wieder aufgenommen und erstreckt sich mithilfe eines literatur- und kulturwissenschaftlichen Ansatzes auf Texte von Peter Schneider, Uwe Timm, Bernhard Schlink, Ulrike Kolb, Irmtraud Morgner und Emine Sevgi Özdamar.13
Dazu gibt es umfassende Veröffentlichungen über einzelne deutsche Autoren der 1968er-Generation (vgl. Rinner, 2010: 139). Besonders Peter Schneider und Uwe Timm, die wichtigsten Vertreter dieser Autorengeneration (vgl. ebd.: 141), haben die Aufmerksamkeit der Literaturwissenschaftler auf sich gezogen. Hervorzuheben sind Peter Schneiders Erzählung ›Lenz‹: Zur Entstehung eines Kultbuches. Eine Fallstudie (1997) – eine umfassende Analyse der Erzählung Lenz von Markus Meik –, Zwischen Dableiben und Verschwinden: Zur Kontinuität im Werk von Peter Schneider (2006) von Petra Platen und drei Studien über das Gesamtwerk von Uwe Timm zur Studentenbewegung: Die 68er-Revolte im Werk von Uwe Timm (2009) von Sabine Weisz, (Ent-)Mythologisierung deutscher Geschichte: Uwe Timms narrative Ästhetik (2012) von Kerstin Germer und ›Erinnern führt ins Innere‹: Erinnerung und Identität bei Uwe Timm (2015) von Simone Christina Nicklas. Obwohl keine dieser Studien sich ausschließlich auf die Darstellung des Generationenkonfliktes und des akademischen Aufruhrs konzentriert, wie es in dieser Arbeit geschehen soll, dienen sie als Analysehilfe bei meiner Untersuchung von Lenz und Heißer Sommer.
Was den literarischen und kulturellen Raum Frankreichs betrifft, ist die Zahl der Publikationen deutlich geringer und konzentriert sich fast ausschließlich auf die literarische Verarbeitung der Ereignisse vom Mai 68. Patrick Combes war der erste, der eine umfassendere Studie über die Fiktionalisierung der 1968er-Revolte in der französischen Literatur veröffentlichte: Littérature & le mouvement de Mai 68. Écriture, mythes, critique, écrivains 1968–1981 (1984), in der er ungefähr fünfzig Werke (vor allem Romane) über den Mai 68 und die Erfahrungen bei den Jugendprotesten am Ende der 1960er-Jahre identifiziert. Sowohl in dieser als auch in einer weiteren Studie, 2008 veröffentlicht und betitelt Mai 68, les écrivains, la littérature, hebt Combes den Roman Derrière la vitre von Robert Merle hervor. Auch Ingrid Eichelberg, eine deutsche Romanistin, beschäftigte sich in den 1980er-Jahren mit der französischen Studentenrevolte und den Ereignissen vom Mai 68 in der Literatur und veröffentlichte drei Studien dazu: Mai ’68 in der Literatur. Die Suche nach menschlichem Glück in einer besseren Gesellschaft (1987),14 Mai 1968: une crise de la civilisation française; anthologie critique de documents politiques et littéraires (1986) und L’écriture de Mai 68 (1987), die zwei letzten auf Französisch geschrieben zusammen mit Wolfgang Drost. Margaret Attack beschäftigte sich in May 68 in French Fiction and Film: Rethinking Society, Rethinking Representation (1999) auch mit dem Roman von Robert Merle, den sie damals für den berühmtesten über den Mai 68 hielt (vgl. Attack, 1999: 33). Die Lektüre dieser Studien bestärkte meine Entscheidung für Derrière la vitre, einen Roman, der erst in den letzten Jahren eine größere Aufmerksamkeit der Forschung erlangte.15
In Italien gibt es wenige Publikationen über italienische Autoren, die den Aufruhr von 1968 und die Protestkultur der jungen Menschen in Literatur verwandelten, und noch weniger sind die, die das Werk Giorgio Cesaranos erwähnen, eines wenig bekannten Schriftstellers. Unter denen, die sich dem literarischen Schaffen zu 1968 in Italien widmen und die I giorni del dissenso unter den Werken der 1960er- und 1970er-Jahre hervorheben, die sich mit der Studentenbewegung und dem akademischen Aufruhr beschäftigen, gehören besonders: Linea rossa: Intellettuali, letteratura e lotta di classe, 1965–1975 (1982) und der Sammelband Cercando il ’68. Documenti, cronache, analisi, memorie (2012), beide von Giampaolo Borghello, Letteratura italiana d’oggi, 1965–1985 (1987) von Giuliano Manacorda und der Aufsatz »Il percorso letterario di Giorgio Cesarano« (2011) von Giorgio Luzzi.
Ähnlich ist es mit der Forschung zum Werk von José María Gironella in Spanien, besonders zum Roman Condenados a vivir. Die einzige Ausnahme scheint die Doktorarbeit von Pedro Fernandez-Blanco mit dem Titel José María Gironella, romancier témoin de son époque (1985) zu sein, in der er die Figuren und die Themen in jedem einzelnen Roman des umfangreichen Gesamtwerkes von Gironella analysiert. In der vorliegenden Arbeit werde ich diese Studien gelegentlich erwähnen und heranziehen und zugleich versuchen, nicht nur neue Wege der Forschung zu den Werken Cesaranos und Gironellas zu eröffnen, sondern auch die Relevanz dieser zwei Autoren für die literarische Behandlung der Studentenunruhen und des Generationenkonfliktes in Italien und Spanien hervorzuheben.
Was die Analyse des Romans von Abelaira betrifft, ist die Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe, identisch. Von den wenigen vorhandenen Studien über Sem Tecto, entre Ruínas wird deutlich, dass sie den Roman nur aus der Sicht der Elterngeneration untersuchen und die junge Generation und ihren Willen nach Veränderung nicht beachten. Publikationen wie »Augusto Abelaira: a Palha e o Resto« (1986), Um Romance de Impoder. A Paragem da História na Ficção Portuguesa Contemporânea (1994) – beide von Luís Mourão –, Entre a Utopia e o Apocalipse: Augusto Abelaira e o Fim da História (2003) von Carlos Machado sowie Imagens Líquidas na Obra de Augusto Abelaira: Sujeito e História na Pós-Modernidade (2007) und »De Brandão a Abelaira: um tempo de desesperança« (2008) von Edimara Luciana Sartori untersuchen vor allem die Darstellungen von Machtlosigkeit, Trägheit und Verzweiflung, die sich in Sem Tecto, entre Ruínas im Zusammenhang mit der älteren Generation finden lassen.
Nach diesem ersten Forschungsüberblick sollen die in dieser Arbeit angewandten theoretischen und methodologischen Prämissen vorgestellt werden. Da der Fokus der Analyse sich auf die Fiktionalisierung des Generationenkonfliktes und der soziopolitischen Unruhen von 1968 konzentriert, stützt sich meine Studie der ausgewählten Prosawerke auf einen vergleichenden kulturwissenschaftlichen Ansatz.
Die gegenwärtige Methodologie zur Untersuchung literarischer Werke mithilfe eines kulturwissenschaftlichen Ansatzes beruht auf dem Konzept der Interdisziplinarität. Die kulturwissenschaftliche Neuorientierung der Literaturwissenschaft wird von immer mehr Forschern der Anglistik, Germanistik und Romanistik umgesetzt – besonders im Bereich der Untersuchungen, die einen vergleichenden Zweck haben (vgl. Nünning/Sommer, 2004: 9) – mit dem Ziel, den sprachenübergreifenden und interdisziplinären Dialog zu verstärken.16 Im Sammelband Kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft (2004) stellen Ansgar Nünning und Roy Sommer fest, dass eine kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft nicht nur ihre Berechtigung hat, sondern auch von großer Bedeutung in der Gegenwart ist, indem sie erlaubt, das Wertesystem, die Normen und Perspektiven sowie die Kollektivvorstellungen zu untersuchen, die sich in literarischen Texten zeigen (vgl. ebd.: 19).17 Die kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft bedeutet keineswegs, die in der Literatur- und in der Kulturwissenschaft vorhandenen Analyseparadigmen außer Acht zu lassen. Im Gegenteil: Was Ansgar Nünning und Roy Sommer als »einen neuen Diskurs« (ebd.: 10) der Annäherung von Literatur- und Kulturwissenschaft bezeichnen, das berücksichtigt die Besonderheiten beider Disziplinen. Auf diese Weise werden die in dieser Arbeit analysierten Werke in ihrer Qualität als kulturelle Dokumente und als literarische Texte verstanden. Es wird angestrebt, auf ihre Singularität zu achten, die unbestreitbar durch die Fiktionalität und durch einen einzigartigen semiotischen Charakter geprägt ist.
Im Rahmen dieser theoretischen und methodologischen Ausrichtung muss der Beitrag von Doris Bachmann-Medick erwähnt werden, die die »Hybridisierung« bei der Analyse literarischer Texte verteidigt (vgl. Bachmann-Medick, 2004: 156) und die sich dabei Analyseinstrumente anderer Disziplinen der Sozial- und Geisteswissenschaften bedient.18 Dennoch soll diese »Hybridisierung« die Vorgehensweise jeder einzelnen Disziplin nicht in Frage stellen. Für den konkreten Fall der Literaturwissenschaft bemerkt die Autorin, dass nur eine kulturwissenschaftliche Sichtweise, die die Eigenart des jeweiligen literarischen Textes berücksichtigt, dazu beitragen könne, die Verbindungen zwischen kultureller Bedeutung und Textualität zu erkennen, nämlich das, was die Fiktionalisierung, die wirkungsästhetischen Strategien und die stilistischen und formalen Innovationen betrifft (vgl. ebd.).19
Mein Interesse für die kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft wird durch die in den Prosawerken dieser Arbeit vorliegende Verbindung zwischen literarischem und politisch-soziokulturellem Diskurs gerechtfertigt: Die Zeitgeschichte ist mit der Fiktion verwoben und die Ereignisse der Epoche spielen eine herausragende Rolle in der Entwicklung, dem Verhalten und der Mentalität der unterschiedlichen Figuren der einzelnen Werke. In ihrer Interpretation von »Kultur als Text« verteidigt Doris Bachmann-Medick, dass die literatur- und kulturwissenschaftliche Hermeneutik der Gegenwart nicht von den sozialen Ereignissen und von den Handlungszusammenhängen, die zu einer gewissen wahrgenommenen Realität gehören, getrennt werden darf (vgl. Bachmann-Medick, 2014: 77). Auch im Sammelband Methoden der literatur- und kulturwissenschaftlichen Textanalyse (2010), herausgegeben von Vera und Ansgar Nünning, wird erwähnt, dass die kulturelle Dimension eines literarischen Textes (beziehungsweise der kulturelle Kontext, der soziale Hintergrund und die soziokulturelle Umgebung) bei der literarischen Analyse durch ein Verfahren des wide reading berücksichtigt werden muss (vgl. Hallet, 2010: 293f.). Dieses Verfahren, das eine ausgedehnte komplementäre Lektüre ermöglicht, auch durch den Zugang zu nicht-literarischen Texten, ist besonders wichtig bei der Analyse literarischer Texte mit einer starken zeitgeschichtlichen und soziokulturellen Komponente, wie es bei den Prosawerken dieser Arbeit der Fall ist. Indem ich den Schwerpunkt meiner Studie auf die Darstellungen der Jugend und auf die literarische Bearbeitung des soziopolitischen Aufruhrs der Jugendrevolte lege, beabsichtige ich, zu untersuchen, auf welche Weise jedes der ausgewählten Werke nicht nur dazu beiträgt, das kulturelle Gedächtnis der zeitgeschichtlichen, politischen und sozialen Ereignisse von 1968 herauszukristallisieren, sondern auch ein originelles Bild des Generationenkonfliktes und der Studentenunruhen am Ende der 1960er-Jahre zu schaffen: originell, denn es ist nicht in den Zwängen der geschichtswissenschaftlichen und soziologischen Perspektive gefangen, sondern geht vom kritischen und persönlichen Blick eines jeden Autors aus, der die der Literatur eigene kreative Freiheit dazu benutzt, Wirklichkeiten zu konstruieren, die sich nicht darauf beschränken, die reale Welt, von der sie erzählen, widerzuspiegeln.20
Ausgehend von dem Bild, das jedes einzelne Werk vom Generationenkonflikt und der Studentenrevolte bietet, liegt das Ziel meiner Studie auf der Darstellung eines heterogenen und vielfältigen Porträts der Berührungspunkte und Divergenzen, die bei der Fiktionalisierung der Erlebnisse der Jungen und nicht mehr Jungen im Laufe der 1960er-Jahre vorkommen. Auf diese Weise, und dem komparativen Charakter der vorliegenden Studie entsprechend, wird den jüngsten Tendenzen und methodologischen Ansätzen im Rahmen der Vergleichenden Literaturwissenschaft spezielle Aufmerksamkeit gewidmet. Diese Disziplin, so Steven Tötösy de Zepetnek, steht in der Tradition der Förderung interdisziplinärer und interkultureller Studien von Literatur und Kultur (vgl. Tötösy de Zepetnek, 2003: 235).
Die Forscher César Domínguez, Haun Saussy und Darío Villanueva unterstreichen in Introducing Comparative Literature. New Trends and Applications (2015), dass die Vergleichende Literaturwissenschaft am Ende des 20. Jahrhunderts in ein »neues Paradigma« eintrat, das eine eher kulturwissenschaftliche Interpretation der Literatur voraussetzt (vgl. Domínguez/Saussy/Villanueva, 2015: 13).21 Diese Interpretation soll nicht nur auf den literarischen Text als solchen, sondern auch auf den Kontext seiner Entstehung, seine Rezeption und auch auf soziale Faktoren achten, deren Analyse auch über nationale Grenzen hinausgehen sollte (vgl. ebd.). Darüber hinaus heben diese Forscher hervor, dass es noch eine andere Dimension gibt, die im Rahmen des »neuen Paradigmas« berücksichtigt werden muss: »It consists, basically, in the imperative of abandoning of any supposed genetic relation to justify comparative analysis, and attending to the empirical evidence that is available to us« (ebd.: 15). Wie sie verdeutlichen, bezieht sich diese »empirische Evidenz« auf ein gemeinsames Element zwischen zwei literarischen Systemen oder zwischen einem literarischen Werk und einem Werk aus einem anderen künstlerischen Bereich, ohne dass eine Abhängigkeit zwischen zwei oder mehr Werken unterstellt wird (vgl. ebd.). Diese Perspektive der Vergleichenden Literaturwissenschaft ist besonders hilfreich in der vergleichenden Gegenüberstellung von Darstellungen, Themen oder Stoffen, die diversen literarischen Texten gemeinsam sind, unabhängig von ihrer Gattung (vgl. Nebrig, 2012: 91–96).
In diesem Rahmen hat diese Arbeit das Ziel, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Texten verschiedener Literaturen zu untersuchen, die sich mit dem Generationenkonflikt, den akademischen Unruhen und der Studentenrevolte der 1960er-Jahre befassen und diese bearbeiten. Konkret wird dabei dem methodologischen Vorschlag von Peter Zima gefolgt, der ein Analysemodell der intertextuellen Beziehungen vorstellt, welches auf eine Differenzierung zwischen »typologischem Vergleich« und »genetischem Vergleich« beruht.22 So wie Zima erklärt (der Ausführung von Gerhard R. Kaiser folgend): »Während der genetische Vergleich als Kontaktstudie […] Ähnlichkeiten zum Gegenstand hat, die durch Kontakt, d.h. durch direkte oder indirekte Beeinflussung entstehen, werden im Rahmen eines typologischen Vergleichs Ähnlichkeiten untersucht, die ohne Kontakt aufgrund von analogen Produktions- oder Rezeptionsbedingungen zustande kommen« (Zima, 2011: 105; Hervorhebung im Original). In der vorliegenden Arbeit sind die Beziehungen zwischen den Texten typologischer Natur und der Vergleich wird in diesem Rahmen stattfinden.
Nach der Vorstellung der methodologischen Koordinaten sollen nun die Struktur und die Gliederung dieser Arbeit verdeutlicht werden.
Im ersten Kapitel werden die Studentenrevolte und der Aufruhr der jungen Generation von 1968 sowie die Vorgeschichte und die Nachwirkungen der Folgejahre dargestellt. Damit werden die wichtigsten Momente und Ereignisse in Westeuropa zunächst im Allgemeinen und dann spezifisch in jenen Ländern identifiziert, in denen die untersuchten literarischen Werke entstanden sind. Diese geschichtliche und soziokulturelle Kontextualisierung der außerliterarischen Wirklichkeit folgt den Prinzipien des wide reading. Da die zeitgeschichtlichen Ereignisse dieser Epoche mit der Diegese eines jeden Werkes verwoben sind und eine hervorgehobene Rolle in der Entwicklung, dem Verhalten und dem Charakter der unterschiedlichen Figuren spielen, ist diese Kontextualisierung essentiell.
Danach folgt die Einführung in jedes einzelne Werk. Nach der kurzen geschichtlichen und literarischen Einordnung der ausgewählten Texte liegt der Fokus auf den Erzählstrategien sowie auf Aspekten wie der Verknüpfung der Fiktion mit der Zeitgeschichte und den Wahrnehmungen der akademischen Unruhen und der Revolte gegen das Establishment auf öffentlicher und privater Ebene. Diese Einführung der unterschiedlichen Texte dient dazu, das Hauptkapitel dieser Arbeit vorzubereiten, d.h. das dritte Kapitel, das dem Vergleich der Darstellungen des Generationenkonfliktes und des akademischen, politischen und soziokulturellen Aufstands gewidmet ist.
Im dritten Kapitel erfolgt eine systematische Gegenüberstellung der ausgewählten Werke, wobei relevante Fragen, die alle Texte durchziehen, hervorgehoben werden (siehe S. 15). Zunächst werden die Profile der Generation der Eltern und der Kinder verglichen und dabei die Differenzierungen des Generationenkonfliktes analysiert. Die beiden folgenden Unterkapitel leiten über zum Vergleich der Darstellungen der Jugend, indem zwei grundlegende Fragen untersucht werden: die Frage des politischen Aktivismus der jungen Generation und die der sexuellen Befreiung und der Revolution der Sitten in den 1960er-Jahren. Im vierten und letzten Unterkapitel wird versucht, die Strategien bei dem Aufbau der Erzählung einander vergleichend gegenüberzustellen, besonders was die Aktion – meistens mit den Studentenunruhen und dem Bruch der jungen Menschen mit dem Establishment verbunden – oder was die Reflexion über die Zeit des Wandels betrifft. Die Erforschung all dieser Fragen mittels einer vergleichenden kulturwissenschaftlichen Lektüre dient der Untersuchung der Berührungspunkte und der Divergenzen in den verschiedenen literarischen Bearbeitungen der Atmosphäre von Bruch und Spaltung am Ende der 1960er-Jahre.
Dadurch dass die vorliegende Arbeit fünf literarische Räume untersucht, wird die Erforschung der interliterarischen und interkulturellen Beziehungen der literarisierten Revolte in einem größeren internationalen Maßstab weiter vorangetrieben. Ich hoffe, dass diese transnationale Perspektivierung neue Sichtweisen für eine vergleichende Lektüre von Schlüsseltexten der deutschen, französischen, italienischen, spanischen und portugiesischen Literatur eröffnet, die durch den Generationenkonflikt und die akademischen, politischen und soziokulturellen Unruhen in Westeuropa am Ende der 1960er-Jahre verbunden sind.