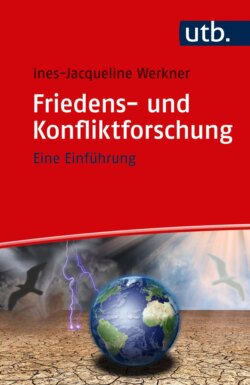Читать книгу Friedens- und Konfliktforschung - Ines-Jacqueline Werkner - Страница 15
2.3 Fazit
ОглавлениеBei Frieden und Sicherheit handelt es sich – das haben die obigen Ausführungen aufzeigen können – um durchaus differente Begriffe. Insbesondere verweisen sie auf unterschiedlich eingenommene Perspektiven. Dabei lässt sich die Debatte um eine Friedens- und Sicherheitslogik auf einen zentralen Punkt bringen:
„[D]ie Sicherheitslogik mit ihrer auf Abgrenzung zielenden Orientierung befördert Sicherheit gegen einen anderen, die Friedenslogik weist dem Gegenüber dagegen eine zentrale Rolle als mitverantwortlichem Partner für die Qualität der Beziehung zu“ (Nielebock 2016, S.10).
Was folgt nun aber aus dieser begrifflichen Differenz von Frieden und Sicherheit? Hanne-Margret Birckenbach (2012, S.42; Hervorh. d. Verf.) spricht von einer „Friedenslogik statt Sicherheitslogik“ und räumt damit dem Frieden den sachlichen Vorrang ein. Und auch für Sabine Jaberg (2017a, S.43) „gebührt aus ethischer Perspektive dem Frieden der Vorzug“. Beide Friedensforscherinnen setzen auf einen Perspektivenwechsel und die konsequente Einlösung einer Friedenspolitik. Dagegen plädieren Christopher Daase und Bernhard Moltmann (1991, S.35) für ein „integriertes Verständnis von Friedens- und Sicherheitspolitik“:
„Auch wenn dem Frieden der sachliche Vorrang einzuräumen ist, muß die Sicherheitspolitik auf ihrem temporären Vorrang bestehen, denn Friedenspolitik ohne den realistischen Blick auf die internationale Lage wird am nationalen und innergesellschaftlichen Sicherheitsbedürfnis scheitern. Sicherheitspolitik aber ohne das Korrektiv des Friedens ist nicht friedensfähig.“
Beide Auffassungen müssen nicht in Widerspruch zueinander treten, lässt sich ein integratives Verständnis von Frieden und Sicherheit durch eine Konvergenz beider Begriffe erreichen (vgl. Jaberg 2017a, S.47ff.), auch wenn diese nicht völlig zur Deckung gebracht werden können. Konzepte wie beispielsweise die auf die Palme-Kommission von 1982 zurückgehende Gemeinsame Sicherheit verweisen – und das zeigt sich bereits am Begriff der Gemeinsamen Sicherheit selbst – auf Möglichkeiten einer friedensfähigen Sicherheitspolitik. Ein solches Konzept ist voraussetzungsreich und zielt, verbunden mit der Annahme, dass Sicherheit nicht voreinander, nur miteinander zu suchen ist, auf eine konsequente Abkehr jeglicher Abschreckungspolitik (vgl. Kapitel 11.4; auch Werkner 2019a).
Weiterführende Literatur:
Gießmann, Hans J. 2011. Frieden und Sicherheit. In Handbuch Frieden, hrsg. von Hans J. Gießmann und Bernhard Rinke, 541-556. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Dieser Beitrag gibt einen guten Überblick über die begrifflichen Parallelen und Divergenzen der beiden Begriffe Frieden und Sicherheit.
Jaberg, Sabine. 2017. Frieden und Sicherheit. In Handbuch Friedensethik, hrsg. von Ines-Jacqueline Werkner und Klaus Ebeling, 43-53. Wiesbaden: Springer VS. Ausgehend von der Definition von Frieden und Sicherheit verhandelt die Autorin beide Begriffe als differente Kategorien und diskutiert Möglichkeiten einer kategorialen Konvergenz.
Nielebock, Thomas. 2016. Frieden und Sicherheit – Ziele und Mittel der Politikgestaltung. Deutschland & Europa: Zeitschrift für Gemeinschaftskunde, Geschichte und Wirtschaft (71): 6-17. Hierbei handelt es sich um einen gut zugänglichen Beitrag zur friedenswissenschaftlichen Debatte beider Begriffe.