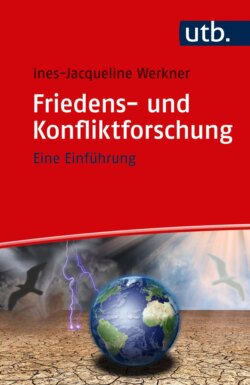Читать книгу Friedens- und Konfliktforschung - Ines-Jacqueline Werkner - Страница 20
3.4 Fazit
ОглавлениеNormativität, Praxisorientierung und Inter- beziehungsweise Transdisziplinarität – diese Merkmale prägten von Beginn an die Friedensforschung. In der Literatur werden sie häufig sogar als konstitutiv angesehen. Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Systemwandel in Europa ist – das haben die obigen Ausführungen aufzeigen können – ein Wandel im Selbstverständnis der Friedensforschung unverkennbar. Dieser führt aber nicht zwangsweise zu einer Aufgabe der genannten Ansprüche. So fordert der zu verzeichnende Trend von einer „Forschung für den Frieden“ zu einer „Forschung über den Frieden“ sicherlich eine stärkere empirische Unterfütterung ein, er negiert aber nicht per se das normative Selbstverständnis der Friedensforschung. Bereits jede Forschungsfrage stellt eine normative Setzung dar. So mag beispielsweise die Frage nach der Effektivität von targeting killing als Forschungsthema unter die Freiheit der Forschung nach Artikel 5 des Grundgesetzes fallen und sich in den Internationalen Beziehungen als relevant erweisen, in der Friedensforschung aber auf normative Vorbehalte stoßen. Im Vergleich zu Hochzeiten der kritischen Friedensforschung, deren normative Aussagen sich am weiten Friedensbegriff orientierten, wird seit den 1990er Jahren verstärkt ein enger (substanzieller) Friedensbegriff vertreten (vgl. Kapitel I in diesem Lehrbuch). Normative Aussagen bestehen weiterhin, verweisen aber auf einen anderen Bezugspunkt.
Vor diesem Hintergrund erweisen sich für Friedensforscher und -forscherinnen zwei Aspekte als dringlich: Erforderlich ist erstens ein fortwährendes Austarieren: Darauf verweisen nicht nur Debatten über die Zivilklausel. Auch stellt die Praxisorientierung für Friedensforscher und -forscherinnen eine stete Gratwanderung dar: Zum einen verfolgen sie den Anspruch, mit ihren Handlungsempfehlungen gehört zu werden; zugleich gehen sie die Gefahr ein, von politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren für ihre Ziele im Sinne eines „Flankenschutzes“ missbraucht zu werden. Benötigt wird hier eine immer neu zu justierende Balance von Nähe und Distanz.
Zweitens bedarf es der Transparenz: sowohl im Hinblick auf das eigene Selbstverständnis als auch in Bezug auf die Vorgehensweise. Unerlässlich ist bei Letzterem auch ein ehrlicher Ausweis verfolgter mono-, inter- beziehungsweise transdisziplinärer Ansätze und ihrer Schwierigkeiten, auch einer sich in diesem Kontext abzeichnenden Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Denn auch wenn Inter- und Transdisziplinarität oft gefordert wird, wird sie nur selten betrieben. Dieser Sachverhalt ist zumindest offenzulegen.
Weiterführende Literatur:
Bonacker, Thorsten. 2011. Forschung für oder Forschung über den Frieden? Zum Selbstverständnis der Friedens- und Konfliktforschung. In Friedens- und Konfliktforschung, hrsg. von Peter Schlotter und Simone Wisotzki, 46-77. Baden-Baden: Nomos. Mit dieser im Beitrag diskutierten Frage markiert der Autor einen wichtigen Wendepunkt im Selbstverständnis der Friedensforschung.
Jaberg, Sabine. 2009. Vom Unbehagen am Normverlust zum Unbehagen mit der Norm? Zu einem fundamentalen Problem der neueren Friedensforschung. Hamburger Beiträge zur Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Heft 152. Hamburg: IFSH. Dieser Text setzt sich in Reflexion zweier historischer Debatten – der Tyrannei der Werte und dem Werturteilsstreit – kritisch mit den Argumenten der Skeptikerinnen und Skeptiker einer normativen Wissenschaft auseinander und plädiert für die Beibehaltung einer wert- und normbasierten Friedensforschung.
Zeitschrift für Internationale Beziehungen 19 (1). Die Zeitschrift veröffentlicht in diesem Heft die Beiträge des von ihr im Oktober 2011 organisierten Symposiums zum Verhältnis zwischen den Internationalen Beziehungen und der Friedens- und Konfliktforschung. Hier finden sich die zum Teil konträren Positionen unter anderem von Michael Brzoska, Tanja Brühl, Harald Müller und Klaus Schlichte.