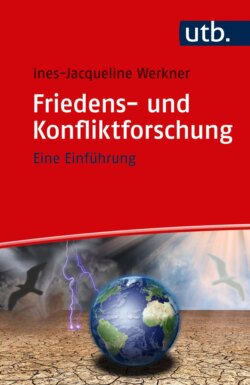Читать книгу Friedens- und Konfliktforschung - Ines-Jacqueline Werkner - Страница 8
1.2 Frieden – mehr als die Abwesenheit von Krieg?
ОглавлениеGaltungs Unterscheidung zwischen direkter und struktureller Gewalt sowie negativem und positivem Frieden prägt bis heute maßgeblich den friedenswissenschaftlichen Diskurs.1 Dabei bewegen sich die Debatten – nunmehr seit mehr als 40 Jahren – stets um die eine, aber für die Friedensforschung doch zentrale Frage, wie eng beziehungsweise weit der Friedensbegriff gefasst werden sollte. Einerseits lässt sich in der Friedensforschung „ein verbreitetes Unbehagen an einem ‚bloß‘ auf die Negation des Krieges bezogenen Friedensbegriff“ (Brock 2002, S.96) feststellen. Dieses Unbehagen resultiert aus der Zeit der Ost-West-Konfrontation, in der Krieg durch nukleare Abschreckung vermieden werden sollte – ein Zustand „organisierter Friedlosigkeit“ (Senghaas 1972), ohne Krieg, jedoch stets kurz vor der Katastrophe und der Zerstörung des gesamten europäischen Kontinents. Genau diese Situation hatte Johan Galtung bei seiner Konzeption des erweiterten Gewalt- und Friedensbegriffs im Blick. So blende der negative Friedensbegriff die herrschaftlichen, sozialen und kulturellen Dimensionen des Friedens aus; mehr noch, er trage mit dazu bei, ungerechte Verhältnisse auf der Suche nach Frieden zu zementieren.
Andererseits mehren sich aber auch die kritischen Stimmen gegenüber dem positiven Friedensbegriff. Dazu gehören vor allem Frankfurter Friedensforscher wie Lothar Brock (1990, 2002), Ernst-Otto Czempiel (1998, 2002), Christopher Daase (1996) oder Harald Müller (2003). Ihre Kritik gliedert sich in verschiedene Argumentationsstränge: forschungspraktische, ethische sowie empirische. Forschungspraktisch wird gegen den positiven Friedensbegriff seine Weite und Unbestimmtheit in Anschlag gebracht. Unklar bleibe, was konkret der Gegenstand des Friedens sei und wo die Abgrenzungen der Friedensproblematik gegenüber anderen gesellschaftlichen Großthemen liegen. Ein Friedensbegriff, der von der Verhinderung und Eindämmung des Krieges über die Schaffung sozialer Gerechtigkeit bis hin zum Umweltschutz alles umfasse, verliere die Fähigkeit „zur unterscheidenden Beschreibung“ (Müller 2003, S.211). „Friedensforschung bzw. die Theoriebildung über Frieden wäre für alles und das heißt im Umkehrschluss für nichts zuständig“ (Brock 1990, S.78). In diesem Kontext fordern die Frankfurter eine Trennung von Friedensbegriff und Friedensursachen.
Aus ethischer Sicht wird befürchtet, dass der positive Frieden zur Legitimation von Gewalt missbraucht werden könne. Werde Gerechtigkeit als wesentliches Moment des positiven Friedens in den Friedensbegriff hineingenommen, stoße man – so Harald Müller (2003, S.212) – auf zwei Probleme: Erstens könnten Gewaltfreiheit und Gerechtigkeit in Widerspruch zueinander treten. Gewalt könne zur (Wieder-)Herstellung von Gerechtigkeit in Anspruch genommen werden.2 Zweitens gebe es verschiedene Gerechtigkeitsvorstellungen, die den positiven Friedensbegriff unbrauchbar machen, abgesehen davon, dass diese auch zu einer neuen Quelle von Gewalt führen können.3 In diesem Sinne argumentiert auch Ernst-Otto Czempiel (1995, S.167): „Da die Gerechtigkeit partikular und fraktioniert ist, ist es auch der Friedensbegriff.“ Frieden sei dann nicht das Werk der Gerechtigkeit, sondern des Gewaltverzichts. Ferner ergebe sich ein ethisches Problem aus der unzulänglichen Differenzierung direkter und struktureller Gewalt, denn während Tod und Verstümmlung irreversible Zustände sind, haben Ausbeutung und Repression zumindest hypothetisch die Chance ihrer Reversibilität (Müller 2003, S.212f.).
Schließlich sei der positive Friedensbegriff mit seiner Intention aus der Zeit der Ost-West-Konfrontation empirisch überholt. Angesichts der gegenwärtigen weltpolitischen Lage sei der negative Frieden – die Eindämmung, Beendigung und Verhinderung von Kriegen – wichtiger denn je, während der positive Frieden in dieser Situation fast schon anachronistisch erscheine (Bonacker und Imbusch 2006, S.132). Auch werde mit dem Begriff des negativen Friedens eine qualitative Abwertung insinuiert, die sich empirisch in keiner Weise rechtfertigen lasse. So sei bereits die Abwesenheit kollektiver Gewaltanwendung ein hohes Gut und in ihrer Bedeutung gar nicht zu überschätzen (Huber und Reuter 1990, S.22).
Diese Kritik bedeutet für die hier angeführten Vertreter aber nicht, sich im Umkehrschluss für den negativen Frieden auszusprechen; die Forderung besteht vielmehr nach einem engen Friedensbegriff. Was dieses „Mehr“ gegenüber dem negativen Friedensbegriffs ausmachen soll, lässt sich bis heute schwer exakt fassen; und auch die Übergänge – sowohl in die eine als auch in die andere Richtung – erweisen sich als fließend. Übereinstimmung unter den Befürwortern des engen Friedensbegriffs scheint in der Trennung von Friedensbegriff und Friedensursachen zu liegen. Der Friedensbegriff setze dann auf die „Eliminierung des Krieges“ (Czempiel 2002, S.84), und zwar im substanziellen Sinne: Er fokussiere auf die Verhinderung des Krieges, einschließlich der Bereitschaft zum Krieg, und auf einen Konfliktaustrag, der durch Gewaltverzicht gekennzeichnet sei. Beispielhaft hierfür sei die Definition von Ernst-Otto Czempiel:
„Friede besteht in einem internationalen System dann, wenn die in ihm ablaufenden Konflikte kontinuierlich ohne die Anwendung organisierter militärischer Gewalt bearbeitet werden.“ (Czempiel 1998, S.45)
Das mache die Begriffsdefinition, so ähnlich sie zunächst der des negativen Friedens erscheint, voraussetzungsreich. Sie unterscheide sich deutlich von einem „Friedens“-Zustand zu Zeiten der Ost-West-Konfrontation; hinzu trete ihre zeitliche Dimension: Friede als dauerhafter Friede.4
Ausgehend von einem eng, aber substanziell gefassten Friedensbegriff werde dann nach den konkreten Bedingungen des Friedens gefragt. Dabei lassen sich verschiedene Zugänge ausmachen: Ansätze auf der Mikroebene zielen auf die individuellen Bedingungen gewaltfreier Konfliktaustragung und umfassen verschiedene Streitbeilegungsmechanismen, Formen friedlicher Konfliktbeilegung, Konflikttransformation oder auch konsensorientierte Konfliktlösungsstrategien.5 Die Mesoebene fokussiert auf gesellschaftliche Friedensbedingungen. Hier spielen Theorien der Demokratisierung und Zivilisierung (Demokratischer Frieden, Zivilisatorisches Hexagon etc.) eine zentrale Rolle. Auf der Makroebene werden vor allem systemische Bedingungen untersucht. Dazu zählen Ansätze, die auf eine Transformation der Struktur des internationalen Systems zielen wie beispielsweise Verrechtlichung, internationale Organisationen und Regime sowie wirtschaftliche Kooperation und Freihandel. Zudem finden sich konstruktivistische Ansätze, die auf eine Veränderung von Wahrnehmungen und der Etablierung einer Friedenskultur setzen.
Der Philosoph Georg Picht (1975, S.46) vertritt dagegen die These, es gehöre zum Wesen des Friedens, dass er nicht definiert werden könne. Stattdessen fokussiert er auf die Dimensionen politischen Handelns, anhand derer der Friedenszustand realisiert werden müsse, denn – so Picht (1971, S.33) – „[w]enn wir Frieden herstellen, definiert er sich selbst“. In diesem Kontext deckt er drei Parameter des Friedens auf, die unauflöslich miteinander zusammenhängen: Schutz gegen Gewalt, Schutz vor Not und Schutz der Freiheit. Der Politikwissenschaftler Dieter Senghaas fügt später eine vierte Dimension hinzu: Schutz vor Chauvinismus beziehungsweise positiv formuliert die Anerkennung kultureller Vielfalt (vgl. Senghaas und Senghaas-Knobloch 2017). Nach Picht (1971, S.33) müsse jede Ordnung – innergesellschaftlich wie international – friedlos sein, die eine dieser Dimensionen vernachlässige. Auch wenn Picht explizit auf eine Definition des Friedens verzichtet, lässt sich unschwer erkennen, dass Frieden hier inhaltlich weiter als der negative Frieden gefasst wird.