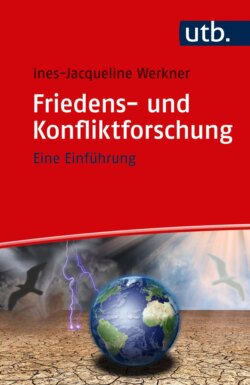Читать книгу Friedens- und Konfliktforschung - Ines-Jacqueline Werkner - Страница 17
3.1 Zur Normativität der Friedensforschung
ОглавлениеDebatten um die Normativität der Friedensforschung stehen symptomatisch für die Auseinandersetzung mit der sogenannten „kritischen Friedensforschung“. Diese Strömung ist in den 1970er Jahren in Abgrenzung zur traditionellen Friedensforschung entstanden und steht in einem engen Zusammenhang mit Johan Galtungs Konzept der strukturellen Gewalt und des positiven Friedens (vgl. u.a. Senghaas 1971a). Während Vertreterinnen und Vertreter der traditionellen Friedensforschung ausgehend von einem negativen Friedensbegriff und einem realistischen Paradigma wesentlich auf Konfliktmanagement setzten (um Gefahren – beispielsweise des Abschreckungssystems – zu reduzieren), ging es den Protagonistinnen und Protagonisten der kritischen Friedensforschung um dahinterliegende strukturelle Ursachen und damit um eine umfassendere, vor allem auch herrschaftskritische Perspektive. Sie sahen vor allem in der Herrschaftsform eine zentrale Konfliktursache und ein Instrument zur Unterdrückung von Konflikten. So warfen sie der traditionellen Friedensforschung auch vor, Friedensforschung lediglich als „Befriedungsforschung“ zu verstehen.1
Mit dieser Phase verbindet sich eine stark normativ geprägte Friedensforschung, die ihren Ausdruck im „Engagement zum Frieden“ (Kaiser 1970, S.58) findet. In diesem Kontext zieht Karlheinz Koppe (2006, S.60) wie zuvor auch schon Johan Galtung eine Parallele zu den ethischen Standards in der Medizin: Wie jeder Arzt durch den Eid des Hippokrates der Erhaltung des Lebens verpflichtet sei, habe auch der Friedensforscher der Maxime si vis pacem para pacem2 zu folgen. Auch für Harald Müller (2012, S.160f.) stellt Normativität ein konstitutives Merkmal der Friedensforschung dar. Ihm zufolge gebe es drei Pfeiler, die als normative Richtschnur friedenswissenschaftlichen Arbeitens dienen können: erstens das Ziel der Minderung physischer Gewalt, zweitens – ausgehend vom Verständnis des Friedens als soziale Beziehung – die Befriedung eines Handlungssystems sowie drittens die Einnahme der Opferperspektive (im Sinne ziviler Opfer).
Was heißt Normativität?
Der Begriff der Normativität beinhaltet in seinem Wortstamm die „Norm“. In diesem Sinne stellen normative Äußerungen Äußerungen über Normen dar. Norm wiederum bedeutet etymologisch, Richtschnur, Regel und Maßstab zu sein. Im hier verhandelten Kontext erweisen sich zwei Begriffsdeutungen als zentral: Zum einen zeigt sich Norm „als Idee, als ideativer Begriff, als Grenzbegriff einer Eigenschaft im Status unüberschreitbarer Vollkommenheit, im Blick auf den empirische Gegenstände bzw. Handlungen als mehr oder weniger gelungene Annäherungen realisiert und beurteilt werden“ (Forschner 2002, S.191). Diese Perspektive umfasst ihre direktive Seite als inhaltliche Richtschnur. Zum anderen versteht sich Norm „im rechtlichen oder moralischen Sinn als genereller Imperativ, der rechtliches und sittliches Handeln von Einzelnen und Gruppen orientiert“ (Forschner 2002, S.192), womit ihre imperative Seite angesprochen wird (vgl. Jaberg 2009, S.9ff.).
Dieses stark normative Verständnis von Friedensforschung wird seit den 1990er Jahren zunehmend infrage gestellt. Insbesondere von der jüngeren und mittleren Generation wird ihr nur noch eine „partielle Funktion“ (Brühl 2012, S.176) zuerkannt. Mittlerweile beantwortet ein Großteil von ihnen die Frage, ob Friedensforschung als „Forschung für oder Forschung über den Frieden“ (Bonacker 2011, S.46) zu verstehen sei, mit der letzteren Option (vgl. u.a. Daase 1996; Weller 2003; Bonacker 2011; Schlichte 2012; Brühl 2012). Dementsprechend konstatiert Sabine Jaberg (2009, S.5): „Aus dem ursprünglichen Unbehagen am Normverlust ist mittlerweile ein Unbehagen mit der Norm geworden.“
Gegen das Prinzip der Normativität lassen sich vor allem zwei, auf frühere Debatten zurückgehende Argumente in Anschlag bringen: die Tyrannei der Werte sowie die Zerstörung der Wissenschaft durch das Werturteil (ausführlich hierzu Jaberg 2009). Die erste Debatte geht wesentlich auf Carl Schmitt (1979 [1959]) zurück.3 Danach existiere eine innere Logik: Mit dem Setzen von Werten grenze sich das Individuum zugleich gegen andere Werte beziehungsweise „Unwerte“ ab. Diese Über- und Unterordnung von Werten führe zu einer potenziellen Aggressivität: So tendiere der „höhere Wert“ dazu, „den niederen Wert sich zu unterwerfen, und der Wert als solcher vernichtet mit Recht den Unwert als solchen“ (Schmitt 1979 [1959], S.36). Eine Alternative zu dieser Tyrannei der Werte sieht Schmitt in der Wertfreiheit. In Anlehnung an diese Argumentation wird in aktuellen Debatten – beispielsweise von Gertrud Brücher oder Christoph Weller – „der Friedensnorm ein unvermeidbares Potenzial zur Legitimierung jener Gewalt unterstellt, die das Friedensideal verwirklichen soll“ (Jaberg 2011, S.62, vgl. auch 2009, S.19f., 23ff.).
Die zweite, gegen die Normativität der Friedensforschung in Anschlag gebrachte Argumentation weist enge Bezüge zum Werturteilsstreit auf (vgl. Jaberg 2009, S.21f., 25ff.). Dieser wurde in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg um das Verhältnis von Wissenschaft und Politik geführt. Im Zentrum stand die Frage, ob (objektive) Wissenschaft normative Aussagen für politisches Handeln treffen könne beziehungsweise solle. Während für Protagonisten wie Gustav Schmoller Wissenschaft auch Stellungnahmen zu konkreten politischen und gesellschaftlichen Problemen umfassen sollte, plädierten Vertreter wie Max Weber (1985 [1904], S.149f.) für eine Trennung von Forschung und Werturteil, berge Letzteres die Gefahr, die Wissenschaft als solche zu zerstören. So könne es „niemals Aufgabe einer Erfahrungswissenschaft sein […], bindende Normen und Ideale zu ermitteln, um daraus für die Praxis Rezepte ableiten zu können“. Sie könne nur „die Frage der Geeignetheit der Mittel bei gegebenem Zwecke“ beantworten:
„Jene Abwägung selbst nun aber zur Entscheidung zu bringen ist freilich nicht mehr eine mögliche Aufgabe der Wissenschaft, sondern des wollenden Menschen“ (Weber 1985 [1904], S.150).
Parallelitäten zu aktuellen Debatten sind unverkennbar. So argumentiert beispielsweise Christopher Daase (1996, S.482):
„Mit der politisierten Begrifflichkeit grenzt die Friedensforschung […] nicht nur politische Positionen aus, die ihrem Verständnis von ‚Progressivität’ nicht entsprechen, sondern sie schaltet auch einen wichtigen wissenschaftlichen Regulierungsmechanismus aus: die Selbstkritik. […] Indem die Verfahren zur Selbstkritik, die jeder Wissenschaft eingebaut sind, aufgegeben werden, verändert die Friedensforschung ihren Charakter von einem offenen Vernunftunternehmen zu einem geschlossenen Aussagesystem. […] Friedensforschung ist im Grunde eine situative Wissenschaft geworden, ihre Progressivität beschränkt sich auf das politische Engagement ihrer Mitglieder.“
Mit dieser „Entnormativierung“ (Jaberg 2009, S.39) und „Entpolitisierung“ (Ruf 2009, S.46) sehen Vertreterinnen und Vertreter der kritischen Friedensforschung die Friedensforschung in ihren Grundfesten erschüttert. Nach Werner Ruf (2009, S.49) zeichne sie sich „durch die freiwillige Einordnung in den herrschenden Wissenschaftsbetrieb [aus], den zu bekämpfen sie einst angetreten war“.
Für diese Entwicklung lassen sich nach Thorsten Bonacker (2011, S.69f.) verschiedene Gründe anführen: Erstens habe sich das Feld der Friedensforschung mit dem Ende des Kalten Krieges ausdifferenziert. Mit neuen beziehungsweise bis dahin wenig beachteten theoretischen und empirischen Phänomenen sei auch der Friedensbegriff nicht mehr nur „Ausweis für eine normative Selbstverpflichtung der eigenen Forschung“, sondern selbst zum Untersuchungsgegenstand empirischer Forschung geworden. Zweitens lasse sich angesichts der gestiegenen Komplexität ein verstärktes politisches Interesse an Expertise identifizieren, die die Friedensforschung in eine größere Nähe zur Politik gebracht habe. Drittens sei eine zunehmende Professionalisierung der Friedensforschung erkennbar, womit nicht mehr nur ihr normativer Status, sondern zunehmend auch Theorie- und Methodendebatten in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt seien. Schließlich wirken sich viertens auch der Paradigmenwechsel in den Sozialwissenschaften und die Zunahme konstruktivistischer und poststrukturalistischer Zugänge auf das Selbstverständnis der Friedensforschung aus, gewinnen damit Ansätze an Bedeutung, die stärker auf die Beobachtung von Diskursen setzen.
Letztlich kommen aber auch psychologische Komponenten zum Tragen, die sich mit normativen Debatten inhaltlich überschneiden. In gewisser Weise sei Berufswahl auch Symptomwahl. So könne die Arbeit am Frieden dazu verleiten, entweder „die eigenen destruktiven Impulse anzuregen“, beispielsweise in Form „einer heimlichen Affinität zu Militär und Krieg“, oder aber „von der eigenen Destruktivität abzulenken“, das sich dann „in einer besonders heftigen Distanz zu den Institutionen, die angeblich allein für Krieg und Gewalt verantwortlich sind“, äußert (Krell 2017, S.957).