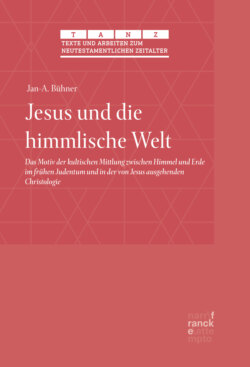Читать книгу Jesus und die himmlische Welt - Jan-A. Bühner - Страница 16
A) Der Tempel als Schnittpunkt der Schöpfung und das Problem seiner Substitution
ОглавлениеReligionsgeschichtlich gehören Schöpfungserzählungen in den Bereich kultischer Daseinssicherung: Wer die Zusammenhänge kennt, die einst die gute Schöpfungsordnung gegenüber dem Chaos oder dem unvordenklichen Nichts abgrenzten, kann auch in der Gegenwart durch Rezitation und Symbolisierung diesen guten Urzustand repräsentieren. Diese Zusammenhänge von Kultus und Mythos gelten von den primitiven Kulturen des ganzen Erdballs bis hin zu den Hochkulturen des Alten Orients.1
Die Bezeichnung Gottes als des Herrn der Schöpfung aus Himmel und Erde ist eine im Kultus formulierte Aussage des beschreibenden Gotteslobs.2 Die nachexilische Theokratie geht ganz von der zentralen Bedeutung des Tempels und seines Rituals aus: Entsprechend ist in P das Zentrum der Erwählungsgeschichte, die Einrichtung des Stiftshütten-Kultes, gerahmt durch die Lehre von der Schöpfung am Anfang. Andersherum betrachtet, kann man sagen, dass die die biblische Tradition endgültig prägende Fassung durch P die Schöpfung bezieht auf ihren Schnittpunkt im Jerusalemer Kult.3
Die von G. von Rad scharf formulierte Frage nach der theologischen Bedeutung der Schöpfungslehre4 kann, zumindest nicht für die nachexilische Zeit, durch eine Gegenüberstellung des alten, geschichtlich orientierten Jahwe-Glaubens und des kanaanäischen Naturdenkens beantwortet werden. Sowohl die ganze Institution des Wohntempels, samt seiner kosmischen Bedeutung, als auch die Rede von Jahwe als Himmelsgott wird zweifellos ursprünglich kanaanäisches Erbe sein; jedoch ist die Vorstellung schon für Jes 6 ganz selbstverständlich, dass der Gott Israels in einem an den Himmel angrenzenden Bereich wohnt und dass dieses sein Wohnen durch den Tempel in die Schöpfung aus Himmel und Erde hineinreicht.
Der Himmel ist für das nachexilische Judentum kultisch reine Sphäre, da die in ihm präsente Heiligkeit Gottes dies fordert.5 J. Jeremias6, R. Patai7 und andere8 haben dargestellt, dass für den Juden der Tempel Zugangsort zum Himmel ist, ja dass man, wenn man vom Himmel spricht, sich automatisch in einem Bereich bewegt, der kultisch geregelt und bebildert ist: Gott, Himmel und Tempel bilden eine begriffliche und anschaulich assoziierte Einheit.9 Josephus gibt für die Zeit des Neuen Testaments ein beredtes Beispiel, mit welchen Augen man auf den Tempel sah. Man mag fragen, ob die kosmische Bedeutung, die er, der Priester, der Stiftshütte und ihren Gerätschaften (ant 3,123.180ff.) und der Tempelausrüstung (bell 5,212ff.217f.)10 zumisst, wirklich populär war; jedoch gilt dies von den seine Darstellung des jüdischen Kriegs prägenden Bemerkungen über den Tempel, auf den sich die Zeloten verließen und der auch für ihn als innerster Kern der drei Größen Volk, Stadt und Tempel Gottes Gegenwart und Eingreifen in die Geschichte darstellt. Bell 4,318.323f. wird geradezu die σωτηρία Israels auf das Leben und die Kultfähigkeit des Hohenpriesters zurückgeführt; sein Tod leitet das Unheil ein. Gott hat seine Diener, die den dem ganzen Weltall zugeordneten Gottesdienst geleitet haben, im Tode hinweggerafft, bevor er das entweihte Heiligtum der Reinigung durch das Feuer preisgab.
Die von den Zeloten erwartete Epiphanie Gottes im Tempel gehört zur volkstümlichen Tempelanschauung bereits des 2.Makk (3,24-30). Ist hier Gottes Eingreifen an den Tempelort gebunden, so ist in 3.Makk die Diaspora einbezogen: Das Geschick der Judenschaft in Ägypten hängt grundsätzlich an der Stellung des Landesherrn Ptolemäus zum Jerusalemer Tempel; als ihm dort der Zutritt zum Allerheiligsten verwehrt wird (1,10ff.), bestraft er die ägyptische Judenschaft (2,25ff.). Diese wiederum wird gerettet durch priesterliches Gebet (6,1ff.), das Gott zum Eingreifen bewegt: Der Himmel öffnet sich und 2 Engel treten den Feinden entgegen (6,18ff.). Der Priester hat in seinem Gebet Zugang zum himmlischen Heiligtum, so dass das heilige Antlitz Gottes, das man traditionell im Tempel schauen konnte (Gen 35,7; Num 6,25; Ps 30,16; 66,1), nun vom Himmel her epiphan wird.
Die Tempelsymbolik „war auf das engste mit den agrarischen Lebensverhältnissen verquickt und von daher tief in der Volksfrömmigkeit verwurzelt, sowie mit den Hoffnungen und Ängsten des menschlichen Alltags verbunden“.11 Die häufigen Wallfahrten auch der Landbevölkerung zum Tempel bezeugen die Geltung des Anspruchs des Tempels auf Vermittlung des Heils an das Volk.12 H. Gese spricht von der intensiven inneren Beteiligung, die zum Vollzug des Kultes gerade in der nachexilischen Konzeption von P gehörte: „Es ist anzunehmen, dass von solchem kultischen Denken her der ganze Lebensbereich geprägt wird.“13
J. Maier14 hat diese Beobachtungen zur lebensprägenden und theologisch normierenden Stellung des Tempels im jüdischen Volk dahingehend zugespitzt, dass Zugang zur Nähe Gottes immer an das kultische Bild der Gottesbegegnung des Priesters gebunden bliebe: Die Bebilderung des Himmels als einer Sphäre der gesteigerten Nähe Gottes verlange notwendig, dass jede außerhalb des kultischen Vollzugs gesuchte Nähe zu Gott sich quasi-kultischen Regeln unterwerfe. Dies gelte von der Berufungsvision des Jesaja bis zur jüdischen Mystik, in der der Hohepriester Idealtyp für die mystisch-ekstatische Gottesbegegnung werde.
Nach 70 fiel diese Grundlage der religiösen Ausrichtung des frühen Judentums auf den himmlischen Vater fort, der sich gnädig an seine Gegenwart im Kulthaus und das Bereitstellen der Kultriten gebunden hat. Durch diesen gravierenden Umbruch15 entsteht die Frage nach den Bedingungen, unter denen eine ‚Beerbung‘ des Kultes möglich war.
Der relativ nahtlose Übergang in die rabbinische Zeit legt die Vermutung nahe, dass nach 70 die Substitution des Kultes nicht als völlig neue Aufgabe gesehen wurde, an die man mit erst zu entwickelnden Mitteln gehen musste. Die Rabbinen knüpften offenbar an frühere Rezeptionen der Kultfrömmigkeit, der ‚sekundären‘ Aufnahme der Kultideologie und des kultischen Weltbildes an. Dieses komplexe Thema können wir hier allerdings nur streifen.16 Sicher ist, dass die Rabbinen auf die pharisäische Ausweitung des kultischen Reinheitsideals auf die häusliche Tischgemeinschaft zurückgegriffen haben: Hinter den Rabbinen steht zumindest auch die priesterliche Laienbewegung der Pharisäer, die Ex. 19,6 zur Grundlage ihres Selbstverständnisses gemacht haben.17
Daneben ist nach Neusner für die rabbinische Beerbung des Kultes in seinem Himmel und Erde verbindenden kosmischen Anspruch die Bestimmung der Tora als einer ontologischen Größe entscheidend. Während die Pharisäer bis Eliezer ben Hyrkanus den Tempelkult abbildeten, ersetzen ihn die Rabbinen durch dieses vorgeblich ältere Tora-Prinzip.18 Vorgänger für diese Sicht der Tora sind nach Neusner die schriftgelehrten Weisen seit Ben Sira; die Tora wird mit der Weisheit identifiziert und dadurch zur kosmisch-ontologischen Größe.19 “If study of Torah was central and knowledge of Torah important, then the scribe had authority even in respect to the Temple and the cult.” “Earlier scribism thus contained within itself the potentiality to supersede the cult.”20
Der kosmische Grundzug der Weisheit, ihr umfassender Charakter als kosmische Ordnungswissenschaft, berührt sich mit kultischer Schöpfungslehre.21 So wird die Weisheitslehre im Judentum von Haus aus in priesterlich-levitischen Kreisen ausgeformt,22 geht dann aber über in eine auch dem Laien zugängliche und das ganze Volk ansprechende Belehrung.23 Daraus entsteht die Frage, ob mit der Öffnung der von Haus aus kultisch gebundenen Weisheit in die Laienerziehung hinein auch ein Abrücken vom Kult und seiner Theologie einhergeht, so dass Öffnung der Weisheit zum Volk, Lösung vom Kult und Aufnahme stärker allgemein-orientalischer und hellenistischer Bildungsgüter einen zusammenhängenden Vorgang bilden.24 Oder muss man annehmen, dass die Kulttheologie mit ihrem Hinweis auf das himmlische Gesetz Grundlage auch der Weisheitserziehung bleibt? M.a.W.: Es geht um die Alternative einer Lösung der Weisheit vom Kult einerseits und anderseits der Selbstausweitung des priesterlichen Grundwissens auf die neueren Spezifizierungen der Kultur und Philosophie.
Auch das Buch Kohelet, die anscheinend am deutlichsten profane und hellinisierte Spitze der jüdischen Weisheit, löst sich nicht vom Tempel und seiner Theologie: 4,17-5,6 betonen ganz im Sinne der älteren Kultspiritualität die Vorsicht vor äußerer Opfer-Gewissheit: Stilles Hören ist besser, und das Gelübde Gott gegenüber ist so heilig, dass es lieber unterbleiben soll, als unter Umständen dem Bruch ausgesetzt zu sein; und ganz im Sinne priesterlichen Selbstverständnisses dürfte es sein, wenn betont wird, dass das Wort vor dem Priester wie vor Gott selbst gesprochen ist. Die Warnung vor dem vorschnellen Wort – „denn Gott ist im Himmel, und du bist auf Erden“ (5,1) – entspricht dem traditionellen Ernst der kultischen Situation, in der Himmel und Erde bei aller Unterscheidung doch in besonderer Weise miteinander verschränkt sind.
Die Weisheit offenbart über Genesis 1 und 2 hinaus die Halacha, die der geordneten Existenz entspricht, welche der Mensch nicht zuletzt als Kultteilnehmer jeweils als neue Realität erfährt.25
Um Elemente proto-rabbinischer Rezeption des Anspruchs des Tempels auf Zentrierung der Schöpfung und der Geschichte, sowie auf Verbindung von Himmel und Erde zunächst unabhängig von der Frage nach einer Weisheits-Ontologie angehen zu können, werden wir in einem ersten Abschnitt das Dokument näher betrachten, welches ausdrücklich die rabbinische Vorgeschichte thematisiert, die Einheit MAb 1,2-15.
Für die Zeit des Neuen Testaments liegen aber bereits zwei weitere Linien einer Rezeption des Kultanspruchs vor, die apokalyptische und die charismatisch-‚praktische‘:
Die apokalyptischen Schriften behandeln überwiegend Themen, die aus dem Bereich kultisch vermittelter Kosmologie stammen: Es geht um die Gestaltung des Himmels, die ordnende Aufgabe der Himmlischen, um die Strukturierung der Geschichte durch die Entdeckung des dem Anfang und dem himmlischen Geheimnis entsprechenden Endes. Wie Israels Geschichte eingebettet ist in die kosmische Schöpfungsordnung, so geht die Vollendung der Heilsgeschichte nur durch eine eschatologische Neustiftung der kosmischen Ordnung vonstatten.26 Näherhin entsteht aus der Beobachtung der apokalyptischen Ausdrucks- und Offenbarungsformen die Frage, ob man nicht geradezu von einer frühen jüdischen Kultapokalyptik sprechen muss, die ihre kosmische und endgeschichtliche Perspektive durch den kultisch erschlossenen Zugang zum himmlischen Teil der Schöpfung erhält. Da 1Hen 1-36 zum ältesten, vielleicht gar vor-danielischen Teil der frühjüdischen Apokalyptik gehört, nehmen wir hier unseren Ausgangspunkt. Aus der Beobachtung der apokalyptischen Verwendung der älteren Kultideologie entsteht die Frage, ob man in diesen Kreisen noch den Kult in Jerusalem als Mittler einer eschatologischen Neu-Verbindung der Schöpfungshälften aus Himmel und Erde ansehen konnte. Deshalb schließen wir eine Untersuchung der in diesem apokalyptischen Milieu einer Rezeption des kultischen Anspruchs entwickelten Gestalt des eschatologischen Erlösers an: Es geht um den himmlisch-eschatologischen Hohenpriester-Herrscher.
Neben der apokalyptischen Rezeption des Kultanspruchs steht eine charismatisch-praktische: Die rabbinische Literatur berichtet von Wundermännern, die in Anknüpfung und Überbietung der kultischen Erschließung des Schöpfungsgeheimnisses wirksam werden; neben Männern der vorrabbinischen und frührabbinischen Tradition begegnen hier angeblich biblische Gestalten im Sinne eines kult-prophetischen Charisma. Die mit dem Kult verbundene Möglichkeit, die himmlische Ebene der Schöpfung als den Gott nahen Bereich zu erschließen, wird hier verwendet als Basis eines direkten, symbolisierten oder ekstatischen, Zugangs zum himmlischen Haus Gottes. Hier liegt eine der wesentlichen Traditionsvorgaben für die Sohn-Tradition Jesu und der Schlüssel für die Erschließung ihres Anspruchs.