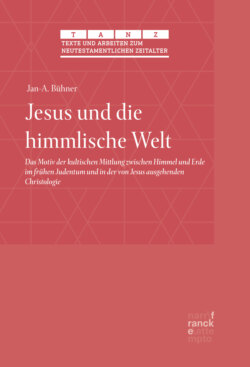Читать книгу Jesus und die himmlische Welt - Jan-A. Bühner - Страница 9
A) Hinführung zum Thema
ОглавлениеDas historisch und theologisch notwendige Bemühen um eine sachgemäße Verbindung von Altem und Neuem Testament kann sich auf mehrere Rahmengrößen beziehen, die beide Testamente zusammenbinden. In der neueren Theologie hat man dabei vor allem den geschichtsbezogenen Charakter der biblischen Theologie hervorgehoben.1
Die Geschichte Gottes mit seinem Volk ist jedoch nicht der einzige gemeinsame Rahmen für die Theologie beider Testamente, vollzieht sich diese Geschichte doch auf einem sie erst ermöglichenden Grund, nämlich der Welt als Schöpfung Gottes.
Die biblische Betrachtung der Welt als Schöpfung ist vom ersten Buch des Alten bis zum letzten des Neuen Testaments geprägt durch eine Unterscheidung zweier Räume der Schöpfung, des Himmels und der Erde. Dabei ist unübersehbar, dass auch der Himmel Teil der Schöpfung ist;2 ebenso unübersehbar ist die Voraussetzung in beiden Bereichen der biblischen Tradition, dass der himmlische Teil der Schöpfung der Heiligkeit Gottes nähersteht. Die Priestertheologie von Gen 1 macht dies durch die betonte Vorordnung des Himmels deutlich, während die Kultapokalyptik der Johannesoffenbarung aus der Schau der himmlischen Prozesse einen Übergang des himmlischen Lebens um den Thron des Lammes herum in die eschatologische Neuschöpfung von Himmel und Erde ableitet. Der himmlische Teil der Schöpfung hat seit Anbeginn, und auch für die Endzeit, eine gesteigerte Lebensqualität.
Dieser biblischen Schöpfungslehre entspricht es, wenn das Neue Testament die Lehre von Gott, dem Christus und der Erlösung vor dem Hintergrund einer eschatologischen Neuverbindung der getrennten Schöpfungsräume expliziert. So geschieht es schon auf der frühesten Stufe der nachösterlichen Tradition: Mit Phil 2,5-11 zitiert Paulus einen bekenntnisartigen Hymnus.3 Er handelt von Jesus Christus, der aus der Würde einer überhimmlischen Gottgleichheit heraus sich für seinen irdischen Gang der göttlichen Gestalt entäußert hat und nach seinem gehorsamen Weg an das Kreuz nun als Erhöhter den kosmischen Machtnamen besitzt, der ihn zum eschatologischen Herrn der Schöpfung macht.4 Bis in die altkirchliche Lehrbildung hinein – und von ihr aus bis in die Theologie der beginnenden Neuzeit – lässt sich unschwer feststellen, dass eine mehr räumliche als zeitlich-geschichtliche Deutung der Schöpfung den Rahmen für die Darstellung des Heilshandelns Gottes an der Welt gegeben hat. Die biblische Erfassung der Wirklichkeit als Geschichte ist nicht nur ein Relikt nomadischer Väter-Religion, sondern bezieht ihren zukunfts- und zielorientierten Charakter aus der Spannung der zweigeteilten Schöpfung, die hinweist auf eine Neuschöpfung, welche diese Spannung aufheben wird.
Die vorliegende Untersuchung will die Beobachtung historisch und theologisch verständlich machen, dass die Evangelien Jesus aus einer ihm eröffneten Beziehung zur himmlischen Welt verstehen, ja Jesus sich selbst so versteht. Durch Taufe, Verklärung und Passion-Erhöhung ist Jesu irdischer Weg als ein Geschehen gedeutet, welches sich aus dem Himmel heraus vollzieht. Seine Verkündigung und sein vollmächtiges Wunderwirken realisieren die Gegenwart der himmlischen Basileia Gottes. Im Vollzug seines irdisch-geschichtlichen Lebens öffnet sich der der himmlischen Heiligkeit Gottes und der eschatologischen Neuschöpfung nahe Teil der Schöpfung zum irdischen hin. Jesu Gebet eröffnet im Medium kultischer Sprache den Zugang zum Vater ‚im‘5 Himmel. Er realisiert geradezu die erlösende Kraft der Gemeinsamkeit zwischen himmlischer und irdischer Gemeinde in der Doxologie des Schöpfers.6
Trotz breitester biblischer Fundierung ist das Thema ‚Himmel‘ und damit auch der Versuch, die Jesus-Tradition in diesem theologischen Rahmen zur Sprache kommen zu lassen, seit der Aufklärung verdrängt worden.
Der Liberalismus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hat hierbei entscheidende Weichen gestellt: Er reduzierte die Christologie auf eine Darstellung des Werkes Jesu im Sinne der Bedeutsamkeit seiner Botschaft. Das Reich Gottes, welches in der Verkündigung Jesu auch eine gegenwärtige, himmlische Größe ist, wurde so zu einem höchsten sittlichen Gut, das als zukünftig erreichbare Größe erschien. Jesu Person wurde zum sittlichen Vorbild, ausgedrückt in Kategorien hervorgehobenen, heroischen Menschseins.7 Die Kategorie der Zeit wurde damit zum tragenden Rahmen des Versuchs, Jesus dem modernen Menschen nahezubringen und das Menschsein entsprechend seinem Vorbild voran zu bringen.
Diese liberale Reduktion untersteht deutlich dem aufklärerischen Impetus, den Menschen als verantwortlichen Gestalter der ihm begegnenden Wirklichkeit zu sehen, einer Wirklichkeit, die, soll sie nicht irrelevant sein, eben eine irdische und zeitliche ist. Das religiös Bedeutsame muss sich im Rahmen eines Zeitbegriffs verankern lassen, der die Verbindung dieses religiös Bedeutsamen mit dem Jetzt der menschlichen Geschichte ohne Postulat einer Transzendenz offenhält.
Es ist nicht verwunderlich, dass sich diese aufklärerische Hermeneutik des Christentums als einer sittlichen Bewegung auch mit einer eschatologischen Deutung verbinden kann. Sie drängt auf das Ziel der Erziehung des neuen Menschen hin. Dabei wird die Zukunft nicht mehr als Paradigma der Transzendenz8 gesehen, sondern als Paradigma für den Anspruch, dass die Menschheit um ein letztes geschichtliches Ziel weiß.9
Hier taucht die grundsätzliche Frage auf, ob es letztlich egal ist, von einem räumlichen oder zeitlichen ‚Himmel‘ zu sprechen, wenn nur festgehalten wird, dass es einen raum-zeitlichen Aspekt der Schöpfung gibt, welcher sich dem Zugriff des Menschen entzieht und Paradigma des Einbruchs der Transzendenz ist.10
Wichtig ist eine doppelte Beobachtung. Einerseits ist die Tendenz erkennbar, die Zukunft als Dimension des Handelns Gottes gegen das räumliche Oben des Himmels, als die der Transzendenz nähere Sphäre, auszuspielen. Die moderne Situation ist dann deutlich mit der Gefahr verbunden, Zukunft als Verlängerung irdischer Geschichte zu verstehen.11 Andererseits zeigt die Religionsgeschichte, dass das grundlegende, alles andere tragende Angerührtsein des Menschen von der Transzendenz sich in den stärker ‚senkrecht‘ orientierten Phänomenen, wie beispielsweise Ekstase und Gebet, äußert. Neutestamentlich muss man mit H.R. Balz fragen, „… ob sich die urgemeindliche Eschatologie … wirklich nur als ein Zeitproblem verstehen lässt …“12 Karl Barth hat mit Entschiedenheit gegen eine drohende Verengung im Umkreis der ‚konsequenten Eschatologie‘ das Augenmerk darauf gelenkt, dass der pneumatisch-gegenwärtige, himmlische Christus der Ermöglichungsgrund für den Blick in die eschatologische Zukunft ist.13 Jenseits des Zeitproblems steht also die Antwort der Religionsgeschichte und auch des biblischen Zeugnisses, dass es eine Verbindung im Pneuma zum himmlischen als dem der Transzendenz näheren Raum gibt.
Der Fixpunkt für die urchristliche Eschatologie liegt in der durch das Pneuma gewährten Beziehung der Gemeinde zu ihrem himmlischen Herrn. Daraus ergibt sich die Erwartung, dass auch die Reich-Gottes-Ansage Jesu ihren eigenen Fixpunkt in seinem gegenwärtig-pneumatischen, personhaften Einbezogensein in das Reich Gottes findet. Jesus blickte dann nicht nur auf eine zukünftige Realisierung des Reiches. Mehr noch ist es eine Größe, die aus der himmlischen Verborgenheit in die Wirklichkeit der neuen Schöpfung eintritt.
Diese Konsequenz zog M. Dibelius in seinem Jesusbuch: „… eine (scil. Jesu) Verkündung des unbedingten Gotteswillens hat das Kommen des Reiches zur Voraussetzung; die Art, wie er die Menschen vor die Wirklichkeit Gottes stellt, ist begründet in der Aussicht, dass diese himmlische Wirklichkeit demnächst irdische Wirklichkeit werden solle.“14
Jesus kennt die Basileia als himmlische Wirklichkeit und weiß darum, dass diese himmlische Wirklichkeit sich anschickt, nach der Erde auszugreifen. Ändert man den etwas vagen Ausdruck der ‚Aussicht‘ bei Dibelius zu dem der pneumatischen Gewissheit, so ergibt sich unausweichlich, dass Jesus mit dieser himmlischen Wirklichkeit einen intensiven Kontakt gehabt haben muss, ja zu ihr gehört hat. Urchristlicher Pneumatismus mit der Vielzahl seiner Phänomene als Haftpunkt urchristlicher Eschatologie verlangt als begründende Analogie ein Jesusverständnis, nach dem er Pneumatiker gewesen ist, der schon als Irdischer der himmlischen Basileia zugehörte.
Für eine hermeneutisch nicht eingeschränkte historische Forschung15 scheint es also aus mehreren Gründen notwendig zu sein, die Dimension des Himmlischen als Raum der angrenzenden Transzendenz weder aus der neutestamentlichen Christologie noch aus dem historisch erkennbaren Bild vom irdischen Jesus zu entlassen:
die räumliche Dimension der biblischen Lehre von der in Himmel und Erde getrennten Schöpfung wehrt sich heftiger gegen alle Versuche, das Transzendente in den irdischen Geschichtsablauf einzubinden, als eine rein zeitliche Eschatologie. Die Rede vom ‚Himmel‘ benötigen wir, um Eschatologie vor dem Versinken in Immanenz zu bewahren.
Auf der Folie der räumlichen Kategorie ‚Himmel‘ werden die mit der Religionsgeschichte unlösbar verbundenen pneumatischen Phänomene wieder erkennbar und als Zeichen präsentischer Eschatologie deutbar.
Neutestamentlich ergibt sich aus diesem in die biblische Schöpfungslehre eingebundenen Rückgriff auf den ‚Himmel‘, dass Jesus als Pneumatiker deutbar wird. Wenn er der Anfänger der Bewegung ist, die die eschatologische Neuschöpfung mit dem gegenwärtigen Pneuma-Besitz verschränkt, dann gehört er bereits als Irdischer auch zur himmlischen Welt.