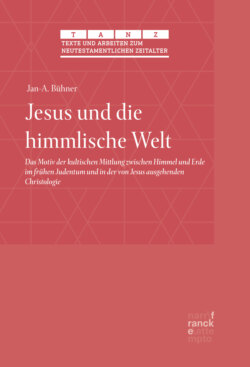Читать книгу Jesus und die himmlische Welt - Jan-A. Bühner - Страница 18
1. ‚Simon der Gerechte‘ (um 220 v. Chr.)1
ОглавлениеDie Mischna braucht einen kurzen Anlauf, um aus ‚illo tempore‘ des normativen Anfangs (Mose am Sinai) bis in historisch greifbare Zeiten zu kommen. Diese beginnen im 3. Jahrhundert mit ‚Simon der Gerechte‘.
Er ist bezeichnenderweise Hoherpriester, so dass man als Grundlage hervorheben kann, dass die Ahnengalerie der Rabbinen historisch mit einem Hohenpriester beginnt.
Da die Pharisäer aufgrund Ex 19,6 das Ideal des Priesterdienstes auf das ganze Volk ausdehnen wollen,2 also es nicht mehr bestimmten Stammes-Grenzen vorbehalten, ist als Spannungsbogen der vorrabbinischen Epoche das Programm dieser Ausweitung und Rezeption gegeben.
Dies wird deutlich, wenn man Simon vergleicht mit Hillels Spruch von der Aaron-Jüngerschaft, der die alte, vormischnische Sammlung in 1,15 abschließt. In ihrer Anschaulichkeit noch deutlicher ist die Anekdote, die in der Baraitha bJoma 71b von den Lehrern Hilles überliefert ist: „Unsere Lehrer lehrten: Es begab sich mit einem Hohenpriester, dass er aus dem Tempel trat und alles Volk hinter ihm herging. Als sie aber Schemaja und Abtalion erblickten, überließen sie ihn sich selbst und gingen hinterher. Schließlich kamen Schemaja und Abtalion, um von dem Hohenpriester Abschied zu nehmen. Er sprach zu ihnen: ‚Mögen die Söhne der Völker (Schemaja und Abtalion galten als Nachkommen Sanheribs, also eines Nichtjuden3) in Frieden kommen!‘ Da sprachen sie zu ihm: 'Mögen die Söhne der Völker in Frieden kommen, die den Dienst Aarons tun, nicht aber komme in Frieden der Sohn Aarons, der Aarons Dienst nicht tut.‘“
Diese Anekdote trifft sicherlich historisch korrekt die pharisäische Auseinandersetzung mit dem Hochpriestertum der späthasmonäischen Zeit.4 Das öffentliche Ansehen hat sich danach bis ca. 50 v. Chr. vom Hohenpriester weggewendet hin zum pharisäischen Frommen und dabei nicht nur die Grenze der priesterlichen Herkunftsbindungen, sondern auch die des Israel κατὰ σάρκα übersprungen. Es gibt nunmehr nichtpriesterliche Fromme, die den Aaron-Dienst im eigentlichen Sinne wahrnehmen und die sich deshalb auch seinen Aufgaben und seiner Würde stellen. Ihr Verhältnis zum Kultus ist ein doppeltes: Es geht um den wahren Aaron-Dienst und damit um eine Reform am Kultus einerseits, jedoch andererseits um eine Umgestaltung des Priesterdienstes zu einer Laien-Frömmigkeit. Wenn sich die öffentliche Reputation nach dieser Anekdote vom Hohenpriester zum pharisäischen Frommen wendet, so sind damit Erwartung und Anspruch zum Ausdruck gebracht, dass die Kontakte zur himmlischen Welt, die qua Amtsoffenbarung und segnender Vermittlung himmlischer Wundergaben am Hohenpriester hingen,5 vom Frommen wahrgenommen, ja überboten werden. Soweit zum äußeren Spannungsbogen der Einheit.
Mit ‚Simon der Gerechte‘ beginnt die historisch greifbare Epoche des Vor-Rabbinats, und zwar mit einer Gestalt des idealen Hohenpriesters.
Josephus Ant. XII 43 identifiziert den Simon ὁ καὶ δίκαιος ἐπικληθείς mit dem Onias-Sohn Simon I., der um das Jahr 300 v. Chr. gelebt hat. Gegen diese Identifizierung spricht, dass die rabbinischen Legenden von der Kultherrlichkeit des ‚Simon der Gerechte‘ starke Anklänge an das Lob des Kultreformers und Hohenpriesters Simon II. bei Jesus Sirach 50,1-23 haben.6 In der rabbinischen Tradition kann mit Simon der Gerechte nur Simon II, der um das Jahr 220 v. Chr. lebte, gemeint sein. Dafür spricht die in MAb 1 vorausgesetzte Chronologie, in der der Simon-Schüler Jose ben Joezer zwei Generationen nach ihm und in der Zeit des Alkimus (um 160 v. Chr.) festgemacht ist.
‚Simon der Gerechte‘ eröffnet die pharisäische Rezeption des Aaron-Dienstes, wenn er neben dem öffentlichen Kult, auf dem die Welt steht, die Tora und die גמילות חסידים ‚Barmherzigkeit‘ nennt. Religionsgeschichtlich ist unumstritten, dass die Größe, auf der die Welt steht, ursprünglich der öffentliche Kultus ist.7 Dies dürfte aber auch traditionsgeschichtlich für das nachexilische Judentum gelten, dergestalt, dass die Größen Tora und גמילות חסידים Aspekte des kultischen Geschehens gesondert betonen:
Biblisch-theologisch ist der Traditionsstrom bekannt, nach dem Tora vom Zion ausgeht und vom Priester gegeben wird.8 Wenn für die Rabbinen die Tora präexistente, kosmische Größe ist,9 so geht dieses Tora-Verständnis letztlich zurück auf die kosmische Bedeutung des Kultus und der in ihm verwahrten, von Gott übermittelten Urkunde der ursprünglichen Weltordnung. bMeg 31b und bTaan 27b stellen fest: Ursprünglich hatten Himmel und Erde Bestand durch die entsühnende Wirkung des Opfers im Tempel, welche den Zorn Gottes, der auf Vernichtung der Welt drängen könnte, zurückgehalten hat. Dies konnte aber nur geschehen, weil hinter dem Opfervollzug die göttliche Ordnung stand, gemäß der er vollzogen wurde. Da diese schriftlich gegebene Ordnung das erste ist, der Vollzug aber daraus nur abgeleitet, kann ein anderer Umgang mit dieser schriftlichen Kultordnung an die Stelle des tatsächlichen Opfers treten, nämlich das Tora-Studium. Die Tora bleibt auch in diesem Gedankenverbund kosmische Größe als kultische Größe.
Für das Glied גמילות חסידים spielt im protorabbinischen Pharisäismus, wie im NT, Hos 6,6 eine entscheidende Rolle. Jedoch ist Hos 6,6 nicht im Sinne einer Spiritualisierung und der Betonung freier Sittlichkeit eingeführt, sondern der älteste Kommentar zu MAb. 1,2 in ARN A IV (S. 11a) sieht in der גמילות חסידים ein der Schöpfung mitgegebenes, göttlich begründetes Prinzip: „Die Welt wurde nicht anders geschaffen als durchחסד , vgl. Ps. 89,2. „Die Schöpfungsordnung, die der Kult bewahrte und darstellte, ruht auf der חסד Gottes, so dass der Mensch als Nachahmer dieser חסד auch ohne den Kult diesem göttlichen Schöpfungsprinzip entsprechen kann. Mehr Beispiele für die göttliche חסד als Ausdruck dafür, dass die Welt auf חסד steht, bringen PRE 12 u. 16.
Dies bedeutet, dass die von ‚Simon der Gerechte‘ genannten Größen neben dem Kultus, Tora und Barmherzigkeit, ihre kosmische Bedeutung deshalb haben, weil sie traditionelle Aspekte des Kultus bilden.10 Wer sich der Tora und der חסד befleißigt, ist der wahre Aaron-Diener und nimmt seine Aufgabe wahr, den göttlichen Hintergrund der Schöpfung zu irdischer Wirklichkeit zu bringen.
Einen ähnlichen Zusammenhang benennt auch PsSal 17,18f.: Weil niemand da ist, der Gerechtigkeit und Recht übt, bleibt Regen aus, und deshalb wird die Erde nicht ernährt. Die Gerechtigkeit ist Ausdruck kultischer Ordnung, mit der zusammen sie vertrieben wird und mit deren Restituierung sie zurückkommt, vgl. 17,27.
Der Hohepriester ‚Simon der Gerechte‘ gibt nach MAb 1,2 also an, wie sich die kosmische Bedeutung des Kultus, die Welt zu tragen, die Schöpfungsordnung zu bekräftigen und eine Übereinstimmung der irdischen mit der himmlischen Schöpfung darzustellen, durch die in ihm enthaltenen kosmischen Größen ‚Tora‘ und ‚Barmherzigkeit‘ ergänzen und aufnehmen lässt.11
Da die kosmische Bedeutung des Kultes sich darin ausdrückt, dass in ihm Nähe der und Zugang zur himmlischen Welt gegeben sind, rücken auch die Aaron-Dienste im Medium von Tora und חסד in diese Himmel und Erde verbindende Funktion. So ist es bezeichnend, dass mit ‚Simon der Gerechte‘ ein idealer Hoherpriester und zugleich pharisäischer Vor-Rabbine gegeben ist, der in mehrfacher Art die Verbindung zur himmlischen Welt wahrnimmt:
Nach b Sota 33a spricht zu ihm aus dem Allerheiligsten die בת קול und verkündet, dass גיוס גלוקט (= Gajus Caligula?), der Hasser des Tempels, umgekommen ist. Entsprechend ist die Schekina während seiner Hochpriesterschaft im Allerheiligsten gegenwärtig (MegTaan 11).12
Nach jJoma 5,3 (42c, Z. 25-39) par. bJoma 39b begegnete dem ‚Simon der Gerechte‘ eine himmlische Gestalt:
„Vierzig Jahre lang hatte Simon der Gerechte das Hochpriesteramt inne; im letzten sprach er zu ihnen: ‚In diesem Jahr sterbe ich.‘ Sagten sie zu ihm: ‚Woher weißt du das?‘ Sagte er zu ihnen: ‚Jedes Jahr, in dem ich in das Allerheiligste ging, ging mit mir ein Greis, in weiße Gewänder gekleidet und gehüllt in Weiß, und kam auch wieder mit mir heraus; in diesem Jahr aber ging er mit mir hinein, kam aber nicht mit mir heraus.‘“
Man fragte vor Rabbi Abahu: „Es ist geschrieben: ‚Kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, um zu sühnen im Heiligtum, bis er herauskommt‘ (Lev. 16,17); sogar diese, über die geschrieben steht: ‚ihr Angesicht glich dem Angesicht eines Menschen‘ (Ez 1,10), auch sie gehören nicht in das Stiftszelt. Sagt er zu ihnen: ‚Wer sagt mir, dass das ein Mensch war? Ich sage: es war der Heilige, gepriesen sei er!‘“
In der babylonischen Fassung heißt es:
„An jedem Versöhnungstag gesellte sich ein Greis, weiß gekleidet und weiß verhüllt, zu mir. Er trat mit mir ein und ging mit mir hinaus. Heute aber hat sich zu mir ein Greis gesellt, schwarz gekleidet und schwarz verhüllt [dieser Satz fehlt in der kürzeren Fassung ganz]. Er trat mit mir ein und ging nicht mit mir hinaus.“
Die himmlische Gestalt ist nach der Jeruschalmi-Fassung die Gottheit selbst, also die Schekina, die im Allerheiligsten mit dem Hohenpriester zusammentrifft. Ähnliches ist bBer 7a vom Hohenpriester Jischmael berichtet: Die Gottheit fordert ihn im Allerheiligsten auf, sie zu segnen. Dass die Gegenwart der Heiligkeit Gottes den Hohenpriester bei seinem Dienst im Allerheiligsten gefährdet, betont die rabbinische Tradition mehrfach.13 Nach TosJoma 3,5 (Zuckermandel 186,7f.) fragen die Priester den Hohenpriester, der lange im Allerheiligsten blieb: ‚Was hast du gesehen?‘ D.h. man rechnete mit Visionen des Hohenpriesters. jJoma 5,3 (42c, 9f) handelt es sich bei dem besonders lange im Allerheiligsten verweilenden Hohenpriester um ‚Simon der Gerechte‘: Die ihn begleitende Gestalt zeigt die Intimität mit der Gottheit an, die die übliche Angst des Hohenpriesters zurücktreten lässt.
J. Z. Lauterbach14 deutet den Zusammenhang aus der babylonischen Fassung: Weiße Engel deuten an, dass der Hohepriester von einem Fürspracheengel vor die Heiligkeit Gottes geleitet wird; der schwarze Greis bedeutet die Gestalt des den Hohenpriester vor der Gottheit verklagenden Satans.
Interessant ist, dass Philo15 Lev 16,17 die Wendung ‚kein Mensch‘ darauf deutet, dass der Hohepriester sich für seinen ihn mit der Gottheit zusammenführenden Dienst in einen Engel verwandeln muss.
Dies führt zu der Überlegung, ob es sich bei dem Greis ursprünglich um den himmlischen Genius des Hohenpriesters handelt, der sich ihm beim Ritus wie ein πάρεδρος beigesellt und ihn zum Eintritt in den himmlisch-irdischen Bereich der Heiligkeit des Allerheiligsten berechtigt.
Die Traditionen zeigen auf alle Fälle, dass der Hohepriester, der sein Amt mit den in ihm liegenden Möglichkeiten wahrnimmt, Zugang zum himmlischen Bereich Gottes hat: Die numinose Kraft des Allerheiligsten hebt den Hohenpriester in seinem Amt am Versöhnungstag aus dem irdisch-geschichtlichen Bereich für eine kleine Weile in den himmlischer Heiligkeit hinein.
Nach bJoma 39b war es zuletzt unter der Hochpriesterschaft des ‚Simon der Gerechte‘ üblich, den Gottesnamen im Priestersegen auszusprechen.
Die Verwendung des Gottesnamens hängt an der Amtsführung des gottgefälligen Hohenpriesters und muss in Zeiten der Gefährdung des Kultus zurückgenommen werden, um den Gottesnamen vor Missbrauch zu schützen.
Nach bJoma 69a ist Simon der Gerechte mit Alexander d. Gr. zusammengetroffen. Obgleich diese Legende schwierige chronologische Probleme aufgibt16, passt sie motivgeschichtlich in das Bild vom idealen Hohenpriester und seinem Kontakt zur himmlischen Welt: Als Alexander d. Gr. ihm begegnete, fiel er vor Simon nieder und sagte: „Das Abbild seines Bildes erstrahlte vor mir während meines Kriegszuges.“ Der jüdische Hohepriester wird für den heidnischen Feldherrn geradezu zu einer Erscheinungsweise der Gottheit. Nach Josephus17 ist der mit den Amtsinsignien, zumal dem Gottesnamen, geschmückte Hohepriester Stellvertreter Gottes und deshalb, als Vermittler zwischen himmlischem und irdischem Geschehen, eine Gestalt, die im Traum erscheinen kann. Sicherlich steht dahinter auch die Überzeugung, dass der Hohepriester in die himmlische Verklärung hineingenommen werden und als solcher in übermenschlicher Gestalt erscheinen kann.
Zu den wunderbaren Aspekten der Amtszeit des idealen, gottgefälligen Hohenpriesters gehört daneben, dass der Kultus mit Zeichen göttlicher Offenbarung und himmlischen Segens ausgestattet ist. Nach bJoma 39a par jJoma 6,3 (43c, Z. 49-66) fiel während der 40-jährigen Amtszeit des ‚Simon der Gerechte‘ das Los immer auf den rechten Bock; der rote Wollstreifen wurde als Zeichen der tatsächlich hinweggenommenen Sünde immer weiß; die westliche Lampe brannte immerzu, als Zeichen der fortwährenden Gegenwart der Schekina18 und als Symbol des beständigen göttlichen Lichtes in der Schöpfung; das Altarfeuer brannte von selbst; in den Darbringungen, die für die Speisung der Priester vorgesehen waren, steckte eine solche Segenskraft, „so dass, wenn ein Priester ein olivengroßes Stück erhielt, er es entweder aufaß und satt war oder gar nicht aß und noch zurückließ.“
Man kann vor diesem Hintergrund fragen, ob es Zufall ist, dass Ben Sirach, der in Kap 50 den Hohenpriester Simon (II.) in der ganzen Herrlichkeit seiner kultischen Offenbarungswürde zeigt, zugleich Kenntnis früher Henoch-, Adam- und Merkaba-Traditionen besitzt.19 Dieses frühe apokalyptische Spezial-Wissen entstammt dem kultischen Bemühen um Erhellung des himmlischen Hintergrundes von Schöpfung und Geschichte.
Die himmlische Dimension im Kultus, und besonders in der Amtsperson des Hohenpriesters, hat die rabbinische Tradition mit dem idealen, gottgefälligen Hohenpriester ‚Simon der Gerechte‘ verbunden, der zugleich am Übergang in das historische Licht des vorrabbinischen Lehrbetriebs steht. Er nennt ‚Tora‘ und ‚Barmherzigkeit‘ als aus dem Kult kommende, geradezu kosmische Größen, die den Kultus in seiner kosmischen, die Schöpfung stützenden und Himmel und Erde verbindenden Bedeutung ergänzen, ja einst ersetzen können. Wenn die Rabbinen in ihm den Ausgangspunkt der priesterlich-pharisäischen Kultrezeption sehen, so weisen sie daraufhin, dass hier Offenbarungsmöglichkeiten liegen, die vorbildlichen Charakter behalten. Wir werden feststellen, dass die genannten Größen, die in ihrer Zusammenfassung die Möglichkeit des Kultes ausmachen, nämlich Himmel und Erde heilvoll zu verbinden, im Rahmen der pharisäischen, laisierten Kultrezeption neu aufgenommen werden.