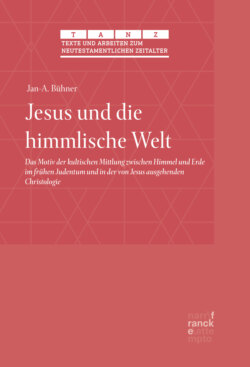Читать книгу Jesus und die himmlische Welt - Jan-A. Bühner - Страница 22
5. Judah ben Tabbai und Simeon ben Shetach (um 90 v. Chr.)
ОглавлениеDie in MAb nächstgenannten Judah ben Tabbai und Simeon ben Shetach gehören in die Zeit des Königs und Hohenpriesters Alexander Jannäus (103-76 v.Chr.). Die in MAb 1,8f. aufgeführten Kernsprüche zeigen sie als abwägende Juristen, die sich vor allem im Zeugenrecht und im Umgang mit Beschuldigten durch Unvoreingenommenheit und Sorgfalt auszeichnen.
Dazu passt die von Simeon ben Shetach überlieferte Legende bSanh 37b, wonach er einen von einem einzigen Zeugen bei einem Mord Ertappten unter den Schutz des Gebotes des Doppelzeugnisses stellt. Ebenso liegt auf dieser Linie sein Eintreten nach bMakk 5b gegen seinen Jochgenossen, der einen Falschzeugen töten lassen will 1, wogegen Simeon ben Shetach die mäßigende Halacha betont.2
Der größere Block der mit Simeon ben Shetach verbundenen Tradition zeigt ihn jedoch als Eiferer, der mit der späteren Halacha, welche die Mischna im mäßigenden Sinne normiert, in Konflikt steht. Die literarisch älteste Berührung dieses Punktes begegnet MSanh 6,5, wo die Tat des Simeon ben Shetach, nämlich 80 Hexen auf einmal hingerichtet zu haben, als nicht der Halacha entsprechend bezeichnet wird.
Die Legende von Simeon ben Shetach und den 80 Hexen3 nennt im ältesten Stoff als Begründung für sein Vorgehen „die Stunde benötigte das“ (jSanh 6,9 23c).4 Sein Eifer ist nur durch die besondere Situation gerechtfertigt.
Nach bSanh 19a lädt er den König und Hohenpriester Alexander Jannäus – aufgrund des Vergehens eines seiner Knechte – als Mitangeklagten vor das Synhedrion und verlangt von ihm die Respektierung der göttlichen Autorität des Gremiums5 durch Aufstehen. Dies bedeutet, dass der Pharisäer für dieses Gremium, auch gegenüber dem König und in Konkurrenz zum Hohenpriester, das uralte Kultrecht der Repräsentation Gottes beansprucht. Alexander Jannäus verwendete nach einer anderen Legende (bKidd 66a) seinerseits gegen die Pharisäer die alte kultrechtliche Legitimationsform des auf dem Hochpriesterdiadem eingravierten Gottesnamens. Er verweigert das Aufstehen und befragt die übrigen pharisäischen6 Mitglieder des Gremiums. Als diese einer Entscheidung im Sinne des Simeon ausweichen, lässt dieser – so die Legende – den Himmel durch den Engel Gabriel eingreifen, der die Sanhedristen tötet. In diesem übertriebenen Eifer sieht die Gemara eine Bestätigung der mischnischen Halacha, die den König der irdischen Gerichtsbarkeit entzieht.
Dieser Eifer des Simeon ben Shetach entspricht der zugespitzten Situation einer verschärften Auseinandersetzung der Pharisäer mit den Hasmonäern unter Alexander Jannäus. Gegenüber dem machtpolitisch verkommenen Hochpriestertum und der sadduzäischen Partei will Simeon ben Shetach die Autorität der Leitung des Gottesvolkes auf das – pharisäisch besetzte7 – Synhedrion übertragen. Die Autorität der kultrechtlichen Ordnung des Gottesvolkes hängt nach seinem Anspruch nicht mehr am Hohenpriester, der sich des Gottesnamens zu Unrecht bedient, sondern am Synhedrion, das die Gottheit repräsentiert. Bezeichnend ist, dass die Tradition mit dem Wirken des Simeon ben Shetach den Anspruch verbindet, die segnende Kraft, die traditionell vom Kultus ausgeht, wieder hergestellt zu haben:
„‚Ich gebe euch Regen zu ihrer Frist‘ (Lev 26,4). ‚Zu ihrer Frist‘: in den Nächten der vierten Tage und in den Nächten der Sabbate.8 Denn so finden wir es in den Tagen des Simeon ben Shetach, in denen der Regen in den Nächten der vierten Tage und in den Nächten der Sabbate fiel, dass der Weizen wie Nieren, die Gerste wie Olivenkerne, die Linsen wie Golddinare wurden. Man bündelte davon zum Zeichen für zukünftige Geschlechter einiges ein, um ihnen zu weisen, wie viel die Sünde bewirkt. Wie gesagt ist (Jer 5,25): ‚Eure Verfehlungen haben dies nun verborgen, eure Versündigungen haben euch das Gute verwirkt‘. Und so finden wir es auch aus den Tagen des Herodes: als sie mit dem Bau des Heiligtums sich mühten, fiel der Regen in den Nächten, am Morgen aber wehte ein Wind, die Wolken zerstreuten sich und die Sonne erglänzte. Das Volk zog zu seiner Arbeit aus und wusste, dass es eine Himmelsarbeit in Händen habe.“ (bTaan 23a)
Der Tempel gibt Segen; wenn jemandes Wirken mit einer segnenden Kraft für ganz Israel verbunden ist, dann entsteht daraus die Frage, wie und ob dieses seinen Segen hervorbringendes Wirken mit dem Tempel zusammenhängt. Auf diese Frage gibt die Tradition eine deutliche Antwort: Simeon ben Shetach ist Reformer des Synhedrions, dessen eigenständiges Recht er gegen das verderbte Hochpriesteramt und Königtum durchsetzt. Während das üble Handeln des Alexander an den pharisäischen Weisen die Welt zum Veröden bringt, lässt Simeon ben Schetach sie wieder aufleben, indem er die Tora auf ihren Urstand zurückführt.9 Auch nimmt Schimon ben Shetach die klassische Aufgabe des Kultes wahr, Götzendienst und Zauberei zurückzudrängen. Entsprechend geht er nach der Tradition auch gegen ‚Choni der Kreiszieher‘ vor,10 der den Gottesnamen in einer der Magie verdächtigen Regenbeschwörung verwendet. In Choni begegnet ein ‚Konkurrent‘, der nicht wie die Pharisäer auf die rechtliche Grundlage des Kultes zurückgreift, sondern die in ihm liegende Macht zur Bestätigung der Schöpfungsordnung charismatisch verwendet.