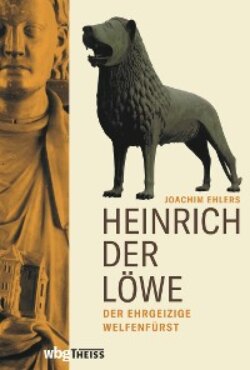Читать книгу Heinrich der Löwe - Joachim Ehlers - Страница 13
Der Erbe und seine Leute Erste Jahre
ОглавлениеÜber Ort und Zeitpunkt der Geburt Heinrichs des Löwen haben wir nur wenige genaue Nachrichten. Er selbst hat gesagt, daß er in Schwaben geboren sei (se de Suevia oriundum),1 ob aber auf der Ravensburg, bleibt ungewiß. Wichtiger als der Ort ist ohnehin das Jahr, doch die widersprüchlichen Aussagen darüber erlauben nicht mehr als eine näherungsweise Bestimmung. Gerhard, Propst des zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel gelegenen Kanonissenstifts Steterburg, meldet Heinrichs Tod zu 1195 und fügt hinzu, daß der Herzog damals sechsundsechzig Jahre alt gewesen sei, anno aetatis suae LXoVIo sei er gestorben.2 Demnach dürften wir das Geburtsjahr auf 1129/30 ansetzen, denn Gerhard von Steterburg gehörte in den späten Jahren zum engeren Hofkreis und sollte es eigentlich gewußt haben. Wenn seine Angabe richtig ist, wäre Heinrichs Mutter Gertrud bei der Geburt ihres Sohnes erst vierzehn oder fünfzehn Jahre alt gewesen, ein früher, aber biologisch möglicher Zeitpunkt und insofern kein Argument gegen die Nachricht des Propstes. Einwände ergeben sich eher aus den Weingartener Annalen, die im allgemeinen zuverlässig sind und von der Taufe Heinrichs zu Pfingsten 1135 berichten. In eben dieses Jahr setzte der Annalist allerdings auch den zweiten Italienzug Lothars III., der jedoch erst im August 1136 begonnen hat,3 so daß wir uns für den Tauftermin nicht klar zwischen 1135 und 1136 entscheiden können. Immerhin widerspricht diese Notiz der Zeitangabe Gerhards von Steterburg insofern, als es seit dem Frühmittelalter wegen der hohen Säuglingssterblichkeit üblich war, Neugeborene möglichst sofort zu taufen, um ihre Seele rasch vom peccatum originale, von der Ursünde, zu reinigen.4 Zwar gibt es Ausnahmen – Kaiser Friedrich II. wurde am 26. Dezember 1194 geboren, aber frühestens im November 1196 getauft5 –, doch erscheint eine Frist von fünf bis sechs Jahren zwischen Geburt und Taufe Heinrichs des Löwen zu lang. Der daraus folgende Widerspruch zwischen den Angaben der beiden Texte läßt sich nicht sogleich beseitigen, aber ein Blick auf die Überlieferung kann ihm die Schärfe nehmen.
Die Chronik Gerhards von Steterburg ist weder original noch mehrfach überliefert, sondern einzig in einer bald nach 1300 entstandenen Sammelhandschrift, die den Text wahrscheinlich nicht aus dem Original kopierte und erkennbare Ergänzungen der Fassung Gerhards zeigt. Wir können deshalb nicht ausschließen, daß es sich bei der Altersangabe in der Sammelhandschrift um einen Irrtum des Kopisten oder bei der Zahl LXVI um eine Verschreibung aus ursprünglich LXIII handelt, Propst Gerhard also ein Geburtsjahr 1132/33 vorausgesetzt hat.6 Diese Annahme wird durch Aussagen guter Kenner Heinrichs des Löwen gestützt. Die Chronisten Helmold von Bosau und Otto von Freising stimmen darin überein, daß er beim Tod seines Vaters am 20. Oktober 1139 noch ein jüngeres Kind gewesen ist, denn keiner der beiden Autoren hätte einen damals Neunjährigen als »Knäblein« (puer infantulus) oder einfach als »sehr klein« (parvulus) bezeichnet.7 Im selben Zeithorizont bewegt sich auch die Braunschweigische Reimchronik aus dem späten 13. Jahrhundert, wenn sie sagt, daß Heinrich der Löwe seinen Vater als Fünfjähriger verloren habe;8 weil sie diesen Tod auf 1141 datiert, käme man für das Geburtsjahr Heinrichs des Löwen zwar auf 1136, es könnte aber ebensogut sein, das dessen Lebensalter richtig und nur das Todesjahr des Vaters falsch angegeben ist, so daß sich ein weiterer Hinweis auf die Zeit um 1134 ergäbe, auf keinen Fall aber ein Indiz für 1130.
Im Mai 1142 dürfte Heinrich der Löwe noch unmündig, also weniger als zwölf Jahre alt gewesen sein, denn damals verzichtete er nicht selbständig, sondern nach dem Rat seiner Mutter (consilio matris) auf das Herzogtum Bayern;9 auch am 3. September 1142 sind in einer Urkunde des Erzbischofs von Bremen die Mutter und ihr junger Sohn als gemeinsam Handelnde bei einem Rechtsgeschäft genannt, »Herzogin Gertrud und ihr Sohn Heinrich, der knabenhafte Herzog der Sachsen« (domina ducissa Gertrudis et filius suus H. puer dux Saxonum).10 Im Jahre 1144 war Heinrich »immer noch ein Knabe« (adhuc puer) und wurde auf dem Magdeburger Hoftag Konrads III. durch Vormünder (tutores) vertreten, während er auf dem königlichen Hoftag am 15. März 1147 in Frankfurt selbständig als »nunmehr Herangewachsener« (qui iam adoleverat) seinen Anspruch auf das dem Vater unrechtmäßig entzogene Herzogtum Bayern anmeldete und noch im selben Jahr Clementia von Zähringen heiratete.11 Genauere Hinweise lassen sich leider aus der Terminologie dieser Autoren nicht gewinnen. Zwar gibt es konventionelle Auffassungen, wonach die Kindheit (infantia) bis zum siebenten, das Knabenalter (pueritia) bis zum vierzehnten, die Jugend (adolescentia) bis zum achtundzwanzigsten Lebensjahr dauere, aber die Abweichungen sind generell so häufig, daß kein Text in dieser Hinsicht beim Wort genommen werden darf.12 Alle unsere Zeugnisse sprechen jedoch gegen ein Geburtsjahr 1130, im Kern ihrer Aussagen aber sehr für 1133/35, so daß wir damit rechnen sollten, daß Heinrich der Löwe um diese Zeit geboren ist.
Beim Tod seines Vaters, der in Königslutter zur Rechten Lothars III. bestattet wurde, wäre Heinrich der Löwe demnach zwischen vier und sechs Jahre alt gewesen, so daß Richenza in seinem Namen die Last der Verteidigung Sachsens gegen Albrecht den Bären und Konrad III. tragen mußte. Diese Herausforderung war groß, denn in einer Gesellschaft, die mehr von Menschen als von Institutionen bestimmt wurde, wirkte der Verlust starker Persönlichkeiten lange nach. Wenn die welfische Seite Heinrich den Stolzen lobte, so hatte sie jenseits ihrer subjektiven Überzeugung doch auch objektive Gründe dafür, und Heinrich der Löwe dürfte sich grundlegende Vorstellungen über fürstliches Verhalten schon als Kind aus den Erzählungen vom Vater und dessen Herrschaftsstil gebildet haben. Die Kaiserchronik, von Regensburger Klerikern während der vierziger Jahre des 12. Jahrhunderts in deutscher Sprache verfaßt, rühmte Heinrich den Stolzen ausführlich als den hervorragendsten weltlichen Fürsten seiner Zeit (er was der aller tiursten laien ainer/di der bî den zîten lebeten)13 und formulierte damit zum ersten Mal in Deutschland ein Herrscherlob, das nicht einem König, sondern einem Fürsten galt.
Kurz vor seinem Tod hatte Heinrich der Stolze den kleinen Sohn noch der Fürsorge der Sachsen empfohlen,14 und es gab in der Tat einen engen Kreis von Beratern und Bevollmächtigten, tutores, die im Namen des Kindes handelten. Mit ihrer Hilfe haben sich Richenza und Gertrud behauptet und die sächsische Herrschaftsbasis gesichert, die Lothar von Süpplingenburg seinem Schwiegersohn hinterlassen hatte. Sie bestand aus mehreren regionalen Schwerpunkten, in denen Güter und Rechte besonders stark konzentriert waren; der größte erstreckte sich zwischen den Flußläufen von Oker, Fuhse, Aller und Bode mit Braunschweig und Königslutter, gefolgt vom billungischen Zentralraum links von Elbe und Ilmenau nordwestlich von Lüneburg; auch an der oberen Leine, entlang der oberen Weser und südöstlich zwischen Wipper und Unstrut lagen Eigen- und Lehnsgut, Grafschafts- und Vogteirechte.15 Besondere Aufmerksamkeit mußte den Menschen gelten, denen die Verwaltung dieser Güter und Rechte anvertraut war, denn hier war vieles im Umbruch und wandelte sich rasch, oft zum Nachteil der Eigentümer. Verwalter von Grafschaften und Kirchenvogteien nutzten ihre Befugnisse im Gericht und beim Heer zum Aufbau eigener Gebietsherrschaften, wobei Vogteirechte besonders begehrt waren. Der Vogt sollte die ihm anvertrauten Klöster oder Stiftskirchen samt ihrem Besitz gegen Angriffe jeder Art schützen, ihnen den Frieden sichern und die weltliche Gerichtsbarkeit über die Bewohner ihrer Landgebiete ausüben. Im Gegenzug verlangte er dafür Abgaben und versuchte – oft mit Erfolg –, die Vasallen und Dienstleute der Kirchen als militärisches Potential für eigene Zwecke zu gebrauchen. Oft bauten Vögte ihre Burgen auf Kirchengut, und weil sie in den meisten Fällen das Amt an einen Sohn vererben durften, war die Kirchenvogtei eine zuverlässige Grundlage adliger Eigenherrschaft.
Das billungisch-süpplingenburgische Erbe Heinrichs des Löwen
Auf diese Weise haben schon zur Zeit der Billunger deren adlige Lehnsträger vielfach eigene Herrschaftsbezirke aufbauen können, vor allem im mittleren und oberen Wesergebiet, denn diese Räume lagen peripher zum billungischen Zentrum um Lüneburg. Zu diesen Vasallen gehörten die Grafen von Schwalenberg, die in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts Vizegrafen der Billunger geworden waren und später von den Northeimer Grafen die Vizevogtei über das Kloster Corvey erhielten; ferner die Grafen von Everstein nordöstlich von Holzminden und die ursprünglich aus dem Weserbergland stammenden Grafen von Roden im Raum Hannover. Lothar von Süpplingenburg hatte seinerseits die Grafen von Schauenburg aus ihrer Eigenherrschaft zwischen Weser, Steinhuder Meer und Deister als Grafen in Holstein-Stormarn eingesetzt, die Herren von Wölpe aus der Gegend von Nienburg als Grafen östlich der Weser im nördlichen Teil der Diözese Minden und die Herren von Blankenburg als Vizegrafen am Nordostharz. Das nordwestliche Harzvorland beiderseits der Oker war Reichslehen Lothars, und er setzte dort die Herren von Wöltingerode als Grafen ein; Reichslehen waren auch die Grafschaften Wernigerode, Scharzfeld, Ilfeld-Honstein und Rothenburg.
Wer die selbständige Ausweitung von Adelsherrschaft und die damit verbundene Gefahr der Entfremdung anvertrauten Gutes oder übertragener Rechte vermeiden wollte, durfte Besitz und Ämter möglichst keinem Adligen anvertrauen, sondern mußte auf Dienstleute zurückgreifen. Er rekrutierte sie aus der familia seiner Grundherrschaften, aus dem Kreis der unfreien Leute, die eben wegen ihrer Unfreiheit gehorsamspflichtig waren; im persönlichen Dienst in der Nähe des Herrn konnten sie sich durch Zuverlässigkeit und Kompetenz qualifizieren, so daß solcher Dienst gegenüber der Zwangsarbeit in den namenlosen Scharen feldbestellender Knechte eine wesentliche Statusverbesserung brachte. Erprobte Loyalität und Tüchtigkeit führten häufig dazu, daß die Herren das Recht zum Waffentragen aus eigener Machtvollkommenheit über die Schicht der Freien hinaus erweiterten und ihren unfreien ministeriales Pferde, Rüstung, Schwert und Schild übergaben, so daß sie als Reiterkrieger (milites) einen Dienst leisteten, für den bis dahin nur Adlige und freie Vasallen in Frage gekommen waren. Diese neue gesellschaftliche Gruppe der Ministerialen war seit dem 11. Jahrhundert schnell gewachsen. Gemäß ihrer Bestimmung für den Reiterdienst mit der Waffe waren sie tendenziell aggressiv und suchten ihren Vorteil als Angehörige einer leistungsbezogenen, den gesellschaftlichen Aufstieg anstrebenden Elite. Im Laufe weniger Generationen, die loyal dienten, konnten Ministerialenfamilien adelsgleiches Ansehen erwerben, und sie wußten sehr wohl, daß ihre Herren auf sie angewiesen waren. Deshalb mußten sie durch starke Autoritäten gezügelt werden, denn sie übernahmen möglichst viel an adliger Lebensform, um ihren Anspruch auf einen gehobenen Status öffentlich zu demonstrieren.16
Von solchen Ministerialen hatte Lothar die süpplingenburgischen Hausgüter und das Erbe der Brunonen verwalten lassen. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehörten die Burghut und die Wahrnehmung damit verbundener Herrschaftsrechte im Burgbezirk, aber auch die Verwaltung der Vogtei süpplingenburgischer Eigenklöster wie St. Maria und Aegidius in Braunschweig oder Lothars Stiftung Königslutter. Diesem Kloster hatte die Kaiserin Richenza nach dem Tod ihres Gemahls, aber noch zu Lebzeiten Heinrichs des Stolzen (also nach dem 4. Dezember 1137 und vor dem 20. Oktober 1139) eine Schenkung gemacht, die von einer Reihe geistlicher und weltlicher Zeugen bestätigt wurde.17 Unter ihnen waren sechs Männer, die wir später immer wieder in der nächsten Umgebung Heinrichs des Löwen treffen werden: Anno von Heimburg, Liudolf und Balduin von Dahlum, Gerhard, Heinrich von Weida, Poppo von Blankenburg. Anno hatte seinen Herkunftsnamen von der Heimburg nordwestlich Blankenburgs am Harz; sie gehörte zu den modernen Höhenburgen, die Heinrich IV. angelegt hatte, war aber im Sachsenkrieg 1073 zerstört worden. Lothar von Süpplingenburg hatte sie später wieder aufgebaut und Anno übergeben, der zum Jahre 1134 als Kämmerer (cubicularius) des Kaisers bezeugt ist, als Inhaber eines Hofamtes.18 Liudolf gehörte einer Familie an, die möglicherweise aus der brunonischen Ministerialität an Lothar von Süpplingenburg gekommen ist; seit 1129 tritt er in Königsurkunden Lothars mit dem Herkunftsnamen de Dalem auf, das heutige Groß-Dahlum im Kreis Wolfenbüttel. Diese Nennung ist zugleich der früheste Beleg für einen Herkunftsnamen bei sächsischen Ministerialen in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, so daß Liudolf eine herausgehobene Stellung gehabt haben dürfte. In der Tat ist er 1134 und danach mehrfach als advocatus bezeugt,19 als Vogt von Braunschweig. Dieses Amt übernahm zur Zeit Heinrichs des Löwen Liudolfs Sohn Balduin, der ebenfalls schon als Zeuge bei der Schenkung Richenzas mitgewirkt hat, ebenso wie Gerhard, der als Vogt von Königslutter bis 1153 in der Umgebung Heinrichs des Löwen nachweisbar ist.20 Heinrich von Weida sollte einer der bedeutendsten Ministerialen Heinrichs des Löwen werden; er ist wahrscheinlich schon durch Lothar oder Richenza mit Dienstgütern ausgestattet worden. Unter den Zeugen der Schenkung Richenzas steht Heinricus gleich hinter Anno (von Heimburg) an zweiter Stelle unter den Ministerialen; das ist gewiß Heinrich von Weida, der so angesehen war, daß er 1143 als einziger seiner Standesgenossen in der Umgebung der Herzogin Gertrud und ihres jungen Sohnes namentlich erwähnt ist, noch dazu vor den Grafen Ludwig von Lohra und Poppo von Blankenburg.21 Bis 1180 gehörte er zu den Großen am Hof Heinrichs des Löwen, und er wird uns noch oft begegnen. Der edelfreie Poppo von Blankenburg gehörte sehr wahrscheinlich zur Verwandtschaft Lothars von Süpplingenburg und ist als Graf erstmals 1128 bezeugt; er amtierte im Harzgau in einer wahrscheinlich von Lothar selbst eingerichteten Grafschaft22 und hält sich später bis 1163 in der Umgebung Heinrichs des Löwen. Noch ein weiterer Ministeriale ist hier zu nennen, Berthold, den wahrscheinlich schon Lothar von Süpplingenburg als Graf in Peine östlich von Hannover eingesetzt hat und der bis 1156 am Hof Heinrichs des Löwen begegnet.23
Alle diese Herren hatten Verdienste, Stellung und Ansehen schon vor der Geburt Heinrichs des Löwen erworben;24 wir können natürlich nicht behaupten, daß allein sie während der Minderjährigkeit und vor allem in den Jahren nach dem Tod Richenzas († 10. Juni 1141) und Gertruds († 18. April 1143) seine Interessen vertreten haben, aber die oft erwähnten tutores können nur aus dem Kreis dieser altgedienten und erprobten Leute Lothars gekommen sein, zumal es auch anderswo vorkam, daß ein Hof nach dem Tod seines Herrn dessen Rechte gleichsam treuhänderisch wahrnahm und politische Kontinuität sicherte.25 Für die Bildung der Persönlichkeit Heinrichs des Löwen dürfte der frühe Umgang mit diesen erfahrenen und selbstbewußten Ministerialen nicht ohne Folgen geblieben sein, mochten sie durch ihr Auftreten nun eigene Erinnerungen an den Vater wecken, zeitweise an seine Stelle treten oder als Vorbilder praktische Handlungsanweisungen für die Zukunft vermitteln. Der frühe Tod des Vaters förderte jedenfalls Einsicht in die Bedeutung des Hofes für Erhalt und Ausüben der Herrschaft, weckte den Willen zur Selbstbehauptung, sozialisierte das Kind in einer Zeit erst rudimentär entwickelter öffentlicher Sicherheit und Ordnung im Kreis erfolgsorientierter, Rechte und Rechtsansprüche notfalls gewaltsam durchsetzender Reiterkrieger, lehrte Härte und Drohgebärde als politische Mittel schätzen. Sehr wahrscheinlich war Heinrich der Löwe später nicht brutaler als andere, aber wohl nicht zufällig meinte Burchard von Ursberg im frühen 13. Jahrhundert besonders dessen Anhänger, wenn er den deutschen Fürsten generell vorwarf, ihren Willen ohne Gesetz und ohne Vernunft mit dem Recht schlechthin gleichzusetzen (more Teutonicorum sine lege et ratione voluntatem suam pro iure statuentes).26
Wir wissen nicht, wie Heinrich der Löwe als Kind und junger Mann unterrichtet wurde, welche Sprachen er lernte, ob er Lateinisch lesen oder gar schreiben konnte, wer ihn Reiten lehrte, mit zur Jagd nahm oder in den Gebrauch der Waffen und in die adligen Umgangsformen einwies. Zur Verständigung mit seiner unmittelbaren Umgebung brauchte er das Niederdeutsche, besonders in seiner ost- und westfälischen Form, und für die süddeutschen Regionen das Bairische und Alemannische, dazu für den Umgang mit der traditionell mehrsprachigen westeuropäischen Elite das Französische, doch es gibt keinerlei Hinweise, wann, durch wen und wo er die notwendigen Sprachkenntnisse erworben hat und wie weit sie gingen. Vermutlich lagen sie auf dem allgemeinen Niveau der Führungskräfte seiner Zeit, wobei wir auch das nicht so sicher bestimmen können, wie es wünschenswert wäre. Friedrich Barbarossa war »in seiner Muttersprache . . . sehr redegewandt, Lateinisch aber konnte er besser verstehen als sprechen«, während vom englischen König Heinrich II. gesagt wurde, daß er zwar »eine gewisse Kenntnis aller Sprachen zwischen dem französischen Meer und dem Jordan« gehabt, aber »nur Latein und Französisch« gesprochen hätte (linguarum omnium que sunt a mari Gallico usque ad Iordanem habens scienciam, Latina tantum utens et Gallica).27 Außergewöhnliche Sprachkenntnisse weltlicher Fürsten sind meist auf eine abgebrochene Klerikerkarriere zurückzuführen, so bei Graf Adolf II. von Holstein, der die welfische Sache im Land nördlich der Elbe mehr als dreißig Jahre lang zuverlässig vertreten hat und bis zu seinem Tod im Jahre 1164 einer der wichtigsten Berater Heinrichs des Löwen gewesen ist. Als zweitgeborener Sohn hatte er eine wissenschaftliche Ausbildung begonnen, doch als sein älterer Bruder auf dem Böhmenfeldzug Lothars III. im Jahre 1126 fiel, mußte Adolf die Grafschaft übernehmen, »ein kluger, kirchlich wie weltlich höchst geschäftskundiger Mann, denn er beherrschte nicht nur das Lateinische und Deutsche, sondern auch die slawische Sprache«.28 Diese spezielle und im allgemeinen Bildungskanon ungewöhnliche Kenntnis des Slawischen deutet darauf hin, daß Adolfs Studien auf die Mission angelegt waren, und bestätigt die Regel, daß der Erwerb von Sprachkenntnissen sich nach praktischen Bedürfnissen richtet.
Der Vater hatte Heinrich dem Löwen keines seiner beiden Herzogtümer hinterlassen können, sondern nur einen anfechtbaren Anspruch, den in Sachsen Heinrichs Großmutter Richenza und seine Mutter Gertrud sehr erfolgreich vertreten haben.29 Am 1. November 1139, sogleich nach dem Tod Heinrichs des Stolzen, wollte Albrecht der Bär zum ersten Mal öffentlich als Herzog von Sachsen auftreten und hatte sich dafür die Stadt Bremen ausgesucht, weil dort zum Allerheiligenfest ein großer Markt abgehalten wurde, der viele Menschen aus dem gesamten Umland anzog. Dies schien ihm der geeignete Rahmen, um sein erstes Herzogsgericht abzuhalten, aber in der Volksmenge waren die Anhänger Richenzas so stark vertreten, daß ein Tumult ausbrach und Albrecht nur durch rasche Flucht der Gefangenschaft entging. Auch später sollte er sich nicht durchsetzen, denn Pfalzgraf Friedrich von Sommerschenburg, Graf Rudolf von Stade und Erzbischof Konrad von Magdeburg führten die militärischen Operationen gegen ihn so erfolgreich, daß sie zuletzt sogar noch die Nordmark und das askanische Kernland eroberten. Nachdem sie Albrecht aus Sachsen vertrieben hatten (patria eliminaverunt),30 mußte dieser sich nach Süddeutschland zum König begeben, doch auch Konrad III. konnte den Konflikt nicht in Albrechts Sinne regeln, weil keiner der weltlichen Großen Sachsens auf den dafür anberaumten Hoftagen im Februar und im April 1140 erschien.
Viel besser stand es um die königliche Sache auch in Bayern nicht, denn dort trat sofort nach dem Tod Heinrichs des Stolzen dessen Bruder Welf VI. als legitimer Erbe auf, erhob Anspruch auf die Vormundschaft für Heinrich den Löwen und behauptete, »daß das Herzogtum Bayern nach Erbrecht ihm gehöre, und weil er beim König sein Recht nicht finden konnte, rüstete er sich zum bewaffneten Widerstand«.31 Diese Fehde führte er gewiß nicht stellvertretend für Heinrich den Löwen, denn er hatte einen Sohn und sah die Chance zur Stärkung der eigenen Unabhängigkeit vom schwäbischen und – falls er diesen Rang nicht selbst erreichen würde – vom bayerischen Herzog. Als Treuhänder seines Neffen verfügte er jetzt auch über dessen schwäbische Güter und nutzte sie zumindest vorläufig für eigene Zwecke. Im August 1140 siegte er bei Valley im Mangfalltal über den Babenberger Leopold und provozierte damit einen Gegenstoß Konrads III. ins Schwäbische, den der König zusammen mit seinem Bruder Herzog Friedrich II. von Schwaben durch die Belagerung der Burg Weinsberg bei Heilbronn einleitete. Das Unternehmen zog sich lange hin, und Konrad mußte am 21. Dezember erst ein überlegenes Entsatzheer Welfs VI. besiegen, ehe die Burgleute kapitulierten. In der Kölner Königschronik wird dazu die rührende Geschichte über die Frauen von Weinsberg erzählt, denen Konrad freien Abzug gewährte und noch dazu erlaubte, so viel von ihrer Habe mitzunehmen, wie sie auf den Schultern tragen könnten. Als die Frauen daraufhin ihre Männer herausschleppten, habe Konrad sie gegen den Einspruch seines Bruders gewähren lassen, denn »es gehört sich nicht, an einem Königswort herumzudeuteln« (regium verbum non decere immutare).32 Das ist sehr wahrscheinlich eine Sage, schon wegen des hier vorausgesetzten und ganz unüblich hohen Frauenanteils einer Burgbesatzung, und man kennt aus verschiedenen Zeiten und Gegenden nahezu dreißig Erzählungen von ähnlichen Situationen. Immerhin zeigt die Geschichte einerseits die Grausamkeit des Belagerungskrieges mit Tötung der Besiegten und Ausplünderung, andererseits die unbeirrbare Großmut, die man vom König auch in solcher Lage gern erwarten wollte.
Dem sächsischen Hof war klar, daß der König trotz des Sieges bei Weinsberg mit seinen Verfügungen über Sachsen und Bayern in beiden Herzogtümern gescheitert war. Auch der Tod Richenzas, die am 10. Juni 1141 starb und in Königslutter neben Kaiser Lothar und Heinrich dem Stolzen beigesetzt wurde, schwächte den sächsischen Widerstand nicht. Als noch dazu die bayerische Frage durch den Tod Leopolds IV. am 18. November 1141 neu aufgeworfen wurde, entschied der König zunächst nichts, sondern belehnte Leopolds Bruder Heinrich nur mit der Mark Österreich. Die Fronten waren verhärtet, und eine Lösung schien denkbar fern, bis Erzbischof Markolf von Mainz einen Ausgleich vermittelte, der im Mai 1142 auf dem Frankfurter Hoftag Konrads III. beschlossen wurde. Albrecht der Bär wurde in seinen früheren Rechten und Besitzungen als Graf von Ballenstedt und Markgraf der Nordmark bestätigt, mußte aber auf die Herzogswürde in Sachsen verzichten, so daß Heinrich der Löwe damit belehnt werden konnte. Das bayerische Problem sollte durch eine Verbindung der welfischen mit der babenbergischen Familie gelöst werden, indem Heinrichs des Stolzen Witwe Gertrud, nach Richenzas Tod für ihren unmündigen Sohn Repräsentantin des Hauses in Sachsen, den Markgrafen Heinrich II. von Österreich heiratete, den Bruder des ein halbes Jahr zuvor verstorbenen Leopold IV., Halbbruder Konrads III. und seit dem Ende des 13. Jahrhunderts durch den Beinamen Ioch so mir got, »Jasomirgott«, als frommer Mann geehrt. Ihm gedachte Konrad das Herzogtum Bayern zu geben und durch Heinrichs Ehe mit Gertrud möglichen Ansprüchen Heinrichs des Löwen für die Zukunft vorzubeugen.33 Der König selbst hat die zwei Wochen dauernden Hochzeitsfeierlichkeiten in Frankfurt ausgerichtet und bezahlt.
Wahrscheinlich ist damals außer Heinrich dem Löwen auch seine Mutter Gertrud mit dem sächsischen Dukat belehnt worden, denn in zwei Urkunden der Erzbischöfe Markolf von Mainz und Adalbero von Bremen aus dem Jahr 1142 wird sie als regierende Herzogin angesprochen, totius Saxonie ducissa (»Herzogin ganz Sachsens«) oder domina ducissa (»die Herrin Herzogin«).34 Für deutsche Verhältnisse ist das ungewöhnlich, weil dabei die Anerkennung der weiblichen Lehnserbfolge vorausgesetzt wurde, aber der König brauchte diesen Rechtsweg für seinen Zugriff auf Sachsen und erinnerte sich vielleicht an das Projekt einer Doppelbelehnung Heinrichs des Stolzen und Gertruds mit den Mathildischen Gütern aus dem Jahr 1133. Worauf seine Pläne im einzelnen hinausliefen, zeigte sich alsbald beim Goslarer Hoftag im Januar 1143 und auf den folgenden Stationen des Königs in Sachsen. In Gegenwart vieler sächsischer Großer und vielleicht sogar nach Absprache mit ihnen verzichtete Heinrich der Löwe in Goslar consilio matris (»auf den Rat seiner Mutter«)35 als ihr Sprachrohr im Vollzug der Frankfurter Abreden auf Bayern, so daß Heinrich Jasomirgott sogleich damit belehnt werden konnte. Von Goslar zog Konrad nach Hildesheim weiter und erreichte dort mit Hilfe staufischer Sympathisanten im Domkapitel die Wahl seines Halbbruders Konrad von Babenberg zum Dompropst und damit auch zum Archidiakon von Goslar, denn seit salischer Zeit wurden beide Ämter stets in Personalunion wahrgenommen. Konrad war bereits Dompropst in Utrecht und Mitglied des Kölner Domkapitels, übte das Hildesheimer Amt aber von seiner Wahl an tatsächlich aus und gab es 1148/49 an Rainald von Dassel weiter, den späteren Kanzler Friedrich Barbarossas und seit 1159 gewählten Erzbischof von Köln.36 Ende Januar erschien der König schließlich in Braunschweig, wo er »von den Einwohnern prächtig empfangen und von der Herzogin Gertrud großzügig geehrt« wurde (ab incolis gloriose suscipitur, atque munificentia ducisse Gertrudis honoratur).37
Deutlich ist die Absicht erkennbar, in Sachsen Präsenz zu zeigen und staufisch-babenbergische Stützpunkte zu bilden; im Sinne dieser Ziele leitete Heinrich Jasomirgott aus seiner Rechtsstellung als Ehemann Gertruds eigene Befugnisse in sächsischen Angelegenheiten ab, denn im Frühjahr 1143 beurkundete er eine Schenkung der Herzogin und ihres Sohnes an das Kloster Homburg bei Langensalza.38 Bald nach dem Tag von Goslar demonstrierte der Babenberger damit seinen Willen zur Mitsprache, und dieser Wille schien mittelfristig durchsetzbar, denn Gertrud handelte als Regentin Sachsens durchaus anders als ihre Mutter Richenza. Im Land Wagrien nördlich der Elbe setzte sie als Graf Heinrich von Badwide ein, einen Mann Albrechts des Bären, um Adolf II. von Schauenburg zu schaden, der seit 1130 im Auftrag Lothars von Süpplingenburg die Grafschaft Holstein innehatte und sich nach 1138 standhaft weigerte, Albrecht den Bären als Herzog von Sachsen anzuerkennen. Helmold von Bosau verknüpft diese erstaunliche Handlungsweise Gertruds, die einen loyalen Vertreter der welfischen Sache so sichtbar desavouierte, zeitlich mit der Frankfurter Belehnung Heinrichs des Löwen,39 so daß auch ein sachlicher Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen nicht ausgeschlossen werden kann: In der nördlichen Missions- und Expansionszone des sächsischen Dukats sollte eine Stütze des staufischen Königs aufgerichtet werden. Wenn Gertrud an der Seite ihres zweiten Gemahls dessen Auftreten in Sachsen erkennbar billigte, so legitimierte sie es gegenüber den sächsischen Großen, deren Loyalität primär ja nicht den Welfen, sondern der süpplingenburgischen Familie galt. Es darf nicht vergessen werden, daß die Welfen erst durch Heinrichs des Schwarzen Einheirat in die Familie der Billunger sächsischen Besitz erworben hatten und im Land über lange Zeit kaum wahrgenommen wurden. Heinrich der Schwarze ist wahrscheinlich niemals dort gewesen, Heinrich der Stolze zu Lebzeiten seines Schwiegervaters nur einmal, im Jahre 1134, und dann erst wieder in der kurzen Zeit vor seinem Tod. In Braunschweig, Lüneburg und Königslutter gedachte man der Brunonen, der Billunger, der Süpplingenburger und schloß die welfischen Ehemänner der sächsischen Erbtöchter erst sekundär in die Memoria ein.40 Ob sich die Akzeptanz der sächsischen Großen und vor allem der Ministerialität von Richenza und ihrer Tochter dauerhaft auf Heinrich den Löwen übertragen würde, war nach Gertruds Heirat und den erfolgreichen Ansätzen Konrads III. in Sachsen zumindest ungewiß. Sollte Gertrud ihrem zweiten Gemahl einen Sohn oder gar mehrere gebären, würde der König über kurz oder lang einen Anlaß zur Revision der Frankfurter Belehnung Heinrichs des Löwen finden, ebenso rasch wie dieser sich vier Jahre nach seiner Goslarer Verzichtserklärung auf Bayern nicht mehr daran gebunden fühlte und später schmerzlich erfahren sollte, wie schnell und unsentimental vermeintlich altbewährte Ministerialen zum stärkeren Herrn überliefen. Hätte man ihn im Falle eines erfolgreichen königlichen Zugriffs auf Sachsen mit Teilen des billungischen Erbes abgefunden oder auf seine schwäbischen Güter in den Schatten Welfs VI. zurückgeschickt? Es war damals keineswegs sicher, daß die Nachwelt jemals an Heinrichs Biographie Interesse haben würde.
Alle diese Pläne, Verabredungen und Kombinationen wurden jedoch mit einem Schlage hinfällig. Im Frühjahr 1143 reiste Gertrud nach Bayern ab und starb wohl noch unterwegs am 18. April, ihrem achtundzwanzigsten Geburtstag, an den Folgen der schweren Geburt einer Tochter, die ihre Mutter überlebte.41 Mit dem Ende des babenbergisch-süpplingenburgischen Heiratsbundes war dem Frankfurter Kompromiß seine Grundlage entzogen und der Handlungsspielraum des staufischen Königs in Sachsen erheblich reduziert. Mühsame Versuche zur Gewinnung sächsischer Verbündeter hatten später nur mäßigen Erfolg und waren für die anstehenden Konflikte ohne Bedeutung. Der Tod seiner Mutter hat Heinrich dem Löwen wenn schon nicht die Herrschaft gerettet, so doch schwere Kämpfe erspart.