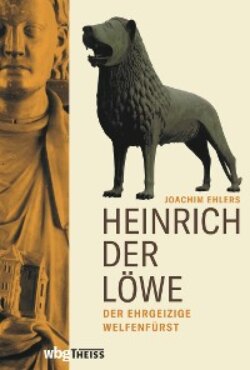Читать книгу Heinrich der Löwe - Joachim Ehlers - Страница 16
Nordöstlicher Kreuzzug
ОглавлениеDas Auftreten der Prämonstratenser in Magdeburg und Jerichow war die Folge einer neuen Frömmigkeitsbewegung, die sich seit Anfang des 12. Jahrhunderts von Frankreich ausgehend nach Osten verbreitet hatte. Hervorgegangen aus einer Klerikergemeinschaft, die Norbert von Xanten 1120 in Prémontré bei Laon um sich versammelt hatte, wollten die nach dem Gründungsort Prämonstratenser genannten Chorherren ihre Vorstellungen vom gemeinsamen Leben der Urkirche verwirklichen und richteten sich dabei nach konkreten Forderungen wie Gebet, Schweigen, Handarbeit und Fasten. Norbert gründete weitere Gemeinschaften, reformierte bestehende in seinem Sinne und versuchte, mit der Autorität eines hohen geistlichen Amtes seine Ziele durchzusetzen. Im Jahre 1126 wurde er Erzbischof von Magdeburg, aber die entscheidende Arbeit an der Organisation leistete Hugo von Fosse in Prémontré, indem er eine schriftlich fixierte Verfassung, die einheitliche Liturgie für alle Häuser und ein hierarchisches System der disziplinarischen Aufsicht vorgab. Dadurch entstand ein wohlorganisierter Orden, in dem Magdeburg eine Sonderstellung einnahm, weil das Marienstift seit 1129 weitere Häuser gründete und mit ihnen einen Sonderverband bildete, der anfangs vor allem im Bistum Havelberg Missionsarbeit leisten sollte.62
Ihr Organisations- und Kontrollschema hatten die Prämonstratenser von einem Reformzweig der Benediktiner entlehnt, dessen erste Niederlassung südlich von Dijon in Cîteaux begründet worden war. Auch diese neue Gemeinschaft der Zisterzienser hatte ihren Namen vom Gründungsort, forderte strengste Armut und Weltabgeschiedenheit, hatte aber gerade wegen ihrer rigorosen Lebensführung großen Zulauf, der seit dem Eintritt des charismatischen Bernhard von Clairvaux 1112 rasch zu so großer Verbreitung über ganz Europa führte, daß bei Bernhards Tod im Jahre 1153 im Gebiet der lateinischen Christenheit schon 350 Zisterzienserklöster bestanden. Das Filiationsprinzip hielt die Expansion in geregelten Bahnen, indem Cîteaux als aufsichtführendes Mutterhaus für die von dort aus gegründeten Tochterklöster verantwortlich war und Gründungen der Töchter jeweils diesen unterstellt wurden. Die einzelnen Häuser des Ordens sollten ihren Lebensunterhalt selbst erarbeiten und entwickelten dafür effektive Formen des landwirtschaftlichen Großbetriebs mit marktorientierter Produktion, so daß sie sowohl für die Erschließung neuer Siedlungsgebiete als auch für die Verbindung ländlicher und städtischer Wirtschaft hervorragend geeignet waren. Ordensmitglieder erlangten bedeutende Kirchenämter, und 1145 bestieg einer der Ihren, Schüler Bernhards von Clairvaux, als Eugen III. den päpstlichen Thron.
In eben diesem Jahr 1145 erreichte der zisterziensische Impuls die nächste Umgebung Heinrichs des Löwen. Damals schenkte sein Ministeriale Liudolf von Dahlum dem Orden Güter in Riddagshausen nahe Braunschweig, brachte den Herzog im folgenden Jahr dazu, dieser Grundausstattung für ein neues Kloster weiteres Land hinzuzufügen, und trat selbst als Laienbruder (conversus) dort ein.63 Diese Initiative gehört in den größeren Zusammenhang einer Bewegung, die seit dem ersten Viertel des 12. Jahrhunderts immer mehr Mitglieder des weltlichen Adels erfaßte und sie bewog, neue Klöster oder Stifte zu gründen und in letzter Konsequenz des Respekts vor der monastischen Lebensform selbst dort einzutreten. Diese neuartige Sensibilität adliger Laien für Spritualität und persönliche Verantwortung in Glaubensfragen hatte sich aus der Erschütterung hergebrachter Ordnungsvorstellungen seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts gebildet, aus dem Erlebnis der Kämpfe um die Erneuerung der Christenheit und die Begrenzung weltlichen Einflusses auf die Kirche. Insofern war die Gründungsinitiative Liudolfs von Dahlum an sich weder neu noch ungewöhnlich, das Besondere lag vielmehr darin, daß ein unfreier Dienstmann als Stifter auftrat und damit etwas tat, was jahrhundertelang nur der Adel und die Könige getan hatten. Liudolfs selbstbewußte Nachahmung (imitatio) adliger Lebensform gehörte zum Weg nach oben, den diese älteren Ministerialenfamilien schon lange eingeschlagen hatten.
Wie weit mag Heinrich der Löwe vom Abschied eines seiner ältesten und bewährtesten Räte aus der Welt harter Entscheidungen und Konflikte berührt worden sein? Bezog er schon eine selbständige Position gegenüber einer solchen Konversion, möglicherweise unter dem Eindruck der seit 1145 laufenden Vorbereitungen für einen neuen Kreuzzug, den Bernhard von Clairvaux Anfang November 1146 auch in Deutschland zu predigen begann? Immerhin hatte sein Großvater Lothar III. gute Beziehungen zu den Zisterziensern und zu Bernhard von Clairvaux gehabt, unter dessen Einfluß er wichtige Entscheidungen traf; Lothar hat 1137 die erste Urkunde eines deutschen Königs für Zisterzienser ausgestellt,64 doch über entsprechende Einstellungen und Verbindungen des jungen Herzogs wissen wir nichts. Selbständigkeit zeigte er zum ersten Mal auf einem ganz anderen Feld, als er vor dem Frankfurter Hoftag Konrads III. am 15. März 1147 das seinem Vater zu Unrecht aberkannte Herzogtum Bayern persönlich zurückforderte.65
Der Zeitpunkt für diese Initiative war gut gewählt. Konrad hatte an Weihnachten 1146 selbst das Kreuz genommen und mußte den Frankfurter Tag zur Vorbereitung des Zuges nutzen, besonders aber für die vorsorgliche Wahl seines zehnjährigen Sohnes Heinrich zum König und Nachfolger für den Fall seines Todes auf der langen Reise. Wahrscheinlich wollte der Löwe seine Zustimmung von der Rückgabe Bayerns abhängig machen, wie er das später vor der Königswahl Friedrich Barbarossas getan hat, doch mit einiger Mühe ist es Konrad III. gelungen, die bayerische Frage bis zu seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land offenzuhalten. Während Welf VI. mit vielen anderen Fürsten dem König folgen wollte, eröffnete sich Heinrich dem Löwen eine ganz andere Möglichkeit, denn »die Sachsen, die ja noch heidnische Völker zu Nachbarn haben, wollten nicht in den Orient ziehen. Sie nahmen zwar auch das Kreuz, aber nur, um gegen eben diese Völker Krieg zu führen, und sie unterschieden sich von unseren Leuten dadurch, daß die Kreuze nicht einfach auf die Röcke genäht waren, sondern von einem daruntergelegten Kreis in die Höhe ragten.«66 Nicht die Sachsen freilich hatten die Idee zum Slawenkreuzzug entwickelt, sondern Bernhard von Clairvaux, dem in Frankfurt schnell klargeworden war, daß der Hinweis auf die heidnischen Nachbarn nur ein Vorwand war, um die moralische Pflicht zur Heerfahrt ins Heilige Land loszuwerden. Bernhard nahm die Sachsen jetzt beim Wort und verfaßte auf Beschluß des Hoftages einen Aufruf zum Kreuzzug gegen die Slawen, der den Teilnehmern dieselben Rechte versprach wie Kreuzfahrern ins Heilige Land und Verträge mit den Slawen untersagte, »bevor nicht mit Gottes Hilfe entweder der heidnische Kult (ritus) selbst oder das Volk (natio) zerstört ist«.67 Das ging sehr weit, war ein klarer Auftrag zur theologisch und kirchenrechtlich verpönten Gewaltmission. Nicht jeder mag sich den großen Zisterzienserabt als Haßprediger vorstellen, der die physische Vernichtung all jener forderte, die sich der Taufe widersetzten, deshalb versteht man den Satz gern so, daß sich nach Bernhards Meinung die gentilreligiösen Verbände der Slawen auflösen würden und damit ihre natio unterginge, sobald sie als Christen ihren hergebrachten ritus aufgegeben hätten.68 Der Abt von Clairvaux wußte aber nichts über die Verhältnisse im Land nördlich der Elbe und hörte in Frankfurt zum ersten Mal von der Existenz wirklicher Heiden inmitten der Christenheit; erschrocken forderte er ihr rasches Ende und wies mit dem Kreis unter dem Kreuz als Zeichen der sächsischen Kreuzfahrer auf die ganze Erde hin, von der nach seiner fester Überzeugung die Ungläubigen auszutilgen seien.69
Am 11. April genehmigte Papst Eugen III. den Slawenkreuzzug und bestimmte dafür den Bischof Anselm von Havelberg als seinen Legaten. Die Versammlung des Heeres, zu dem Heinrich der Löwe, Erzbischof Adalbero von Bremen und alle sächsischen Bischöfe gehörten, ferner Herzog Konrad von Zähringen, die Markgrafen Albrecht der Bär und Konrad von Wettin,70 ging nur schleppend voran, so daß den Slawen Zeit zur Vorbereitung blieb. Der Abodritenfürst Niklot ließ die Burg Dobin am Nordufer des Schweriner Sees zur Fluchtburg ausbauen und erinnerte den Grafen Adolf II. von Holstein an die zwischen ihnen seit 1143 bestehenden Freundschaftsbündnisse, als er ihn um Vermittlung bat. Adolf gehörte jedoch selbst zu den Kreuzfahrern und versprach Niklot nur, ihn rechtzeitig zu warnen. Im Grunde wollten beide nicht, was sie dann notgedrungen tun mußten. Am 26. Juli 1147 zerstörte Niklot die Siedlung und den Hafen Lübeck, anschließend griff er die von Adolf angelegten Kolonien der Westfalen, Holländer und Friesen an. Bald umlaufenden Gerüchten zufolge geschah das mit Einverständnis der Holsten, die in den von Adolf ins Land geholten Zuwanderern lästige Konkurrenten sahen.71 Das kann durchaus so gewesen sein, denn der Schlag gegen Adolfs Siedlungswerk sollte auch die ungeliebte Grafengewalt schwächen, ungewiß ist dagegen, ob Niklots Aktionen eine Antwort auf Bernhards Vernichtungsaufruf gewesen sind.
Später als vereinbart waren die sächsischen Kreuzfahrer in Magdeburg zusammengekommen, teilten sich dort in zwei Heeresgruppen auf und überschritten am 1. August die Elbe. Die größere Abteilung unter Führung Albrechts des Bären und Konrads von Meißen hatte den päpstlichen Legaten Anselm von Havelberg bei sich und zog gegen Vorpommern. Vergeblich und eher lustlos belagerte man Demmin, zog dann nach Stettin weiter, dessen Belagerung Bischof Adalbert von Pommern jedoch verhinderte, weil er sein bisher erfolgreiches Missionswerk nicht gefährden lassen wollte. So verhandelte man mit dem Fürsten Ratibor von Stettin über die weitere Mission und löste anschließend das Heer auf. Die kleinere Abteilung wandte sich unter Führung Heinrichs des Löwen, Konrads von Zähringen und Erzbischof Adalberos von Bremen gegen die Abodriten und vereinigte sich bei Dobin mit dänischen Kreuzfahrern. Auch hier wurde die Belagerung wenig energisch und kaum professionell betrieben, weil die Großen im Gefolge Heinrichs des Löwen sehr bald zu überraschend pragmatischen Einsichten kamen: »Ist es nicht unser Land, das wir verwüsten, und unser Volk, das wir bekämpfen? Warum verhalten wir uns wie unsere eigenen Feinde und vernichten unsere eigenen Einkünfte? Haben die Verluste keine Konsequenzen für unsere Herren?«72 Schnell führten diese Überlegungen zum Abbruch des Feldzuges, den man durch offensichtliche Scheintaufen gleichwohl als Erfolg stilisierte und damit genau so handelte, wie Bernhard von Clairvaux befürchtet hatte, als er Verträge mit den Heiden verbot.
Unter den Kreuzfahrern hatte sich als einziger süddeutscher Fürst Herzog Konrad von Zähringen der Heeresgruppe Heinrichs des Löwen angeschlossen und damit eine Tradition fortgesetzt, die Welfen und Zähringer schon früher zusammengeführt hatte. Eine Tochter Heinrichs des Schwarzen war mit Konrads Bruder Berthold III. verheiratet gewesen, und Heinrich der Löwe folgte den Spuren, als er Clementia von Zähringen zur Frau nahm, die Tochter Herzog Konrads. Das Ehebündnis, in das Clementia Burg und Herrschaft Badenweiler mit fünfhundert Hufen und hundert Ministerialen einbrachte, sollte die welfisch-zähringische Allianz gegen die Staufer bekräftigen und ist wahrscheinlich auf dem Slawenzug ausgehandelt worden, denn im November/Dezember 1147 machte Heinrich der Löwe dem Kloster Königslutter eine Schenkung für sein Seelenheil und das seiner Gemahlin.73 Aus der Ehe mit Clementia hatte er drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter. Der Erstgeborene, Heinrich, starb als Kleinkind in Lüneburg durch einen Sturz vom Wickeltisch und wurde an hervorgehobener Stelle beigesetzt, nämlich am Ort der Stiftergräber vor dem Kreuzaltar der billungischen Klosterkirche St. Michael; ihr schenkte der Vater als Seelgerätstiftung für sein Kind eine Wassermühle an der Ilmenau.74 Seither lebte Heinrich der Löwe ein rundes Vierteljahrhundert lang, bis 1173/74, ohne männlichen Erben und in der ständigen Sorge um den Fortbestand seines Hauses. Nach 1150 wurde Gertrud geboren, die in erster Ehe 1166 mit Herzog Friedrich IV. von Schwaben verheiratet wurde, dem Sohn König Konrads III., um in Schwaben Angehörige der großen Familien der Welfen, Staufer und Zähringer einander näher zu bringen. Schon im folgenden Jahr aber starb Herzog Friedrich in der Toskana an den Folgen der im deutschen Heer vor Rom ausgebrochenen Epidemie, und Gertrud blieb verwitwet, bis ihr Vater im Jahre 1171 mit König Waldemar I. von Dänemark einen Frieden schloß und die Ehe Gertruds mit dem dänischen Thronfolger Knut verabredete. Als Königin von Dänemark ist Gertrud am 1. Juli 1197 kinderlos gestorben. Ihre jüngere Schwester Richenza hat das Kindesalter nicht überlebt.75