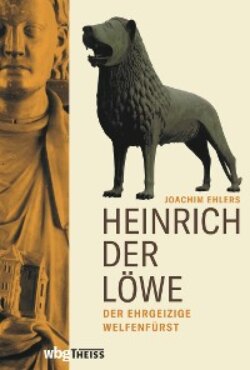Читать книгу Heinrich der Löwe - Joachim Ehlers - Страница 19
Italienzug
ОглавлениеSchon im September 1153 hatte Friedrich I. alle geistlichen und weltlichen Fürsten des Reiches durch Boten aufgefordert, sich mit ihren Aufgeboten zu Michaelis des folgenden Jahres, also am 29. September 1154, in Roncaglia nahe Piacenza einzufinden,27 doch erst Anfang Oktober 1154 sammelte sich das Heer auf dem Lechfeld bei Augsburg. Die Stärke der Kampftruppe läßt sich nicht genau bestimmen; zwar schrieb der König in einem Brief an Otto von Freising, daß er seine italienischen Siege mit nur tausendachthundert Rittern (milites) errungen habe,28 doch war das eher ein Hinweis auf seine Feldherrnkunst als eine Auskunft über die Zahl. Otto Morena, Konsul von Lodi und vorzüglich informierter Beobachter, sah Heinrich den Löwen »kaum weniger schwere Reiter (equites) als der Kaiser« nach Italien bringen;29 ob sie in der von Friedrich genannten Heeresstärke inbegriffen sind, läßt sich nicht mehr feststellen, aber gewiß hat von allen am Italienzug Beteiligten Heinrich dem König das größte Kontingent zugeführt: Sein Einsatz war hoch, denn Bayern hatte er noch nicht wiedergewonnen, mußte die bisherigen Leistungen Friedrichs – das Investiturrecht nördlich der Elbe, das Winzenburger Erbe, die Belehnung mit Goslar – kompensieren und um künftige Hilfe werben.
Vom Gefolge Heinrichs des Löwen, der seine Gemahlin Clementia als Regentin Sachsens zurückgelassen hatte, kennen wir die Grafen Adalbert von Wernigerode und Christian von Oldenburg, aus der sächsischen Ministerialität Liupold von Herzberg und aus der schwäbischen neben anderen den Vogt Adelgoz von Augsburg, den Marschall Hermann von Ravensburg, Konrad von Memmingen, Manegold von Otterswang, Adalbert von Rammetshofen, Meingoz von Reute, Heinrich von Stauf.30 Dieses Übergewicht der Schwaben entspricht allerdings nicht den tatsächlichen Verhältnissen, sondern ergibt sich aus den besonderen Bedingungen der Überlieferung: Die einzige vom Italienzug erhaltene Urkunde Heinrichs des Löwen war für das Stift Ittingen nordwestlich von Frauenfeld bestimmt, so daß als Zeugen der Rechtshandlung natürlich in erster Linie Schwaben aufgerufen worden waren. Wir dürfen nicht glauben, daß Heinrich im wesentlichen auf seine Ministerialen von den schwäbischen Gütern zurückgegriffen und die sächsischen geschont hat.
Der König führte das Heer über den Brennerpaß, die leichteste und deshalb seit den ostfränkischen Karolingern am häufigsten genutzte Verbindung durch die Ostalpen nach Italien. Die meisten Reiter im sächsischen Gefolge Heinrichs des Löwen kannten nur die norddeutsche Ebene und als höchste Erhebung den Harz: Waren sie beeindruckt, als sie sich den Hochalpen näherten, in sie einstiegen und auf der Südseite die ganz anders geartete Landschaft Oberitaliens erlebten, den »Garten der Wonnen« (deliciarum hortus), den Otto von Freising im landeskundlichen Italienexkurs zu seinem Bericht vom Romzug Friedrichs geschildert hat?31 Wir wissen nicht, was sie einander und zu Hause davon erzählt haben, denn niemand hat dergleichen aufgeschrieben.
Heinrich der Löwe hat auf diesem Feldzug nicht nur an die offiziellen Ziele des Königs und an das Wohl des Reiches gedacht. Er nutzte seinen Italienaufenthalt vielmehr auch dazu, jene Güter des Hauses Este für sich zu reklamieren, die sein Urgroßvater Welf IV. aus dem Nachlaß des Markgrafen Azzo II. erhalten hatte, die dann aber in den unsicheren Jahren nach dem Tod Heinrichs des Stolzen wieder vom Haus Este übernommen worden waren. Am 27. Oktober 1154 erschienen die beiden Markgrafen Bonifaz und Fulco von Este im Lager des Reichsheeres bei Povegliano in der Nähe von Verona, und man einigte sich dahingehend, daß Heinrich die Burg Este mit den Orten Solesino, Arqua und Merendola gehören sollte; sogleich hat er diese Objekte an Bonifaz, Fulco und ihre abwesenden Brüder Albert und Opizo samt allen Nachkommen in männlicher und weiblicher Linie als Lehen zurückgegeben.32 Damit hatte er sein Obereigentum gesichert, gleichzeitig jedoch Rechte seines Onkels Welf VI. mißachtet, von dem in der Urkunde keine Rede war; erst später muß es eine Absprache zwischen beiden gegeben haben, denn Anfang Januar 1160 investierte Welf VI. im kaiserlichen Lager vor Crema, in dem sich auch Heinrich der Löwe aufhielt, die Este-Brüder mit denselben Gütern, damit jetzt auch sein Recht als Miteigentümer öffentlich erklärt war.33 Heinrichs Insistieren auf diesen Rechtspositionen in Reichsitalien zeigt, daß er sich keineswegs allein auf Sachsen, Bayern und seine schwäbischen Güter konzentriert hat und deshalb auch nicht im nachhinein in dieser verengten Perspektive gesehen oder beurteilt werden darf. Sein Wirkungs- und Interessenfeld reichte wie das anderer großer Fürsten und Herren über die Region und Deutschland hinaus in den Raum des Imperiums; wie seine spätere zweite Ehe mit der englischen Königstocher Mathilde deutlich vor Augen führt, dachte und bewegte er sich im Geflecht weit ausladender Hochadelsverbindungen der westlichen Christenheit, die bis nach Byzanz und in die lateinischen Königreiche outre mer reichten, ins Heilige Land am Rande des östlichen Mittelmeers. Für die Repräsentanz der Welfen südlich der Alpen waren ihre italienischen Güter und Rechte wertvolle Grundlagen.
DER VERLAUF DES ITALIENZUGES 1154/55 ▸
Heinrich der Löwe hat sich ständig im Heer Friedrichs I. befunden; Orte, an denen er ausdrücklich als anwesend bezeugt ist, sind durch einen ausgefüllten Punkt (●) gekennzeichnet.
Augsburg, Brixen, Trient (Oktober 1154)
Gebiet von Verona (22. Oktober)
● Povegliano (26./27. Oktober)
● Gebiet von Brescia (19. November)
● Gebiet von Bergamo (23. November)
Gebiet von Lodi (28. bis 30. November)
● Roncaglia (30. November bis6. Dezember)
Gebiet von Mailand (7. bis 15. Dezember)
Gebiet von Novara (22. bis 25. Dezember)
Gebiet von Vercelli (Ende Dezember1154/Anfang Januar 1155)
● Casale Monferrato (3. Januar)
● Rivarolo Canavese (13. Januar)
Gebiet von Turin (nach dem 13. Januar)
Chieri (nach dem 13. Januar)
● Asti (1. Februar)
● Tortona (13./14. Februar bis 20. April)
Pavia (24. April)
Gebiet von Piacenza (Ende April)
Gebiet von Cremona (Anfang Mai)
● Gebiete von Parma undPiacenza (5. Mai)
● Gebiet von Modena (5. bis 13. Mai)
● Gebiet von Bologna(13. bis 15. Mai)
Gebiet von Florenz (nach dem 15. Mai)
● San Quirico (2. Juni)
● Tintignano (4. Juni)
Acquapedente (nach dem 4. Juni)
Grassano (8. bis 10. Juni)
● Rom (18./19. Juni)
Magliano (nach dem 19. Juni)
Farfa (nach dem 19. Juni)
Gebiet von Tivoli (28./29. Juni)
● am Monte Soratte (1. Juli)
● Gebiet von Tivoli (nach dem 7. Juli)
Spoleto (27./28. Juli)
Ancona, Senigallia, Fano, Pesaro, Ravenna (August)
Gebiet von Faenza (25. August)
Imola, Bologna, Mantua (nach dem 25. August)
● Gebiet von Verona (Anfang September)
● Trient (7. September)
Bozen,Brixen(7. bis 20. September)
● Peiting (20. September)
(RI 4,2.1, Nr. 239–360)
Weiter ging der Marsch über die Landgebiete von Brescia und Bergamo nach Roncaglia; dort lagerte das Heer vom 30. November bis 6. Dezember. Otto von Freising berichtet, daß Friedrich I. einen alten Brauch der deutschen Könige erneuerte, dem gemäß »an einem Mast ein Schild aufgehängt und durch einen Ausrufer (preco) des Hofes die Gruppe der Lehnsträger aufgefordert wird, in der nächsten Nacht beim König Wache zu halten. Ebenso machen es die Fürsten seines Gefolges, indem jeder von ihnen seine Vasallen durch Ausrufer vorlädt . . . Sämtlichen Vasallen, die ohne Erlaubnis ihrer Herren zu Hause geblieben sind, werden ihre Lehen entzogen.«34 In der Tat haben mehrere weltliche Herren, die bei der Heerschau als abwesend ermittelt worden waren, ihre Lehen verloren, besonderes Aufsehen erregte es jedoch, daß auch Erzbischof Hartwig von Bremen und Bischof Ulrich von Halberstadt von der Strafe betroffen waren, zwei Gegner Heinrichs des Löwen, die sich ihrer Pflicht entzogen hatten. Auf die gleiche Art hätte sich der Konflikt um das Herzogtum Bayern schnell und einfach lösen lassen, denn auch Heinrich Jasomirgott war nicht beim Heer erschienen, doch in seinem Falle wollte der König den Konflikt vermeiden und das Einvernehmen suchen.
Heinrich der Löwe hatte im Gefolge Friedrichs I. bisher erhebliche Förderung erfahren, doch dem Vorteil solcher Königsnähe standen Risiken gegenüber, die sich aus der zeitweiligen Ferne vom eigenen Herrschaftsgebiet ergaben. Besonders während der Italienzüge standen alle Großen des Reiches unter dieser Spannung von Gewinn und Gefahr, weil Feinde und Konkurrenten die voraussehbar längere Zeit der Abwesenheit leicht nutzen konnten. Das mußte auch Heinrich der Löwe erfahren, denn noch im Oktober/November nahm Erzbischof Hartwig von Bremen die Burgen Stade, Bremervörde, Harburg und Freiburg an der Oste, die Heinrich 1145 besetzt hatte, wieder ein und ließ sie gegen den Herzog befestigen. Bedenklicher als dieser örtlich begrenzte Angriff war allerdings ein Treffen ostsächsischer und bayerischer Magnaten im Böhmerwald, an dem möglicherweise Heinrich Jasomirgott teilnahm und zu dem auch Erzbischof Hartwig geladen war, denn dort schien sich eine breit angelegte Opposition zu formieren. Zwar verlegten Leute des Herzogs dem Erzbischof seinen Rückweg nach Bremen, so daß er fast ein Jahr in Ostsachsen bleiben mußte,35 das änderte aber nichts am beunruhigenden gegnerischen Potential, dessen wirkliche Stärke vorerst schwer abzuschätzen war, das sich jedoch alsbald wieder bemerkbar machen sollte.
Durch den Tod Vicelins am 12. Dezember 1154 war das Oldenburger Bistum vakant geworden. In Vertretung ihres Gemahls wollte Herzogin Clementia für die Nachfolge sorgen, indem sie Gerold dorthin schickte, einen Hofkapellan Heinrichs des Löwen und Leiter der Stiftsschule von St. Blasius in Braunschweig. Damit eröffnete sie eine neue Phase des Dauerkonflikts mit Erzbischof Hartwig von Bremen, denn der mußte Gerold die Bischofsweihe spenden, unterließ es aber hartnäckig. Helmold von Bosau erklärt das mit Hartwigs Abwesenheit,36 doch ist das bestenfalls ein Teil der Wahrheit. Nicht der versperrte Weg von Ostsachsen nach Bremen hinderte den Erzbischof, sondern die Weihe unterblieb in erster Linie deshalb, weil Hartwig die Art der Nachfolgeregelung für unkanonisch hielt. Als Gerold im Januar 1155 dann zu Hartwig reiste und ihn in Merseburg traf, war der Erzbischof eben im Begriff, das Bistum Oldenburg mit einem sächsischen Propst zu besetzen, denn er focht Gerolds Erhebung mit der Begründung an, daß die noch unfertige und bis jetzt fast menschenleere Oldenburger Diözese ohne seine Erlaubnis als zuständiger Erzbischof weder wahlberechtigt noch beschlußfähig sei, und stellte in Aussicht, daß er nach seiner Rückkehr den Fall gemeinsam mit dem Bremer Domkapitel regeln werde. Gerold machte sich daraufhin nach Schwaben auf, um Heinrich den Löwen von dort aus durch Boten zu unterrichten. Der Herzog reagierte ähnlich wie beim Streit um die Investitur der Bischöfe nördlich der Elbe, wollte am zuständigen Erzbischof vorbei direkt mit dem Papst verhandeln und zitierte Gerold sofort zu sich nach Italien, um ihn mit nach Rom zu nehmen.37 Für Gerold sollte die Reise zum Herzog gefährlich werden, denn kaum hatte er Schwaben verlassen, wurde er überfallen, beraubt und durch einen Schwerthieb ernsthaft am Kopf verletzt.
Zuvor war das Heer des Königs nach dem Aufbruch von Roncaglia am 7. Dezember von zwei Mailänder Konsuln mißgeleitet worden und mußte drei Tage lang durch verlassenes Land ziehen, so daß es zu erheblichen Versorgungsproblemen kam, vor allem fehlte Futter für die Pferde. Die Spannungen wuchsen jetzt rasch, zumal sich mehrere lombardische Städte schon bei Friedrich über Mailand und Tortona beklagt hatten, den engen Verbündeten Mailands. Am 1. Februar ließ Friedrich das von seinen Bewohnern verlassene Asti plündern und niederbrennen, wobei im Streit um die Beute so schwere Gewalttaten verübt wurden, daß der König zur Sicherung des Lagerfriedens scharfe Bestimmungen erlassen mußte, die bei Waffengebrauch gegen eigene Leute Verstümmelung durch Abschlagen einer Hand und in schweren Fällen die Todesstrafe androhten.38
Als sich das Heer zwei Wochen später der Stadt Tortona näherte, forderte Friedrich die Bürger auf, ihre Allianz mit Mailand zu lösen und sich statt dessen mit dem königstreuen Pavia zu verbünden, doch dieses Ansinnen wurde – wie nicht anders zu erwarten – abgelehnt. Ein daraufhin sogleich ausgeschickter berittener Erkundungstrupp unter Führung von Friedrichs Bruder Konrad, Bertholds von Zähringen und Ottos von Wittelsbach suchte vor Tortona einen Lagerplatz für das Heer, mit dem der König nun heranrückte. Die Stadt lag auf einem Felskegel und war ein nahezu unüberwindliches Hindernis für die deutsche Reitertruppe, der nicht nur die Erfahrung im Belagerungskrieg fehlte, sondern vor allem das entsprechende Gerät. Zwar gelang es Heinrich dem Löwen mit seinen sächsischen Kämpfern schon am 17. Februar, die am Fuß des Berges gelegene Unterstadt von Tortona zu erobern und vollständig niederzubrennen, aber die Oberstadt kapitulierte erst zwei Monate später, nachdem die Belagerer ihre Wasserversorgung unterbrochen hatten. Den Einwohnern wurde freier Abzug gewährt, dann ging Tortona in Flammen auf und blieb den Pavesen zur vollständigen Zerstörung überlassen. Der König nahm das so wichtig, daß er eine Urkunde »während der Zerstörung Tortonas« (in destructione Terdone) datieren ließ.39
Inzwischen war Gerold am 14. Februar im Lager vor Tortona eingetroffen und von Heinrich dem Löwen und seinem Gefolge freundlich empfangen worden.40 Fortan begleitete er das Heer im Gefolge des Herzogs, der bei der ersten sich bietenden Gelegenheit Papst Hadrian IV. im Juni 1155 anläßlich von Verhandlungen um die Kaiserkrönung in Grassano bei Sutri bat, Gerold zu weihen. Hadrian hatte jedoch vom Bremer Erzbischof schon einen schriftlichen Bericht erhalten und lehnte ab, weil er Hartwigs Rechte nicht verletzen wollte.41
In Grassano schilderte der Papst eindringlich die Lage in der Stadt Rom und warnte vor der kommunalen Bewegung, die schon vor zehn Jahren zur Erneuerung des altrömischen Senats geführt hatte und nun selbstbewußt die Rechte von Papst und Kaiser ganz neu definieren wollte.42 So vorbereitet, begegnete der König Mitte Juni einer Gesandtschaft der Römer, deren Mitglieder nach diplomatischem Geschick und Bildungsstand ausgewählt worden waren und nun recht überheblich als Repräsentanten der »Hauptstadt des Erdkreises« (orbis urbs) auftraten. Gegen Zahlung einer hohen Geldsumme und Bestätigung ihrer kommunalen Rechte boten sie dem deutschen König im Auftrag des Senats die Kaiserkrone an. An dieser Stelle unterbrach Friedrich den von ihm als außergewöhnlich arrogant empfundenen Wortschwall, erinnerte an den unwiderruflichen Untergang des alten Rom und sprach aus, wohin sich dessen Qualitäten mittlerweile verlagert hätten: »Auf uns ist dies alles zugleich mit der Kaiserherrschaft übergegangen«, denn »die Hand der Franken und der Deutschen« (Francorum sive Teutonicorum manus) hat Rom durch Eroberung gerettet, und deshalb »bin ich euer rechtmäßiger Eigentümer«.43 Das Ansinnen, eine vor viereinhalb Jahrhunderten durch Karl den Großen begründete Tradition okzidental-christlichen Kaisertums und das mittlerweile dafür konstitutiv gewordene Königswahlrecht der deutschen Fürsten auf Grund tagespolitischer Konstellationen aufzugeben, mußte zwangsläufig abgelehnt werden, aber damit waren schwere Unruhen in der Stadt vorhersehbar geworden. Auf Rat des Papstes schickte Friedrich deshalb ein tausend Mann starkes Vorkommando, das im nächtlichen Handstreich die Leostadt besetzen und die Peterskirche absperren sollte. Am 18. Juni zog der König selbst durch das Goldene Tor in Rom ein, wurde an den Stufen der Peterskirche mit dem Krönungsornat bekleidet und leistete in der Kirche Santa Maria in Turri dem Papst den üblichen Sicherheitseid, bevor er im Petersdom von Hadrian IV. zum Kaiser gekrönt wurde. Anschließend bestieg er mit der Krone auf dem Haupt ein Pferd und verließ unter starker Bedeckung die Stadt, um in sein Lager auf den Neronischen Wiesen zurückzukehren. Kurz darauf brach der erwartete Aufstand aus, bei dem die Römer auch das Lager Heinrichs des Löwen nahe der Stadtmauer angriffen. Heinrich selbst führte den Gegenstoß und brachte nach vielstündigem harten Kampf den Bürgern eine schwere Niederlage bei, so daß »der Name des Herzogs vor allen anderen im Heer gerühmt wurde« (magnificatum est nomen ducis super omnes qui erant in exercitu).44 Für Hadrian IV. war dieser Sieg so wertvoll, daß er dem Herzog Geschenke sandte und am folgenden Tag Gerold zum Bischof weihte. In Sachsen sprach sich Heinrichs Ruhmestat rasch herum und fand in der Geschichtsschreibung des Landes ein breites Echo bis hin zu der im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts im Umkreis der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg verfaßten Braunschweigischen Reimchronik.45
Wegen der Sommerhitze verlegte der Kaiser sein Heer während der ersten Julihälfte in die Campagna und kehrte dann mit Heinrich dem Löwen und anderen Großen nach Tivoli zurück, um mit dem Papst über das weitere Vorgehen zu verhandeln. Dabei zeigte sich rasch, daß der Kaiser den aus seinem Amt als Vogt der römischen Kirche folgenden Erwartungen nicht gerecht wurde, denn weder konnte er die Römer dauerhaft unterwerfen und dem Papst eine sichere römische Residenz garantieren, noch würde er imstande sein, ihn gegen die Normannen zu beschützen. Der Konstanzer Vertrag verpflichtete Friedrich zum Feldzug gegen das normannische Reich, und Hadrian IV. beklagte sich, von einigen deutschen Fürsten unterstützt, sehr über den sizilischen König. Zwar drangen namentlich Erzbischof Arnold von Köln und Bischof Hermann von Konstanz darauf, den zugesagten Feldzug nach Sizilien sogleich zu beginnen, aber die Mehrheit lehnte das ab und trieb den Papst damit in die Arme des normannischen Königs Wilhelm, mit dem er sich nun notgedrungen arrangieren mußte.46 Das Votum Heinrichs des Löwen ist nicht überliefert, aber angesichts der sächsischen Opposition gegen die Form seiner Herzogsherrschaft wird auch er vom Marsch in den Süden abgeraten haben.
Auf dem Rückweg nach Deutschland geriet das Heer Anfang September bei den Veroneser Klausen in einen Hinterhalt, aus dem es der kaiserliche Bannerträger Otto von Wittelsbach mit einer kühnen Aktion im steilen Bergland befreite. Abt Isingrim von Ottobeuren schrieb auch diese Rettungstat Heinrich dem Löwen zu, obwohl er es als vertrauter Freund Ottos von Freising hätte besser wissen müssen.47 Vielleicht entstellte er die Tatsachen aus besonderer Sympathie zur Familie, denn Ottobeuren liegt nur wenige Kilometer südöstlich von Memmingen, in dem sich Welf VI. häufig aufgehalten hat;48 auf jeden Fall gehört die Geschichte zur fama, die Heinrich auf dem Italienzug erworben hatte, zur Berühmtheit als Fundament der memoria, des ehrenvollen Gedenkens.