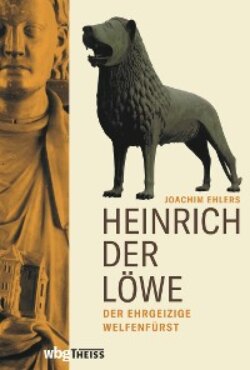Читать книгу Heinrich der Löwe - Joachim Ehlers - Страница 20
Herzog von Bayern
ОглавлениеZwischen 7. und 20. September 1155 war das Heer des Kaisers durch das Tal von Trient über Bozen und Brixen nach Deutschland zurückgekehrt, und sogleich, Anfang Oktober, bemühte sich Friedrich wieder um Heinrich Jasomirgott, der nun dazu gebracht werden mußte, den Beschlüssen des Goslarer Tages vom Frühsommer des letzten Jahres nachträglich beizutreten und die Übergabe des Herzogtums Bayern an Heinrich den Löwen zu billigen. Offenbar hatte ihm Friedrich aber noch keine akzeptable Kompensation des Verlustes anbieten können, denn diese erste Begegnung nach der Kaiserkrönung war ebenso vergeblich wie anschließende Verhandlungen in Gegenwart Herzog Władisławs von Böhmen, Albrechts des Bären und des Pfalzgrafen bei Rhein im böhmischen Grenzgebiet. Diesmal versuchte Otto von Freising sein Glück als Vermittler unter Verwandten, denn er war der Bruder Heinrichs Jasomirgott, Schwager Władisławs von Böhmen und Onkel des Kaisers.49
Warum war der Kaiser so überaus geduldig, da die Fürsten doch schon in seinem Sinne entschieden hatten? Diese aus moderner Sicht plausible Frage kann nur im Hinblick auf bestimmte Grundeinstellungen hocharistokratischer Führungseliten beantwortet werden, mit Rücksicht auf Wertekanon und Verhaltensweisen einer Schicht, der auch Friedrich angehörte. Königswahl und Kaiserkrönung haben in bezug auf diese Mentalität bei ihm schon deshalb keinen Persönlichkeitswandel bewirken können, weil er auch als König nur zusammen mit seinen Standesgenossen handlungsfähig war. Diese gemeinsame Basis bestimmte naturgemäß auch den Umgang mit Konflikten, die man nicht im Sinne neuzeitlicher Rechtsverfahren juristisch löste. Immer wieder zeigt das Verhalten Friedrichs I., daß er Streitfälle unter seinen Verwandten zunächst als Familiensache ansah, die man am besten intern regelte. Gelang das nicht, blieben immer noch hinreichend starke Motive für geduldiges Verhandeln, denn solange Friedrich als Schlichter eines Konflikts zwischen zwei Fürsten auftrat, konnte er das Verfahren unabhängig vom Rat anderer in seinem Sinne steuern, als neutraler Vermittler auftreten, aber insgeheim nach Lösungen suchen, die ihm nützten. Erst wenn aus der Schlichtung ein Gerichtsverfahren nach Lehnrecht wurde, war der König an den Spruch anderer Fürsten gebunden, durfte ohne ihren Rat weder begnadigen noch den Vergleich suchen. Das sollte später für die Entmachtung Heinrichs des Löwen entscheidend werden, denn dabei hat der Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg das förmliche Gerichtsverfahren durchgesetzt und den Kaiser damit Fürstenurteilen unterworfen.
Nachdem Otto von Freising in seiner Vermittlerrolle gescheitert war, traf Friedrich am 13. Oktober auf einem Hoftag in Regensburg mit Heinrich dem Löwen zusammen, und hier »empfing . . . Herzog Heinrich seinen Besitz und die Residenz seiner Väter zurück, denn auch die bayrischen Großen leisteten ihm Mannschaft und Eid, und die Bürger wurden nicht nur durch einen Eid, sondern auch durch Bürgen gebunden, damit sie keine Möglichkeit hatten, wankend zu werden«.50 Immer noch aber beharrte Heinrich Jasomirgott auf seiner Würde als Herzog von Bayern, so daß der Kaiser sich weiter bemühen mußte, denn ohne formellen Verzicht des einen auf das Lehnsobjekt konnte er es dem anderen nicht formell übergeben. Heinrich der Löwe zeigte sich zwar unbeeindruckt, und auch die Reichskanzlei nannte ihn dux Bawarie et Saxonie, als er im Mai 1156 auf der Reichsburg Boyneburg den Kaiser traf,51 aber endgültig war man mit dem Fall doch noch nicht fertig geworden.
Am 5. Juni schließlich machte Friedrich ein Angebot, das zunächst vertraulich behandelt werden sollte. Er werde sich dafür einsetzen, daß die Markgrafschaft Österreich zusammen mit einigen Grafschaften vom Herzogtum Bayern abgetrennt und daraus für Heinrich Jasomirgot ein neuer ducatus Austrie geschaffen würde, ein »Herzogtum Österreich«. Dem endlich stimmte der Babenberger zu, weil dieser Vorschlag ihm seinen Rang als Herzog sicherte.52 Der Plan sollte deshalb geheim bleiben, weil Heinrich der Löwe natürlich zuvor mit der Verkleinerung Bayerns einverstanden sein mußte; wahrscheinlich ist der neue Kanzler des Kaisers, Rainald von Dassel, im Juli 1156 deswegen nach Braunschweig gereist. Die Öffentlichkeit erfuhr von dem Vergleich am 8. September während eines Hoftages auf den Barbinger Wiesen bei Regensburg. Dort gab Heinrich Jasomirgott das Herzogtum Bayern in rechtssymbolischer Form mit sieben Fahnen an den Kaiser zurück, der diese Fahnen an Heinrich den Löwen weiterreichte und von diesem sofort zwei für die Mark Österreich und die Grafschaften zurückbekam. Herzog Władisław von Böhmen hatte den Fürstenspruch formuliert, der die Mark mit den Grafschaften zum Herzogtum erhob, und durch Übergabe der beiden Fahnen belehnte Friedrich damit sogleich Heinrich Jasomirgott und dessen Gemahlin Theodora.
Die Einzelbestimmungen dieser Belehnung waren für Heinrich Jasomirgott außerordentlich vorteilhaft, denn sein neues Herzogtum sollte in männlicher und weiblicher Linie vererbbar sein, und das Herzogspaar durfte, falls es kinderlos blieb, den Nachfolger frei bestimmen. Ohne Erlaubnis Heinrichs sollte niemand in seinem Herzogtum Gerichtsrechte ausüben, Hoftage mußte er nur besuchen, wenn sie in Bayern stattfanden und er ausdrücklich dazu geladen war; Heerfolgepflicht galt nur bei Feldzügen des Kaisers in Nachbargebiete Österreichs. Über diese Abreden stellte Friedrich am 17. September 1156 in Regensburg ein Diplom aus, das berühmte Privilegium minus,53 in dem so weitgehende Zugeständnisse festgelegt wurden, daß die Babenberger ihr Herzogtum künftig fast wie Eigengut der Familie behandeln konnten, war ihnen doch außer der weiblichen Erbfolge die Testierfreiheit im Falle der Kinderlosigkeit zugestanden und bei stark geminderten lehnrechtlichen Verpflichtungen das Gerichtsmonopol.
Obwohl Heinrich der Löwe trotz aller Förderung durch den König eine so definierte und urkundlich festgeschriebene Herzogsgewalt vorerst nur anstreben konnte, lieferte das Privilegium minus trotz seiner Anlage für den besonderen Fall doch so etwas wie die Idee vom modernen Herzogtum. Außerdem war durch die endlich erreichte Belehnung mit Bayern eine Rechtsauffassung überholt, die Helmold von Bosau Konrad III. zugeschrieben hatte und die besagte, daß niemals zwei Herzogtümer in einer Hand vereint sein sollten.54 Helmold war es auch, der die Regensburger Vorgänge dahingehend kommentierte, daß der Kaiser Heinrich dem Löwen Bayern zurückgegeben habe, »weil er ihn auf dem Zuge nach Italien und in anderen Angelegenheiten des Reiches treu befunden hatte« (eo quod fidelem eum in Italica expeditione et ceteris negociis regni persenserit).55 Das wirkt freilich etwas naiv angesichts der Tatsache, daß Friedrich in Regensburg keineswegs aus eigener Machtvollkommenheit Leistungen für das Reich belohnte, sondern die Fürsten zuvor mit viel Geduld und taktischem Geschick zur Entscheidung einer komplizierten und gefährlichen Streitsache veranlaßt hatte, an der er selbst keineswegs unbeteiligt war. Große Beschlüsse kamen eben nicht auf Grund einsamer Entscheidungen des Königs zustande, sondern nur im Zusammenwirken mit denen, die das Beschlossene am Ende dauerhaft akzeptieren und realisieren mußten. Am Hof des Königs wirkten diese Herren auf seine Entscheidungen ein, nur in seiner Nähe repräsentierten sie das Reich und bildeten deshalb im Laufe der Zeit die besondere Gruppe ausdrücklich so genannter Reichsfürsten (principes regni), abgesetzt von den übrigen, königsferneren Magnaten.56 Andererseits hat Helmold jedoch insofern recht, als die Belehnung mit dem bayerischen Dukat vom Einsatz Heinrichs des Löwen für die Vorhaben des Kaisers keineswegs unabhängig war und als Leistung deshalb auf Gegenseitigkeit beruhte. Mit der Abtrennung und Aufwertung der Mark Österreich hatte Friedrich dem Vetter allerdings die Möglichkeit genommen, seine bayerische Basis nach Osten zu erweitern. Das Herzogtum war rundum von anderen Reichsländern umgeben, auch Oberitalien bot einer fürstlichen Herrschaftsbildung neben der kaiserlichen Reichshoheit keine Ansatzpunkte mehr. Was in Sachsen nördlich der Elbe gelang, war in Bayern von vornherein ausgeschlossen, obwohl herzogliche Amtsgewalt dort ungleich viel effektiver und rechtlich besser fundiert zur Geltung gebracht werden konnte als in Sachsen. Das hatte sich aus einer langen Geschichte königsnaher Regierung ergeben, während der die bayerischen Herzöge seit dem 10. Jahrhundert entweder Verwandte des Königshauses gewesen waren oder die Könige selbst die Verwaltung übernommen hatten. Deshalb verfügte der bayerische Herzog als einziger im ganzen Reich über eine Ausstattung mit Amtsgut, das im Raum Regensburg, an der Salzach und am Inn gelegen war, und er hatte Befugnisse, um die Heinrich der Löwe in Sachsen noch kämpfte.
Die oberste Gerichtsgewalt stand in Bayern dem Herzog zu, der auch das Heeresaufgebot führte und für die Wahrung des Landfriedens zu sorgen hatte, woraus sich wiederum viele willkommene Anlässe zum Eingreifen in die Rechte adliger Herrschaftsträger ergaben. Im Verhältnis des Herzogs zu den Grafen war in Bayern die Regel, was Heinrich der Löwe auf den Spuren seines Schwiegervaters in Sachsen noch realisieren wollte: Nicht der König, sondern der Herzog war Lehnsherr vieler Grafen und der beiden nach Ausscheiden Österreichs verbliebenen Markgrafen im Nordgau und in der Steiermark; beim Aussterben von Adelsfamilien konnte er das Heimfallrecht an ihren Gütern häufig mit Erfolg geltend machen.57 Außerdem hatten die Herzöge schon seit den Tagen Welfs V. (1101–1120) immer wieder Reichsgut zu Lehen bekommen; ihre Stellung war insgesamt so stark, daß es der bayerische Adel ratsam fand, die Landtage des Herzogs zu besuchen.
Verhältnismäßig gering war dagegen der Bestand an welfischem Eigengut, das konzentriert an beiden Ufern des Lech zwischen Augsburg und Füssen lag; daneben gab es Besitz in Tirol, nämlich im oberen Inntal und im Vintschgau, schließlich drei bedeutende geistliche Institute, von denen zwei der Familie seit langem nahestanden. Das Augustinerchorherrenstift Rottenbuch, süddeutscher Mittelpunkt der gregorianischen Kirchenreform, war eine Gründung Welfs IV., der es 1090 dem Papst unterstellt hatte; Welf VI. hatte Steingaden gegründet und 1147 den Prämonstratensern übergeben, während das heute im Stadtgebiet von Innsbruck liegende Prämonstratenserstift Wilten dem Bischof von Brixen gehörte, aber wegen seiner Lage an der Brennerstraße von Heinrich dem Löwen gefördert wurde.
Unter diesen Voraussetzungen lag es nahe, die vorgefundenen Herzogsrechte so weit wie möglich zu nutzen, doch haben Sachsen und das Land nördlich der Elbe, nicht zuletzt aber auch der Reichsdienst, Heinrich den Löwen so lange intensiv beschäftigt, daß er Bayern erst in den siebziger Jahren größere Aufmerksamkeit gewidmet hat. Abgesehen von einem ersten bayerischen Landtag im Jahre 1157 führten ihn nur die Märsche nach Italien 1159/61 und ein kurzer Besuch im Jahre 1162 ins Land; erst 1174 hat er sich fast sechs Monate in Bayern aufgehalten. Insgesamt stand Heinrichs zweites Herzogtum deutlich hinter Sachsen zurück, blieb peripher zum nördlichen Schwerpunkt seiner Herrschaft und erscheint so auch in den Herzogsurkunden, bei denen nur fünfzehn Prozent des erhaltenen Bestandes Bayern betreffen.