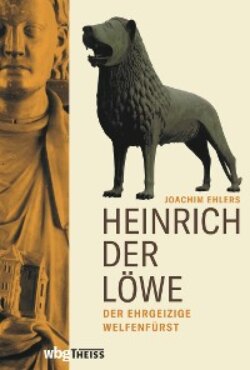Читать книгу Heinrich der Löwe - Joachim Ehlers - Страница 18
Die größere Welt Im Gefolge des Königs
ОглавлениеNach seiner Rückkehr vom Kreuzzug hatte Konrad III. wegen der Auseinandersetzungen mit Heinrich dem Löwen das Reich nicht mehr verlassen können und auf den traditionellen Romzug der deutschen Könige verzichten müssen. In deren langer Reihe war er der erste seit Otto dem Großen († 973), dem die Kaiserwürde fehlte. Weil seine Gesundheit durch die Herausforderungen des ostmediterranen Klimas und die Anstrengungen der Kämpfe auf der langen Reise gelitten hatte, ließen die Kräfte des alternden Königs seither so spürbar nach, daß es kaum noch Initiativen von seiner Seite gab. Die führenden Köpfe begannen, über die Lebenszeit Konrads hinaus zu denken und nach Lösungen für die Konflikte im Reich zu suchen.
Dieses Reich bedeutete seit mehr als zwei Jahrhunderten eine Herausforderung für die Integrationskraft seiner Könige, denn es war noch keine Institution mit organisiertem Staatsgebiet, das der König übernehmen und dann regieren konnte, sondern es existierte nur durch den Zusammenschluß und den Konsens seiner politischen Eliten. Diesen Konsens mußten die Könige im Dickicht traditioneller, politischer und familiär-dynastischer Gegensätze immer wieder suchen und erhalten, wobei sie einen guten Teil ihrer Autorität aus der Kaiserwürde bezogen, aus den integrierenden Kräften, die von der römischen Kaiser- und Imperiumsideologie ausgingen.1 Die handfesten Vorteile des kaiserlichen Ranges und der Fortsetzung des antiken römischen Imperiums durch den deutschen König – wirtschaftlicher Nutzen des Zugriffs auf Italien, Festigung der hegemonialen Stellung in Europa, Einfluß auf das Papsttum – dürfen natürlich nicht übersehen werden, weil sie dem deutschen Königreich des Mittelalters beständig neue Energien zuführten, doch die heilsgeschichtliche Würde des Imperiums, die religiöse Verpflichtung des mächtigsten abendländischen Herrschers zum Schutz der Kirche und der Christenheit, steigerte das Selbstbewußtsein und den Sinn für die korporative Zusammengehörigkeit bei den Führungskräften eines Reiches, dessen Könige den Alleinanspruch auf die Kaiserwürde hatten. Sie besaßen und repräsentierten das römische Imperium, und die stolze Gewißheit dieser einmaligen Rolle unter den Königen im lateinischen Europa sollte zum wesentlichen Inhalt des mittelalterlichen deutschen Nationalbewußtseins werden. Die Kaiserwürde verhalf auf diesem Wege einem integrierenden Einheitsdenken zum Durchbruch, das die Franken, Sachsen, Bayern, Schwaben und Lothringer allmählich als Gemeinschaft der Deutschen begriff. So intensiv traditionsbildend hat das Kaisertum gewirkt, daß die deutsche Sprache mit ihrem Wort »Reich« bis heute ohne erläuternden Zusatz keinen Unterschied zwischen Kaiserreich und Königreich, zwischen imperium und regnum, machen kann.
Diese politische Integration war freilich nur Sache des höheren geistlichen und weltlichen Adels und insofern schichtenspezifisch, denn die erdrückende Mehrheit seiner Bewohner konnte sich das Reich als räumliche Einheit gar nicht vorstellen. Das lag einerseits an seiner Ausdehnung – etwa 900 Kilometer Luftlinie von der holsteinischen Ostseeküste bis zum Alpenhauptkamm, etwa 800 Kilometer von der oberen Maas bis in die Mark Lausitz – und der daraus folgenden schleppenden Kommunikation – von Lübeck nach Wien brauchte ein Reisender etwas mehr als einen Monat, Botenreiter legten in der Ebene bis zu 100, in bergigem Gelände bis zu 50 Kilometer am Tag zurück, eine päpstliche Gesandtschaft eilte in 23 Tagen von Rom nach Goslar2 –, andererseits führte diese Weite des Raums zu einer ausgeprägten und auf vielen Gebieten immer wieder spürbaren Regionalisierung des politischen Bewußtseins. Begriffe wie »Politik« oder »Gesellschaft« lassen sich deshalb für das 12. Jahrhundert im Grunde nicht adäquat verwenden, denn die Menschen der Zeit dachten nicht in solchen abstrakten Kategorien, weil sie »politisches« und »gesellschaftliches« Handeln immer nur als konkrete Aktion zwischen bestimmten Personen in überschaubaren Landschaften begriffen; es gab weder einen isolierend herausgehobenen Politikbereich mit professionell und spezialisiert herangebildetem Personal noch eine auf das gesamte Reich bezogene deutsche Gesellschaft.
Unter solchen Voraussetzungen kommt es im Rückblick zuallererst darauf an, die beherrschenden personalen Netzwerke zu erkennen und ihr Funktionieren zu verstehen, denn jeder lebte in persönlichen Bindungen, aus denen er auch die meisten Motive für sein Handeln bezog. In einer Welt ohne staatliches Gewaltmonopol boten allein diese Netzwerke dem einzelnen und seiner Familie Schutz, so daß derjenige den meisten Anhang hatte, der am zuverlässigsten schützen konnte. Herrenrecht war an die Schutzpflicht gebunden, allzu grobes Verletzen und Vernachlässigen dieser Pflicht zersetzte allmählich die Legitimation der Herrschaft. Ein großer Personenverband wie das deutsche Reich des Mittelalters konnte Spannungen nach Art der letzten Jahre Konrads III. zwar eine Weile aushalten, aber sie provozierten auf die Dauer doch den Wunsch nach Ausgleich, Rechtssicherheit und Frieden. Insofern war die Frankfurter Wahl des staufischen Herzogs Friedrich III. von Schwaben zum König am 4. März 1152 der Versuch einer Fürstengruppe, diese Herausforderung anzunehmen und persönlichen Ehrgeiz hinter einem möglichst umfassenden Konsens zu verbergen, belastende Gegensätze so weit wie möglich zu überbrücken, Forderungen der Wähler und Zusagen des Kandidaten in ein realistisches Verhältnis zu bringen.
Schon am 6. März reiste der neue König Friedrich I. mit Heinrich dem Löwen und einem Kreis persönlich ausgewählter Fürsten zu Schiff auf Rhein und Main von Frankfurt nach Sinzig; dann setzte die Gesellschaft ihren Weg nach Aachen zu Pferd fort und traf am 8. März dort ein.3 Die bemerkenswerte Eile erklärt sich aus der hohen religiösen Bedeutung des folgenden Tages, des Sonntags Laetare Jerusalem, an dem schon Konrad III. als erster staufischer König die Krone empfangen hatte. Diesen Termin wollte Friedrich erreichen, und am 9. März 1152 krönte Erzbischof Arnold von Köln in der Pfalzkapelle Karls des Großen den neuen König, bevor dieser den ehrwürdigen Thron seines fränkischen Amtsvorgängers bestieg.
Während der nächsten Tage beriet Friedrich im Kreis ausgewählter Fürsten – prudentiores seu maiores nennt sie Otto von Freising,4 »die klügeren und bedeutenderen« – Angelegenheiten des Reiches, und wir erfahren aus den Zeugenlisten der Urkunden, die der König zwischen 9. und 14. März in Aachen ausgestellt hat, daß Heinrich der Löwe zu dieser Gruppe gehört hat neben geistlichen Fürsten wie den Erzbischöfen Arnold von Köln und Hillin von Trier, den Bischöfen Heinrich von Lüttich, Friedrich von Münster, Otto von Freising, Eberhard von Bamberg, Ortlieb von Basel, Hermann von Konstanz und weltlichen Standesgenossen wie Albrecht dem Bären, Welf VI., den Herzögen Matthäus von Oberlothringen und Gottfried von Niederlothringen. Zum ersten Mal trat der achtzehn- oder neunzehnjährige Herzog von Sachsen in einer größeren Versammlung der Mächtigen im Reich auf, die durchweg älter und erfahrener waren als er. Der Erzbischof von Köln stand mit seinen 54 Lebensjahren nach den Maßstäben der Zeit an der Schwelle zum hohen Alter, nur wenig jünger war Albrecht der Bär, Otto von Freising hatte vermutlich sein vierzigstes, der neue König wohl knapp das dreißigste Jahr erreicht.
Heinrich Jasomirgott war den Krönungsfeierlichkeiten ferngeblieben, denn er ahnte wohl, daß der Preis für die Stimme Heinrichs des Löwen bei der Königswahl die Rückgabe Bayerns gewesen war. Ausdrücklich ist das nirgendwo überliefert, aber der neue König behandelte diese Frage als Konflikt zwischen den beiden Herzögen und begann sogleich nach Lösungen des Problems zu suchen, weil er für seinen Romzug zur Kaiserkrönung ein weitgehend befriedetes Reich und breite Unterstützung für das Aufstellen eines hinreichend großen Heeres brauchte. Friedrich wollte die Kaiserkrone so schnell wie möglich erlangen, um den Zuwachs an Autorität und die wirtschaftlichen Potentiale Italiens nutzen zu können, doch die Voraussetzungen für die Reichsheerfahrt nach Rom ließen sich nur mit Mühe schaffen.
Es gab keine Rechtsgrundlage, um Heinrich Jasomirgott das bayerische Herzogtum kurzerhand zu entziehen, zudem aber war der Babenberger für den König politisch wertvoll, ein wichtiges Bindeglied für die staufischen Beziehungen ins östliche Mittelmeer und für eine Koalition gegen das sizilische Normannenreich, denn er hatte nach dem Tod Gertruds von Süpplingenburg eine Nichte des byzantinischen Kaisers Manuel geheiratet. Demnach durfte Friedrich I. es weder mit dem Babenberger noch mit dem Welfen verderben, doch war die einvernehmliche Lösung des Konflikts jedenfalls vorerst nicht zu erkennen. Niemals würde Heinrich Jasomirgott sich kampflos vom fürstlichen Rang des Herzogs auf den des Markgrafen zurückstufen lassen. Er verteidigte nicht nur den Besitz eines Reichslehens, sondern in erster Linie den damit verbundenen honor: seine Ehre und Würde im Kreis der Standesherren.
In den folgenden Wochen bis in den Mai begleitete Heinrich der Löwe zusammen mit Albrecht dem Bären, Welf VI. und Bischof Anselm von Havelberg den König auf dessen traditionellem Umritt. Nach Jahrzehnten der Feindschaft und opferreicher Blockaden stützten jetzt zwei welfische Herzöge ihren staufischen Verwandten während der entscheidenden Anfangsphase seiner Regierung und konnten auf seine Gunst bauen, die für Heinrich den Löwen zur Voraussetzung des Aufstiegs und der Selbstbehauptung werden sollte. Die Hoffnungen Ottos von Freising auf Friedrich als den »Eckstein der Versöhnung« hatten sich anscheinend erfüllt, und das Kalkül der Frankfurter Königswähler war zumindest vorerst bestätigt. Albrecht der Bär gehörte hingegen zu den Verlierern im Spiel, denn anders als sein Vorgänger war der neue König kein Gegner Heinrichs des Löwen, sondern dessen Bundesgenosse und Förderer. Um den Schaden möglichst zu begrenzen, suchte Albrecht jetzt die Nähe Friedrichs I.
Am 20. April war man in Köln; einige Tage später stellte Heinrich – wahrscheinlich in Soest – eine Urkunde für das Prämonstratenserstift Scheda aus,5 und weiter führte der Ritt nach Goslar, einen der großen Zentralorte Sachsens. Hier hat der König am 8. oder 9. Mai dem Herzog eine bedeutende Gunst erwiesen, indem er ihn mit der Reichsvogtei Goslar belehnte, die wegen des ertragreichen Silberabbaus am Rammelsberg sehr wertvoll war.6 Zehn Jahre lang hat Heinrichs Kämmerer Anno von Heimburg dieses Lehen verwaltet, während der Goslarer Pfalzbezirk weiterhin dem König unterstellt blieb.
Für Pfingstsonntag, den 18. Mai, hatte Friedrich zu einem Hoftag nach Merseburg geladen,7 an dem auch Heinrich der Löwe und Albrecht der Bär teilnahmen. Hier wirkte der neue König zum ersten Mal über die Grenzen des Reiches hinaus, indem er einen seit sechs Jahren schwelenden Thronstreit zwischen Sven und Knut schlichtete, Angehörigen der weitverzweigten dänischen Königsfamilie, die Friedrich um einen Schiedsspruch gebeten hatten. Von Anfang an war Graf Adolf II. von Holstein auf Knuts Seite gewesen, weshalb Sven die gegen ihren Grafen opponierenden Holsten so massiv unterstützte, daß Adolf sich schutzsuchend zu Heinrich dem Löwen begeben mußte. Auch Knut selbst lebte im sächsischen Exil, nachdem Sven ihn 1151 bei Husum besiegt hatte. Nun war er unter dem Geleit Heinrichs des Löwen nach Merseburg gekommen und hatte ihn zum Sprecher seiner Wünsche auf dem Hoftag gemacht, was allerdings nur den Vortrag, nicht aber die Vertretung der Sache bedeutete. Für Sven wirkte im gleichen Sinne Erzbischof Hartwig von Bremen, der auch Vicelin mitgebracht hatte, um ihn zu bewegen, »die Investitur nochmals aus der Hand des Königs zu empfangen, wobei er aber nicht den Nutzen der Kirche, sondern seinen Haß auf den Herzog im Sinn hatte«.8 Vicelin lehnte das jedoch ab, weil er den Zorn Heinrichs des Löwen fürchtete.
Die zum Hoftag versammelten Fürsten brachten Knut dazu, auf seinen Anspruch zu verzichten, »indem er sein Schwert übergab; es ist nämlich ein Rechtsbrauch des Hofes, daß Königreiche (regna) durch das Schwert, andere Herrschaften (provinciae) aber durch das Banner vom König übergeben oder entzogen werden«.9 Sven dagegen erhielt die Anerkennung als König von Dänemark und nahm sein Reich aus der Hand Friedrichs, der ihn krönte, nachdem Sven sich ihm durch Treueid und vasallitische Huldigung verpflichtet hatte. Bei der großen Pfingstprozession trug auch der deutsche König seine Krone, während Sven ihm als Träger des Reichsschwertes voranschritt. Solche Auftritte waren wichtige Manifestationen des Reiches, das sich als Verband des gekrönten Königs und seiner Magnaten selbst darstellte und von den Beteiligten gleichsam sinnlich erlebt werden konnte; feierliche Hoftage festigten auch die persönlichen Bande zwischen den Anwesenden, denn Friedrich und Sven waren Jugendfreunde, die ihre ritterliche Erziehung gemeinsam erhalten hatten.10
Für Heinrich den Löwen und Albrecht den Bären war jedoch ein anderer Verhandlungspunkt des Hoftages ungleich wichtiger. Beide stritten seit Jahren über einen Erbfall und waren zum selbständigen Vergleich jetzt um so weniger imstande, als der Konfliktstoff einige Monate vor dem Merseburger Tag dramatisch zugenommen hatte. Am 26. Oktober 1147 war Graf Bernhard von Plötzkau als letzter seiner Familie auf dem Kreuzzug Konrads III. gefallen. Seinen Besitz am Ostrand des Harzes beanspruchten sowohl Heinrich der Löwe als auch Albrecht der Bär, und der König war in seinen letzten Jahren zu einer Schlichtung nicht mehr in der Lage. Die Frage war deshalb noch offen, als in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar 1152 Graf Hermann von Winzenburg und seine schwangere Gemahlin auf ihrer Burg ermordet wurden. Die Täter waren Winzenburger und bischöflich hildesheimische Ministerialen, deren Zorn und Erbitterung sich wegen der harten Herrschaft des Grafen seit langem angestaut hatten.11 Mit Hermann II. von Winzenburg, einem »mächtigen und reichen Mann« (vir potens et magnarum pecuniarum),12 hatte Konrad III. seine feste Stütze im südlichen Sachsen verloren, und auch auf dieses Erbe, das für die Vormacht in Sachsen wesentlich wichtiger war als das Plötzkauer, erhoben Heinrich der Löwe und Albrecht der Bär gleichermaßen Ansprüche. Albrecht hat sich vielleicht auf Verwandtenerbrecht berufen, falls seine Gemahlin Sophia wirklich die Schwester des ermordeten Winzenburgers gewesen sein sollte,13 Heinrich der Löwe dürfte dagegen ebenso wie im Falle der Stader und der Plötzkauer Grafschaften die lehnrechtliche Auffassung ins Feld geführt haben, daß nach dem erbenlosen Tod eines Grafen dessen Güter und Rechte an den Herzog fallen müßten. Wenn er sich mit dieser Ansicht durchsetzte, würde in Sachsen die Herzogsgewalt als mittlere Herrschaftsebene zwischen dem König und den Grafen so stabil werden, daß der Dukat wie einst in spätkarolingischer Zeit zu einer Art Vizekönigtum gedieh. Solche Versuche zur Mediatisierung der Grafen hatte schon Lothar von Süpplingenburg gemacht, und Heinrich der Löwe verfolgte sie mit besonderer Zielstrebigkeit weiter.
Der Konflikt um diese Erbfälle ist in Merseburg noch nicht gelöst worden, wohl aber dürfte die bayerische Frage zumindest zwischen König und Herzog besprochen worden sein, denn am 18. Mai 1152 war Friedrich I. Zeuge, als Heinrich der Löwe dem Prämonstratenserstift Weißenau bei Ravensburg Güter und Rechte übertrug; das Original der darüber ausgestellten Urkunde ist erhalten und nennt Heinrich »Herzog von Bayern und Sachsen« (dux tam Bawarie quam Saxonie).14 Wenige Wochen später, Ende Juni 1152, begann Friedrich denn auch auf einem Hoftag in Regensburg mit den Vorbereitungen zur Lösung des äußerst schwierigen Problems, indem er Heinrich den Löwen und Heinrich Jasomirgott für den 13. Oktober nach Würzburg lud; gleichzeitig machte Heinrich der Löwe dem König ein schriftliches Bündnisangebot, als er in einem Brief um Rückgabe Bayerns bat, damit er Friedrich im Notfall mit größerer Macht unterstützen könne.15
In Würzburg erschien Heinrich Jasomirgott zwar nicht und mußte ein weiteres Mal geladen werden, aber Heinrich der Löwe erreichte im Streit um die Plötzkau/Winzenburger Erbschafteneine Entscheidung. Der König sprach ihm das wertvollere Winzenburger Gut, Albrecht dem Bären dagegen das Plötzkauer zu, und schon im folgenden Jahr hat der Herzog seine Pflichten als Rechtsnachfolger Hermanns von Winzenburg wahrgenommen, indem er einen der Mörder vor dem Königsgericht anklagte und überführte, so daß dieser am 1. November 1153 auf Befehl Friedrichs in Köln enthauptet wurde.16 Daß jetzt die Zeit der Einlösung von Wahlversprechungen gekommen war, zeigt die ebenfalls in Würzburg vorgenommene Belehnung Welfs VI. mit dem Herzogtum Spoleto, der Markgrafschaft Toskana, dem Fürstentum Sardinien und mit den Gütern der Gräfin Mathilde, wodurch Welf VI. die Nachfolge Heinrichs des Stolzen antrat. Das gehörte auch zur Werbung um Unterstützung für den Italienzug, und in Würzburg schworen die versammelten Fürsten, ihn innerhalb der nächsten zwei Jahre anzutreten.17
In dem großen Gefolge, mit dem Friedrich am Jahresende in Trier eintraf, befand sich wiederum Heinrich der Löwe; gemeinsam zog man Anfang Januar 1153 weiter nach Metz, durchs Elsaß nach Besançon und Baume-les-Dames (Dép. Doubs);18 dort scheint sich der Herzog vom König getrennt zu haben, der nach Konstanz ging und mit italienischen Problemen konfrontiert wurde, die ihn für den Rest seines Lebens beschäftigen sollten, für die er viele große Adelsfamilien immer wieder in Anspruch genommen hat und an denen er letztlich gescheitert ist. Zwei Bürger der Stadt Lodi klagten vor dem König und seinen Großen gegen die Stadt Mailand wegen Angriffen auf ihre Freiheit und Behinderung ihres Handels; außerdem waren zwei päpstliche Legaten nach Konstanz gekommen, denen der König in die Hand versprach, was seine Unterhändler einige Wochen zuvor in Rom mit dem Papst vereinbart hatten: Weder mit den Bürgern von Rom noch mit König Roger II. von Sizilien würde Friedrich ohne Zustimmung des Papstes jemals Frieden schließen, sondern die römische Kirche als ihr Schutzvogt in allen Gefahren verteidigen. Dafür sagte ihm Eugen III. außer der Kaiserkrönung die Exkommunikation eines jeden zu, »der das Recht und die Ehre des Reiches« (iustitiam et honorem regni) verletzen würde; sowohl der Papst als auch der künftige Kaiser versprachen einander, keine byzantinischen Stützpunkte in Italien zu dulden. Über dieses Abkommen, mit dem Friedrich nicht nur den Romzug vorbereiten, sondern auch seinen Beziehungen zum Papst jedenfalls mittelfristig eine feste Grundlage geben wollte, stellte er Eugen III. am 23. März 1153 eine Urkunde aus, den später so genannten »Konstanzer Vertrag«.19
Ende Mai finden wir den Herzog wieder beim König, und zwar in Heiligenstadt im Eichsfeld, wo er am 29. Mai in zwei königlichen Diplomen für das Augustinerchorherrenstift Fredelsloh und seinen Propst als Zeuge genannt ist, für jenes Stift, dem er als Knabe gemeinsam mit seiner Mutter Gertrud zwei Bauernhöfe geschenkt hatte.20 Acht Tage später, zum Pfingstfest am 7. Juni, kamen dann die Großen des Reiches in Worms zum Hoftag zusammen, um die Klage Heinrichs des Löwen wegen des Herzogtums Bayern aufs neue zu verhandeln. Heinrich Jasomirgott war diesmal zwar erschienen, verweigerte aber seine Mitwirkung an den Verhandlungen mit dem Argument, er sei nicht formgerecht geladen worden, und eben diese Erklärung setzte er mit demselben Erfolg noch einmal auf dem Hoftag von Speyer im Dezember 1153 ein.21 »Friedrich hatte sich nun schon fast zwei Jahre lang bemüht, den Streit der beiden Fürsten, die ihm . . . wegen Blutsverwandtschaft so nahe standen, zu schlichten; veranlaßt durch das Drängen des einen (Heinrichs des Löwen), der in sein väterliches Erbe zurückkehren wollte, aus dem er schon so lange verdrängt war. Weil ihm (Friedrich) außerdem ein schwerer Feldzug bevorstand, auf dem er den jungen Fürsten als Krieger und Verbündeten brauchte, war er nun endlich gezwungen, den Streit zu beenden.«22 Offensichtlich drängte jetzt alles auf eine Entscheidung, zumal es in Bayern infolge der Auseinandersetzung zwischen beiden Fürsten zu so schwerwiegenden Landfriedensbrüchen gekommen war, daß der König einen für September 1153 in Regensburg geplanten Hoftag aus Sicherheitsgründen hatte absagen müssen.23
Nun sollte ein Hoftag Ende Mai/Anfang Juni 1154 in Goslar die Entscheidung bringen. Heinrich der Löwe erschien dort mit großem Gefolge, um im eigenen Land seine Autorität als Herzog eindringlich vorzuführen. Unter den Klerikern, die ihn begleiteten, erkennen wir den Archidiakon von Goslar sowie die Pröpste der Augustinerchorherrenstifte Riechenberg und Georgenberg, unter den Laien die Grafen Liudolf, Burchard und Hoyer von Wöltingerode, Adalbert von Wernigerode, Volkwin von Schwalenberg, elf Edelfreie, 35 Ministerialen, die zum Teil mit ihren Söhnen und Brüdern auftraten, unter ihnen Anno von Heimburg, Heinrich von Weida, Burchard von Wolfenbüttel, Liudolf von Dahlum, Friedrich von Volkmarode, und schließlich noch 64 Goslarer Bürger (urbani).24 Obwohl er schriftlich geladen war, fehlte Heinrich Jasomirgott auch hier, und daraufhin erging ein Fürstenspruch, der Heinrich dem Löwen das Herzogtum Bayern zusprach. Dabei handelte es sich allerdings erst um die formale Entscheidung in der Sache, noch nicht also um die Einweisung in den Dukat mit der Belehnung und der anschließenden Huldigung des bayerischen Adels, denn Friedrich scheute den offenen Bruch mit dem Babenberger, wußte auch von einer starken Opposition gegen den Goslarer Spruch unter den dort nicht beteiligten Fürsten und suchte deshalb nach wie vor eine politische Lösung. Insofern verhielt sich die Reichskanzlei korrekt, wenn sie Heinrich den Löwen auch künftig nur »Herzog von Sachsen« (dux Saxonie) nannte, während er selbst sich schon seit 1152 immer wieder den Doppeltitel beigelegt hatte und auch sein zweites Reitersiegel schon vor dem Goslarer Tag mit der Umschrift Henricus Dei gratia dux Bawarie et Saxonie (»Heinrich von Gottes Gnaden Herzog von Bayern und Sachsen«) versehen ließ.25
Aber noch mehr und Erstaunliches brachte dieser Goslarer Tag. Friedrich I. verlieh »seinem geliebten Heinrich, Herzog von Sachsen« (dilecto nostro Heinrico duci Saxoniae) für das Land nördlich der Elbe, »das er durch unsere Freigebigkeit innehat«, die freie Vollmacht, dort Bistümer und Kirchen zu gründen und auszustatten; ihm und seinen Nachfolgern wurde das Recht zur Investitur für die drei Bistümer Oldenburg, Mecklenburg und Ratzeburg übertragen, und zwar so, daß deren Bischöfe das, was Königsrecht war, aus der Hand des Herzogs so empfangen sollten, als wenn es vom König käme.26 Mit dieser Übertragung wollte Friedrich die Teilnahme Heinrichs des Löwen am Italienzug sicherstellen, gleichzeitig aber auch betonen, daß es sich bei den Heinrich zugestandenen Bischofsinvestituren um ein übertragenes, ihm nur anvertrautes Königsrecht handelte und kein Zweifel daran bestehen könne, daß die nordelbischen Gebiete zum Reich gehörten. Dennoch war das Privileg ein exzeptioneller Ausdruck königlicher Förderung und verschaffte Heinrich dem Löwen Kompetenzen eines Vizekönigs im Land nördlich der Elbe, das auf diese Weise eine deutlich erkennbare Sonderstellung erhielt. Als einziger deutscher Fürst verfügte Heinrich über ein solches Investiturrecht, und daraus ergaben sich erhebliche Rückwirkungen auf seine Stellung als Herzog in Sachsen.