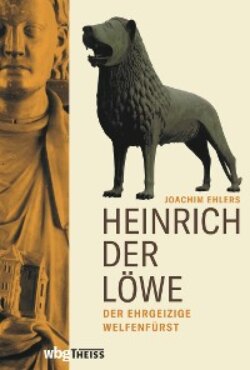Читать книгу Heinrich der Löwe - Joachim Ehlers - Страница 15
Die Güter der Grafen von Stade
ОглавлениеOberstes Gebot für die Vorbereitung der selbständigen Regierung Heinrichs des Löwen in Sachsen war die Schwächung seiner Konkurrenten, die gemeinsam nicht stärker sein sollten als der Herzog. Eine solche Idealforderung war schwer zu erfüllen, um so wichtiger mußte der Erwerb weiterer Besitz- und Herrschaftsrechte aus den Händen anderer Adelsgewalten sein. Die besten Voraussetzungen für solche Güterbewegungen boten große Erbfälle aussterbender Dynastenfamilien, denn zwangsläufig verteilten sie die Gewichte in Sachsen neu, und es war die Frage, wem das zugute kam.
Am 15. März 1144 erschlugen Dithmarscher Bauern den Grafen Rudolf II. von Stade. Weil das Opfer keine Kinder hatte, blieben seine Geschwister Hartwig und Liutgart als Erben eines Güter- und Herrschaftsgebietes, das von der Unterweser im Süden bis zur Eider im Norden reichte und an das billungische Erbgut der Welfen um Lüneburg grenzte.52 Hartwig war Domherr in Magdeburg und Propst des Bremer Domkapitels, Liutgart die Gemahlin des sächsischen Pfalzgrafen Friedrich von Sommerschenburg.
Sogleich nach dem Tod seines Bruders schloß Hartwig einen Vertrag mit Erzbischof Adalbero von Bremen, dem zufolge Hartwigs gesamtes Erbe in der Diözese Bremen an den Erzbischof fiel. Als Gegenleistung sollte Adalbero seinem Dompropst dieses Erbgut mit allen Grafschaftsrechten als Lehen auf Lebenszeit zurückgeben, und wahrscheinlich hat das Bremer Domkapitel ihm damals auch die Anwartschaft auf die erzbischöfliche Würde versprochen, die er im Jahre 1148 tatsächlich erhalten hat. Die meisten Eigengüter der Familie am Mittellauf der Elbe dagegen schenkten Hartwig und seine Mutter dem Bistum Havelberg, dem Prämonstratenserstift St. Marien in Magdeburg und dem erst neu zu gründenden Stift Jerichow, das noch im Jahre 1144 von Magdeburg aus auf Havelberger Gebiet für Prämonstratenserchorherren eingerichtet wurde; den Rest des Gutes verkauften sie an das Erzbistum Magdeburg. Die Erzbischöfe von Bremen und von Magdeburg würden fortan Verbündete Hartwigs sein.53
Nur sechs Wochen später bahnte sich ein weiterer bedeutender Erbfall an, denn am 27. April 1144 starb Graf Siegfried IV. von Boyneburg, ein Enkel Ottos von Northeim.54 Seine Güter und Rechte erstreckten sich vom Mittellauf der Leine und von der oberen Weser bis in die Gegend von Eschwege, außerdem aber hatte Siegfried fast alle Grafschafts- und Vogteirechte der Northeimer besessen, deren letzter männlicher Nachkomme er gewesen war. Erben waren Siegfrieds Witwe Richenza, seine einzige Tochter Guda und seine Schwester, die ebenfalls Richenza hieß. Als Großneffe Siegfrieds und Enkel der Kaiserin Richenza aus dem Haus der Northeimer Grafen hatte zwar auch Heinrich der Löwe Ansprüche, aber seine Räte meldeten sie nicht an, weil sie sich auf das größere Erbgut der Stader Grafen konzentrieren und den ohnehin schweren Weg zu dessen Erlangung nicht durch ein zweites, kaum weniger kompliziertes und ungewisses Verfahren belasten wollten.
Unwidersprochen konnte ein Teil des northeim-boyneburgischen Erbes deshalb noch im Jahre 1144 an den Grafen Heinrich von Assel gehen, der die Witwe Siegfrieds IV. von Boyneburg heiratete; den größeren Bestand aber kaufte Heinrichs älterer Bruder, Graf Hermann II. von Winzenburg, dem König Konrad III. noch dazu die Grafschafts- und Vogteirechte Siegfrieds von Boyneburg übertrug, um einen starken sächsischen Bundesgenossen zu gewinnen. Es handelte sich um ein nahezu geschlossenes Herrschaftsgebiet im Raum von Leine, oberer Weser, Werra und Diemel mit Grafschaftsrechten und Burgen, Vogteien über die Klöster Northeim, Corvey, Bursfelde, Gandersheim, Helmarshausen, Heiligenstadt, Flechtdorf und Amelungsborn. Als Hermann von Winzenburg das soeben erworbene Kloster Northeim und sein eigenes Hauskloster Reinhausen der Mainzer Kirche gab und im Gegenzug vom Erzbischof alle Mainzer Kirchenlehen im südlichen Sachsen erhielt, formierte sich eine beachtliche Position gegen Heinrich den Löwen.
Heinrichs Räte reagierten schnell. Am 23. Juli 1144 ließen sie den Erzbischof von Mainz um die Beglaubigung einer Urkunde bitten, mit der Heinrich der Löwe dem Kloster Bursfelde alle Rechte und Freiheiten bestätigte, die sein Urgroßvater Heinrich von Northeim dem Kloster einst verliehen hatte. Dem Vertragspartner des Winzenburgers war damit in schriftlicher Form bekanntgemacht, daß Heinrich der Löwe legitimer und vollberechtigter Erbe (legitimus ac iustissimus heres) des Northeimers war.55 Unter den Urkundszeugen Heinrichs des Löwen finden wir die Grafen Poppo von Blankenburg und Liudolf von Wöltingerode zusammen mit den Ministerialen Liudolf von Dahlum, Anno von Heimburg und Berthold von Peine, die uns schon am Hof der Kaiserin Richenza begegnet sind. In dieser ersten Urkunde, die Heinrich den Löwen als Aussteller nennt, lernen wir aber noch weitere Personen kennen, die mit ziemlicher Sicherheit zum süpplingenburgisch-welfischen Hof gehört haben, der nach 1142/43 die Belange des Erben selbständig vertreten hat, nämlich die Äbte Eberhard von Königslutter, Wolfram von Lüneburg und Vicelin von Northeim, die Pröpste Ekkehard von Braunschweig und Snellard von Oelsburg. Der engere Hofklerus ist durch die Kapelläne Gerold, Giselbert und Markward vertreten; Gerold, der wahrscheinlich den Text der Urkunde formuliert hat, war Kanoniker an St. Blasius in Braunschweig und als Leiter der Stiftsschule Lehrer Helmolds von Bosau, später sollte er Bischof von Oldenburg/Lübeck werden; Giselbert begegnet nur in dieser Urkunde, aber vom Kapellan Markward wissen wir, daß er später zum Abt des alten billungischen Hausklosters St. Michael in Lüneburg aufstieg und in der Umgebung Heinrichs des Löwen blieb.
Auf dem Magdeburger Hoftag Konrads III. im Dezember 1144 gingen die tutores Heinrichs des Löwen dann in die Offensive und klagten gegen die Vergabe der Stader Grafschaften an den Dompropst Hartwig von Bremen. Sie begründeten ihre Beschwerde mit einer Zusage Erzbischof Adalberos von Bremen an Gertrud von Süpplingenburg, nach dem Tod Rudolfs von Stade dessen Lehen an Heinrich den Löwen zu übertragen.56
Über die Berechtigung der Ansprüche Heinrichs des Löwen ist viel gestritten worden, denn von der Antwort hängt das Urteil nicht nur über den politischen Stil, sondern auch über das Rechtsbewußtsein des welfischen Hofes und seines künftigen Herrn ab. Zunächst werden wir davon ausgehen müssen, daß es einen solchen Anspruch wirklich gegeben hat, denn ohne jeden Rechtsgrund hätten Heinrichs Räte auf dem Hoftag schlecht argumentieren können. Die Quellen sagen dazu wenig, doch ist der Disput offenbar von unterschiedlichen Rechtsstandpunkten aus geführt worden. Die Gegner Heinrichs des Löwen vertraten anscheinend die ältere sächsische Rechtsauffassung, daß nicht nur Eigentum, sondern auch Grafschaften und anderes Lehnsgut erbrechtlich weiterzugeben wären und ein Graf nicht vom Herzog abhinge, sondern nur vom König, so daß Heinrich der Löwe in dieser Sache weder zuständig noch zur Mitwirkung berechtigt war. Der Hof Lothars von Süpplingenburg, dessen Meinung Heinrichs Räte vertraten, hatte in dieser Hinsicht jedoch schon seit langer Zeit durchaus anders gedacht, denn Lothar war so mächtig gewesen, daß er Landfriedenswahrung und Lehnrecht einsetzen konnte, um seinen Herzogstitel mit wirklichen Regierungsfunktionen auszufüllen. Praktisch lief das auf den Versuch hinaus, alle Grafen in ein direktes Lehnsverhältnis zum Herzog zu bringen. Als Lothar dann König wurde, verbesserten sich zwar die Voraussetzungen für solche Bestrebungen, aber ihre Rechtsgrundlagen wurden diffuser, weil man König und Herzog in der Person Lothars nicht mehr klar unterscheiden konnte. Wie damals sein Hof, so hat später Heinrich der Löwe selbst die Kombination von Landfriede und Lehnrecht konzeptiv weiterverfolgt und sich damit in einen Gegensatz zum sächsischen Rechtsbrauch gebracht, denn von seinem Standpunkt aus durfte der Oberlehnsherr das gesamte Gut beanspruchen, wenn es keinen direkten Erben mehr gab. Die Verbindung zweier Anspruchsgründe in doppelgleisiger Argumentation meinte Helmold von Bosau, als er am Ende des Konflikts um die Stader Güter zusammenfassend feststellte, daß Heinrich der Löwe sie teils nach Erbrecht, teils nach Lehnrecht erworben habe (quaedam quidem hereditario iure, quaedam beneficiali).57
Erbrechtliche Argumente gab es in der Tat, denn die Familie Heinrichs des Löwen war seit langem überzeugt, mit den Grafen von Stade verwandt zu sein. In der ältesten schriftlichen Aufzeichnung ihrer Geschichte, der Genealogia Welforum von 1123/26, wird von ihrem Vorfahren Rudolf und seiner Gemahlin Ita erzählt, die eine Schwester des Markgrafen Ekbert von Stade gewesen sei.58 Weder von Ekbert noch von seinen Brüdern gab es der Genealogia zufolge legitime Nachkommen, wohl aber führte eine direkte Linie von Ita und Rudolf über die Stationen Welf II./Cuniza/Welf IV./Heinrich der Schwarze/ Heinrich der Stolze zu Heinrich dem Löwen. Es ist ganz unerheblich, wie moderne Historiker und Genealogen diese Verwandtschaft beurteilen und ob sie herausgefunden haben, daß andere sächsische Familien den Grafen von Stade sehr viel näher standen als die Welfen, denn für das Handeln der Räte Heinrichs des Löwen war deren subjektive Überzeugung von der Relevanz des erbrechtlichen Arguments ausschlaggebend.
Weder dem König noch den meisten sächsischen Großen konnte jedoch an einer Stärkung Heinrichs des Löwen gelegen sein. Der Magdeburger Hoftag brachte deshalb einen Fürstenspruch, der Hartwig die Grafschaften seines ermordeten Bruders zuerkannte und dem Pfalzgrafen Friedrich von Sommerschenburg, Hartwigs Schwager, die königliche Bannleihe zur Ausübung der Hochgerichtsbarkeit übertrug, weil Hartwig sie als Kleriker nicht selbst handhaben durfte; der König bestätigte außerdem der Kirche von Havelberg die Schenkungen Hartwigs und dem Erzstift Magdeburg den Erwerb Jerichows mit anderen Stader Gütern.59 Die welfische Seite hat das anerkennen müssen, denn in den Diplomen Konrads III. für Magdeburg findet sich Heinrich der Löwe als erster der weltlichen Zeugen, vor Albrecht dem Bären, Pfalzgraf Friedrich von Sommerschenburg, Graf Hermann von Winzenburg.
Dem Zwang zur Anerkennung des Magdeburger Spruchs folgte allerdings nicht dessen dauerhafte Akzeptanz, vielmehr entschlossen sich Heinrichs Räte jetzt, eine Revision der Entscheidung gewaltsam zu erzwingen und Hartwigs Allianz mit den Erzbischöfen aufzubrechen. Im August 1145 versuchten sie, Adalbero von Bremen auf dem Weg zu einem königlichen Hoftag in Corvey abzufangen, aber der Erzbischof kehrte rechtzeitig um; vermutlich war er gewarnt worden. In Corvey trug die welfische Seite am 24. August ihren Anspruch auf die Stader Grafschaften nochmals vor, und der König setzte ein Schiedsgericht ein, dessen Zusammensetzung freilich klar erkennen ließ, daß Heinrich der Löwe keine Chance haben würde: Neben Bischof Thietmar von Verden waren Albrecht der Bär, Graf Hermann von Winzenburg und sein Bruder Graf Heinrich von Assel dafür nominiert worden.
Wohl kurz nach dem Corveyer Tag trat das Schiedsgericht in Ramelsloh südlich von Hamburg zusammen. Hier erschienen der Erzbischof von Bremen sowie Heinrich der Löwe und seine Räte; zur Sache sprachen Dompropst Hartwig und Pfalzgraf Friedrich von Sommerschenburg. Sehr schnell kam es zum Streit, in dessen Verlauf Heinrichs Leute die Versammlung mit blanker Waffe bedrohten, den Erzbischof gefangennahmen und nach Lüneburg verschleppten, während Graf Hermann von Lüchow als Vasall Heinrichs des Löwen den Dompropst mit sich fortführte.60 Der Vorgang war ungeheuerlich, denn die Räte des Löwen hatten den Gerichtsfrieden gebrochen und ein königliches Schlichtungsgebot mißachtet; wenn das als Vorzeichen für den Herrschaftsstil des mündigen Herzogs gewertet wurde (und das wurde es natürlich), war der politische Schaden groß. Konsens, so mußten die sächsischen Großen annehmen, würde künftig nur bei Übereinstimmung mit Heinrichs Wünschen zu erreichen sein, Dissens Gewalt und Repression auslösen. Krieg würde Recht schaffen, herzogliche Landesherrschaft durch machtpolitisches Verdrängen mindermächtiger Konkurrenten aufgerichtet werden. Die Schar der Gegner sollte fortan deutlich größer sein als die der Freunde und Verbündeten.
Schon nach kurzer Gefangenschaft fand sich der Erzbischof von Bremen bereit, Heinrich dem Löwen die Stader Grafschaftsrechte zu überlassen, und kam daraufhin frei; nun hofften Heinrichs Leute offenbar, den Dompropst Hartwig aus dem Gewahrsam des Grafen Hermann von Lüchow überstellt zu bekommen. Sie hätten ihn vermutlich getötet und damit die zentrale Figur des Konflikts beseitigt, doch gegen Zahlung eines hohen Lösegeldes wurde Hartwig Albrecht dem Bären übergeben und von ihm nach Bremen zurückgeleitet. Heinrich der Löwe besaß nun die Stader Güter und Rechte, mit denen wahrscheinlich auch die Hochstiftsvogtei über die Bremer Kirche verbunden war; der König war nicht in der Lage, den Anspruch des Erzbischofs zu sichern. Gelegentlich wurde Heinrichs Usurpation noch angefochten, aber als Erzbischof Hartwig am 11. Oktober 1168 starb, hörte der Widerspruch endgültig auf.61