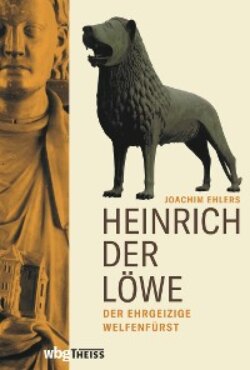Читать книгу Heinrich der Löwe - Joachim Ehlers - Страница 17
An der Schwelle zur Macht
ОглавлениеAufs Ganze gesehen hat der Slawenkreuzzug keine konkreten Ergebnisse gebracht, doch er schuf durch Taufen und damit verbundene Tributzahlungen neue Rechtsgrundlagen für den Aufbau einer Kirchenorganisation und die christlich begründete Integration der slawischen Gebiete. Das daraus sogleich folgende Bestreben, Heinrich dem Löwen die Oberhoheit über das Land und die Kirche zu verschaffen, wird immer wieder dem jungen Herzog selbst zugeschrieben, doch setzt es so viel Erfahrung im Umgang mit kirchlichen Instanzen voraus, daß der Anteil seiner Räte nicht unterschätzt werden darf, und zwar sowohl in bezug auf das Verfahren als auch auf das Konzept. Noch immer bewegte sich Heinrich im Kielwasser derer, die seine Interessen loyal und energisch, aber keineswegs selbstlos vertraten, weil ihre Stellung und ihr Ansehen mit der Macht und der Autorität des Herzogs zunahmen. Um dieser Autorität im Norden Geltung zu verschaffen, brachten sie im Namen ihres Herrn ein großes Heeresaufgebot gegen die Dithmarscher zusammen, an dem sich im Sommer 1148 außer Albrecht dem Bären, den Grafen Adolf II. von Holstein und Heinrich von Badwide auch die Holsten beteiligten, erstaunlicherweise aber auch Erzbischof Adalbero von Bremen und sein Dompropst Hartwig, denen man drei Jahre zuvor in Ramelsloh so übel mitgespielt hatte.76 Einem Feldzug, der die Ermordung des Grafen Rudolf von Stade rächen sollte, konnten sich die beiden aber kaum entziehen, und sie mußten am Ende auch hinnehmen, daß Heinrich der Löwe in Dithmarschen einen Grafen einsetzte. Gleichzeitig suchten Heinrichs Berater wegen einer Neuordnung der nordelbischen Kirche Kontakte zum Papst, ohne den zuständigen Erzbischof von Bremen zu konsultieren. Im September 1148 erteilte Eugen III. dem Kardinaldiakon Guido von S. Maria in Portice Vollmacht für entsprechende Verhandlungen, die der Kardinal im Frühjahr 1149 in Königslutter führen wollte. Inzwischen war der ehemalige Dompropst Hartwig im Herbst 1148 zum Nachfolger Erzbischof Adalberos von Bremen gewählt worden und hatte sich sogleich nach Rom begeben, um die drohende Verletzung seiner Kompetenzen abzuwenden. Offenbar hat er vom Papst keine befriedigende Antwort bekommen, denn sofort nach seiner Rückkehr im September 1149 weihte er zwei Bischöfe – Vicelin für Oldenburg, Emmehard für Mecklenburg – und löste damit einen Konflikt aus, den man als regionalen Investiturstreit bezeichnen kann.
»Investitur« hieß seit dem Wormser Konkordat von 1122 die Ausstattung eines in Gegenwart des Königs neugewählten Bischofs mit den weltlichen Gütern und Hoheitsrechten seiner Bischofskirche. Das geschah in lehnrechtlicher Form durch Übergabe eines Zepters, so daß der Bischof Vasall des Königs wurde, und erst danach durfte er die Weihe für sein Amt erhalten. Weder für Oldenburg noch für Mecklenburg aber konnte ein Bischof gewählt werden, denn es gab dort keine Domkapitel als Wahlkörperschaften, auch existierten weder Bischofsgüter noch Hoheitsrechte, und Konrad III. war, soweit wir das aus der Überlieferung sehen können, von Erzbischof Hartwig nicht einmal informiert worden. Selbst wenn der Erzbischof an die Tradition zweier älterer, mittlerweile untergegangener Bistümer anknüpfen konnte, waren seine eigenmächtigen Weihen im Sinne des Wormser Konkordats illegal, und wenn er geglaubt haben sollte, im rechtsfreien Kolonialland auf eigene Faust zwei Eigenbistümer der Bremer Kirche gründen zu können, so hätte er selbst den Räten Heinrichs des Löwen Motiv und Argumente für den folgenden Konflikt geliefert. Auf die Nachricht von den beiden Bischofsweihen nämlich verlangte der Herzog das Königsrecht der Investitur für sich und begründete das Vicelin gegenüber mit dem im Denken der Zeit durchaus rechtserheblichen Argument, daß »meine Väter mit Gottes Hilfe dieses Land durch Schild und Schwert erobert haben«; aus dem Kreis der altbewährten Räte des Herzogs setzte Heinrich von Weida, »ein mächtiger und ritterlicher Mann« (vir potens et militaris), den Bedenken Vicelins ein pragmatisches Argument entgegen: »Weder ein Kaiser noch ein Erzbischof kann deiner Sache helfen, solange mein Herr dagegen ist, dem Gott doch dieses ganze Land gegeben hat. Was verlangt mein Herr denn groß von dir, das verboten oder ungehörig wäre? Leicht und nützlich ist es, wenn mein Herr als Zeichen der Investitur ein Stäbchen nimmt und es in deine Hände legt, so daß du künftig als ein Mann des Herzogs angesehen wirst!« Der Erzbischof und sein Domkapitel dagegen drängten Vicelin zum Widerstand, weil ein vom König investierter Bischof reichsunmittelbar und frei sei, der vom Herzog belehnte dagegen ein Fürstenknecht.77
Mit ähnlichen Gedanken wie der Bremer Klerus werden alle sächsischen Bischöfe die Vorgänge intensiv beobachtet und erkannt haben, mit welchen Mitteln Heinrich der Löwe und seine Leute die Kompetenzen des Bremer Erzbischofs gemindert, das Investiturrecht des Königs usurpiert und zwei Amtsbrüder von sich abhängig gemacht hatten. Für die herzogliche Seite handelte es sich dabei keineswegs um eine bloße Prestigefrage, denn wenn Erzbischof Hartwig von Bremen beim Aufbau einer von ihm gelenkten Missionskirche mit den Slawenfürsten kooperierte, würden diese als Christen politisch so aufgewertet werden, daß der Herzog keine Oberhoheit im Land bekommen hätte.78 Am Ende haben Vicelin und Emmehard nachgegeben, wohl im Winter 1150/51, und sich von Heinrich dem Löwen mit einem Stab investieren lassen.79
Unbehelligt vom König hatte Heinrich der Löwe sich nördlich der Elbe durchsetzen können, denn Konrad III. kam nach schweren Niederlagen gegen die Türken erst im Mai 1149 nach Deutschland zurück und mußte sich sogleich mit Angriffen Welfs VI. befassen, der in Schwaben gegen staufische Positionen vorging. Auf einem Hoftag in Würzburg wollte Konrad am 25. Juli mit den sächsischen Großen verhandeln, um den Konflikt auf Schwaben begrenzt zu halten, aber außer Albrecht dem Bären und einigen wenigen Grafen folgte niemand der Einladung, nicht Heinrich der Löwe und kein sächsischer Bischof. Das mußte im Hinblick auf die mühsam vertagte Frage des bayerischen Dukats als Alarmzeichen gewertet werden, zumal Heinrich wohl 1150 begann, den Titel »Herzog von Bayern und Sachsen« zu führen, der im Mai 1152 zum ersten Mal in einer seiner Urkunden bezeugt ist.80 Für den 13. Januar 1151 lud ihn der König nach Ulm, um ein lehnrechtliches Verfahren zu eröffnen, doch wird gerade diese Ankündigung Heinrich veranlaßt haben, dem Hoftag fernzubleiben und statt dessen mit Heeresmacht von Lüneburg nach Schwaben aufzubrechen, um seinem Anspruch Nachdruck zu verleihen. Clementia blieb, beraten durch Graf Adolf von Holstein, als Regentin in Sachsen zurück.81 Zu ihr kam im Frühjahr 1151 während der Abwesenheit des Herzogs der Abodritenfürst Niklot und beklagte sich über die Kessiner und Zirzipanen, die ihre schuldigen Zinszahlungen verweigerten; Graf Adolf erhielt den Auftrag, gemeinsam mit Niklot den Widerstand zu brechen, und seither gab es enge Beziehungen zwischen beiden, die sich später oft in Lübeck oder Travemünde zu Beratungen trafen.82
Zur gleichen Zeit ließ Heinrich der Löwe einen Ladungstermin nach Regensburg verstreichen und kam auch im September nicht zum Hoftag nach Würzburg, sondern bekämpfte in Schwaben den Herzog von Bayern, Heinrich Jasomirgott, allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Auf die Nachricht von dieser Blockade forderte Albrecht der Bär zusammen mit anderen sächsischen Fürsten Konrad III. auf, nach Sachsen zu kommen und Braunschweig zu belagern.83 Im November folgte der König diesem Ruf und traf sich mit Albrecht dem Bären und weiteren Oppositionellen in Altenburg, um den Feldzug vorzubereiten. Anfang Dezember sammelte sich das Heer in Goslar und versuchte von dort aus, Braunschweig im Handstreich zu nehmen. Die Angreifer waren sich ihres Erfolges sicher, weil sie den Ort für ungeschützt hielten, seit ihnen das falsche Gerücht zugetragen worden war, Heinrich der Löwe wolle das Weihnachtsfest mit seinen Leuten in Schwaben verbringen. Statt dessen stieß der Herzog mit kleinem Gefolge in einem Gewaltritt nach Braunschweig durch und erzielte damit bei seinen sächsischen Anhängern einen solchen Mobilisierungseffekt, daß der König seinen Feldzug abbrach und sich nach Süddeutschland zurückzog.84 Der Vorgang zeigt nicht nur die große Wirkung persönlichen Einsatzes, sondern auch die physischen Anforderungen, denen die Führungselite zu genügen hatte. Immerhin beträgt die Entfernung von Tübingen nach Braunschweig auf heutigen Straßen und Autobahnen gut fünfhundert Kilometer; um das bei winterlichen Bedingungen in kurzer Zeit zu bewältigen, mußte man gut trainiert und angesichts der Unfallgefahr bei schnellem Ritt über große Distanzen mutig sein. Personale Herrschaft verlangte eben nicht nur Eigenschaften, die sich dem Gelehrten in seiner Bibliothek leicht erschließen – politische Begabung, Energie, Durchsetzungsvermögen, geschickte Menschenführung und mentale Belastbarkeit –, sondern auch ein hohes Maß an körperlicher Ausbildung und Einsatzfreude. Beides hat Heinrich der Löwe im Laufe seines Lebens immer wieder bewiesen, und es sind nicht zuletzt diese Eigenschaften, denen er seinen Aufstieg zu verdanken hatte.