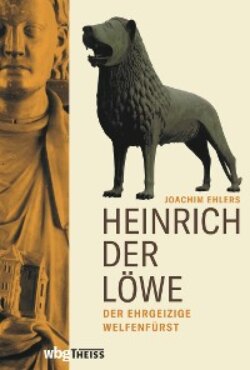Читать книгу Heinrich der Löwe - Joachim Ehlers - Страница 21
Zwischen Dänemark und Rom
ОглавлениеIm Herbst 1156 kehrte Heinrich der Löwe vom Regensburger Hoftag des Kaisers nach Sachsen zurück und mußte sich alsbald wieder mit dem dänischen Thronstreit befassen. Diesmal bat Erzbischof Hartwig ihn um Hilfe für König Sven, den Knut im Bund mit Erzbischof Eskil von Lund aus Dänemark verjagt hatte. Weniger die Sorge um das Schicksal des Dänenkönigs jedoch leitete den Bremer Erzbischof, sondern sein Streben nach stärkerem Einfluß auf die dänische Kirche, der Wunsch nach Erneuerung älterer Pläne zur Errichtung eines Hamburg-Bremer Patriarchats über den gesamten skandinavischen Norden. Der Erzbischof von Lund stand dem als Hindernis entgegen und sollte auf jede mögliche Weise geschwächt werden.
Hilfe für Sven war zugleich Dienst am Kaiser, der den Dänenprinzen in Merseburg zum König gemacht hatte, doch Heinrich der Löwe griff gleichwohl erst ein, als Sven ihm ein bedeutendes Honorar für seine Hilfe anbot. Im Winter 1156/57 versuchte der Herzog mit einem großen Heer, den König aus seinem sächsischen Exil nach Dänemark zurückzubringen, eroberte die Bischofssitze Schleswig und Ripen, drang bis Hadersleben vor und mußte dann den Mißerfolg des Unternehmens einsehen, weil Sven in Dänemark keinen Rückhalt für sein Königtum fand. Das politische Ziel des Feldzuges war offensichtlich unerreichbar, und so zog Heinrich sich im Januar 1157 nach Sachsen zurück.58 Mit einer Intervention von außen war Sven offenkundig nicht zu helfen, aber auch die Ermordung seines Gegners Knut im August 1157 rettete ihm die Krone nicht. Schon zwei Monate später ging sie auf der Grateheide bei Viborg verloren, als Sven in offener Feldschlacht Knuts Verbündetem Waldemar unterlag und auf der Flucht getötet wurde.
Ende Juni war Heinrich der Löwe beim Kaiser in Goslar und stieß am 3. August in Halle zu dem großen Heer, das Friedrich dort für einen Feldzug nach Polen versammelte.59 Noch zu Lebzeiten Konrads III. war Herzog Władisław II. von Polen durch seinen Bruder Bolesław vertrieben worden, der sich jetzt weigerte, dem Kaiser seinen üblichen Tribut weiterzuzahlen und damit die Machtprobe riskierte, denn es war wenig wahrscheinlich, daß Friedrich diese Minderung seines Ansehens hinnehmen würde. Am 22. August setzte das Heer bei Glogau über die Oder und zog der konventionellen mittelalterlichen Kriegstechnik entsprechend eine Spur der Verwüstung durch die Diözesen Breslau und Posen, bis Bolesław sich auf Vermittlung Herzog Władisławs von Böhmen und anderer Fürsten dem Kaiser unterwarf. Er leistete den Treueid, zahlte dem Kaiser, der Kaiserin, den Fürsten und dem Hof beträchtliche Summen und versprach darüber hinaus, mit dreihundert Panzerreitern am nächsten Italienzug Friedrichs teilzunehmen.60
Dieser Zug, der schon am 24. März 1157 auf einem Hoftag in Fulda für Pfingsten 1158 als militärischer Vorstoß gegen Mailand beschlossen worden war,61 versprach schwierig zu werden. Lombardische Städte, besonders Pavia, Como und Lodi, hatten gegen Mailand geklagt, so daß Friedrich diesmal zwangsläufig in die komplizierten und mit äußerster Härte geführten Auseinandersetzungen zwischen den italienischen Kommunen verwickelt werden würde. Außerdem hatte sich das Verhältnis zur römischen Kurie entscheidend verschlechtert, nachdem es im Oktober 1157 auf einem Hoftag in Besançon zu einem aufsehenerregenden und folgenschweren Zwischenfall gekommen war.
Heinrich der Löwe war nicht dabei, als vor einem internationalen Publikum – Gesandte aus Apulien, der Toskana, Venedig, Frankreich, England und Spanien waren erschienen – zwei Legaten des Papstes, die Kardinalpriester Bernhard von San Clemente und Roland von San Marco, Friedrich einen Brief überreichten, in dem Hadrian IV. sich lebhaft darüber beklagte, daß der Kaiser trotz einer ausdrücklichen Bitte des Papstes nichts für die Befreiung des Erzbischofs Eskil von Lund getan habe, der auf seiner Rückreise von Rom in Burgund überfallen und gefangengenommen worden war. Hadrian erinnerte an das mehrfach bewiesene Wohlwollen der römischen Kirche gegenüber dem Kaiser, nannte ausdrücklich die Kaiserkrönung und erklärte seine Bereitschaft, dem Kaiser maiora beneficia zu gewähren, »noch größere Wohltaten«. Friedrichs Kanzler Rainald von Dassel las den Brief der Versammlung vor, übersetzte sogleich und gab das Wort beneficia mit »Lehen« wieder, was vom zeitgenössischen Bedeutungsfeld des Begriffs her gesehen möglich, vom Papst aber wahrscheinlich nicht gemeint war. Sollte Hadrian IV. eine Provokation im Sinn gehabt haben, so hat er doch in einem später geschriebenen Brief dem Kaiser geduldig erklärt, daß das Wort aus den Bestandteilen bonum (Wohl) und factum (Tat) gebildet sei, weshalb beneficium in Italien niemals »Lehen«, sondern vielmehr »Wohltat« bedeute; das entspräche im übrigen dem Wortgebrauch der Bibel, der zufolge die Menschen nicht durch eine Lehnsverleihung Gottes existierten, sondern durch sein Wohltun. In der Tat sagte man in Italien damals feudum, wenn man wirklich »Lehen« im technischen Sinne meinte, aber mit seiner polemischen Übersetzung weckte Rainald Erinnerungen an ein Bild im Lateranpalast, das Lothar von Süpplingenburg als Lehnsmann des Papstes darstellte, und er schürte den Zorn über die vermeintliche Anmaßung Hadrians IV., auch Friedrich als Vasall der römischen Kirche zu betrachten. Als einer der Kardinäle dann noch in den Tumult hineinrief: »Von wem hat er denn das Kaisertum, wenn er es nicht vom Herrn Papst hat?« (A quo ergo habet, si a domno papa non habet, imperium?),62 steigerte das die Erregung so, daß angeblich nur persönliches Dazwischentreten Friedrichs den Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach von einem tätlichen Angriff auf die Legaten abgehalten hat.63
Der Kaiser reagierte scharf. Die Legaten wurden ungnädig entlassen und nach Rom zurückgeschickt; in einem wohl von Bischof Eberhard von Bamberg verfaßten und zur Verbreitung im ganzen Reich bestimmten Rundschreiben schilderte Friedrich die Vorgänge, erläuterte eingehend seine Auffassung des Verhältnisses von imperium und sacerdotium, von weltlicher und geistlicher Gewalt, und erklärte seine Entschlossenheit, unter Einsatz seines Lebens für die Ehre des Reiches (honor imperii) kämpfen zu wollen.64 Der Papst beklagte sich seinerseits über die Vorgänge in Besançon bei den deutschen Bischöfen und forderte sie auf, den Kaiser entsprechend zu ermahnen; Friedrich verlangte im Gegenzug die Zerstörung der Bilder im Lateran, die das Kaisertum herabwürdigten, und schickte in dieser spannungsgeladenen Atmosphäre im Januar 1158 seinen Kanzler Rainald von Dassel und den Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach zur Vorbereitung des Zuges nach Italien.65 Diese Auswahl der Botschafter deutet darauf hin, daß umsichtiges Vorgehen zur Bewältigung des Konflikts nicht das oberste Ziel ihrer Mission sein sollte, denn Rainald von Dassel vertrat eine scharf antikuriale Position, deren kompromißlose Härte in den folgenden Auseinandersetzungen noch verhängnisvolle Wirkung zeigen sollte, während der Pfalzgraf in Besançon seinen Emotionen allzu freien Lauf gelassen hatte.
Wie ernst der Kaiser die militärische Herausforderung des Italienzuges nahm und wie wichtig ihm infolgedessen wirksame Unterstützung war, zeigt die Erhebung Herzog Władisławs von Böhmen zum König auf dem Regensburger Hoftag im Januar 1158; als Anerkennung seiner bisherigen Leistungen für das Reich und als Verpflichtung zu weiterer Loyalität übergab Friedrich ihm eine Krone und fügte, wie der Geschichtsschreiber Rahewin sich ausdrückt, eine »Urkunde über den Gebrauch des Diadems und der anderen Insignien des Königtums« hinzu (privilegium de usu diadematis aliisque regni insignibus), nämlich eine Anweisung für den Ablauf von Festkrönungen zu Weihnachten, Ostern, Pfingsten sowie an den Festtagen der böhmischen Landespatrone Wenzel und Adalbert, bei denen die Bischöfe von Prag und von Olmütz ihrem neuen König nach dem Vorbild von Friedrichs eigener Krönung die Krone aufsetzen sollten.66
Heinrich der Löwe hatte sich unterdessen im Winter 1157/58 mit Hadrian IV. in Verbindung gesetzt, um für das Bistum Ratzeburg und das bayerische Augustinerchorherrenstift Ranshofen Privilegien zu erwirken, die der Papst seinem »teuersten Sohn« (carissimus filius) am 21. und 29. Januar 1158 ausstellte.67 Bei dieser Gelegenheit suchte der Herzog zwischen Kaiser und Papst zu vermitteln und gab Hadrian Ratschläge für dessen weitere Schritte. In einem Brief an den Kaiser hat der Papst sich daraufhin ausdrücklich auf Heinrich den Löwen berufen, der ihm empfohlen habe, Gesandte an Friedrich zu schicken. Diese Initiative des Herzogs fand den Beifall aller, die sich von einer harten Konfrontation wenig versprachen und es durchaus für möglich hielten, die Spannung nicht ins Grundsätzliche steigen zu lassen. Der als Theologe und Kirchenreformer berühmte Propst Gerhoch von Reichersberg lobte in einem Brief an den Herzog, »daß du dich bemühst, die Einheit zwischen Kirche und Reich zu festigen«, so daß »auf deine Vermittlung hin Legaten des apostolischen Stuhls kommen . . . und Frieden bringen«.68 Furcht vor der großen Auseinandersetzung zwischen den Häuptern der Christenheit war keineswegs unbegründet, Erinnerungen an die Zeit Heinrichs IV. waren noch durchaus lebendig, und kein Ereignis hat Otto von Freising stärker irritiert, dauerhafter beschäftigt und auf sein universalhistoriographisches OEuvre intensiver gewirkt als der Kampf zwischen Papst und Kaiser seit Gregor VII. »Mit verbitterter Seele« (ex amaritudine animi),69 schrieb er seinem Neffen Friedrich I., habe er diese Zeit geschildert, für die es seines Wissens nichts Vergleichbares gebe: »Ich lese wieder und wieder die Geschichte der römischen Könige und Kaiser, aber ich finde vor Heinrich (IV.) keinen einzigen unter ihnen, der vom römischen Pontifex exkommuniziert oder abgesetzt worden ist . . .«70 Deutliche Signale der Endzeit hatte er bei der Beobachtung dieses Konflikts empfangen, denn »wie viel Unheil . . ., wie viele Kriege mit ihren verhängnisvollen Folgen daraus entstanden sind, wie oft das unglückliche Rom belagert, erobert und verwüstet, wie Papst gegen Papst und König gegen König gesetzt worden ist, das zu erzählen widerstrebt mir. Kurzum, so viel Unheil, so viele Spaltungen, so viele Gefahren für Leib und Seele bringt der Sturm dieser Zeit mit sich, daß er allein ausreichen würde, durch die Unmenschlichkeit der Verfolgung und deren lange Dauer den ganzen Jammer des menschlichen Elends zu enthüllen.«71
Wie verbreitet die Befürchtungen einer Wiederholung der Krise tatsächlich waren, läßt sich nicht sagen, aber es wurde nach Auswegen gesucht, und in dieser Hinsicht unterschied sich die Position Heinrichs des Löwen offensichtlich von den Intentionen Rainalds von Dassel, der dem Kaiser im Mai 1158 riet, dem Papst gegenüber nicht allzu nachgiebig zu sein und sich von niemandem verleiten zu lassen, päpstliche Legaten gnädig zu empfangen.72 Das kann als Warnung vor den Ratschlägen Heinrichs des Löwen verstanden werden, der sich kurz darauf zugunsten Hadrians IV. sogar militärisch engagierte, als Ausdruck einer tiefgehenden Meinungsverschiedenheit zwischen Herzog und Kanzler über das richtige Verhältnis des Reiches zum Papst.
Als sich das Heer des Kaisers im Juni 1158 auf dem Lechfeld bei Augsburg sammelte, empfing Friedrich dort die Gesandten des Papstes, den Kardinalpriester Heinrich von SS. Nero e Achilleo und den Kardinaldiakon Hyacinth von S. Maria in Cosmedin. Sie überbrachten Friedrich den schon erwähnten Brief, in dem der Papst versöhnliche Töne anschlug und sich deutlich bemühte, die Spannungen zu mindern. Heinrich der Löwe war unter den Versammelten, vor denen Otto von Freising das Schreiben verlas und wohlwollend interpretierend übersetzte. Im übrigen hatten die Legaten Anlaß, sich über die Gefahren ihres Weges nach Deutschland zu beklagen, denn sie waren in Tirol von den Grafen von Eppan in erpresserischer Absicht gefangengenommen und beraubt worden; ohne Rücksicht auf ihren hohen Rang als Gesandte des Papstes zum Kaiser hatte man sie erst freigelassen, nachdem ein Bruder des Kardinals Hyacinth als Geisel gestellt war. Weil die Grafen von Eppan den Frieden in seinem Hoheitsgebiet verletzt und die von ihm empfohlene Gesandtschaft in krimineller Weise bedroht hatten, zog Heinrich der Löwe noch von Augsburg aus zu einer Strafexpedition gegen die Herren nach Tirol.73
Nahezu gleichzeitig, in der zweiten Junihälfte 1158, begann Friedrich seinen Feldzug gegen Mailand mit einem großen Heer, das diesmal auf verschiedenen Routen über die Alpen ging. Während die Herzöge Heinrich von Österreich und Heinrich von Kärnten zusammen mit sechshundert ungarischen Bogenschützen über das Kanaltal, Friaul und die Mark Verona marschierten, zogen Herzog Berthold von Zähringen und das Aufgebot der Lothringer über den Großen Sankt Bernhard; die fränkischen, schwäbischen und niederrheinischen Truppen wählten den Weg über Chiavenna und den Comer See. Der Kaiser nahm mit seiner Begleitung – König Władisław von Böhmen, Herzog Friedrich von Schwaben, Pfalzgraf Konrad bei Rhein, die Erzbischöfe Friedrich von Köln, Arnold von Mainz und Hillin von Trier, die Bischöfe von Eichstätt, Prag, Verden und Würzburg, die Äbte der Reichsklöster Fulda und Reichenau – die Brennerstraße. Heinrich der Löwe folgte diesmal nicht, sondern kam erst im nächsten Jahr nach Italien.
Anfang August stand das Heer zusammen mit den Aufgeboten von Cremona und Pavia vor Mailand. Den Städten, die mit Mailand bitter verfeindet waren, schreibt der Berichterstatter Rahewin die größten Brutalitäten zu, denn sie vernichteten die Weinstöcke, Feigenbäume und Olivenhaine im Umland und töteten Gefangene weithin sichtbar vor den Mauern der Stadt. »Die drinnen dagegen zerhackten die Gefangenen Glied für Glied, um nicht an Grausamkeit unterlegen zu scheinen, und warfen sie dann als jämmerlichen Anblick für ihre Leute über die Mauer.«74 Nach harten Kämpfen begannen Ende August Verhandlungen, weil die Lebensmittelvorräte der belagerten Stadt erschöpft waren. Am 8. September unterwarf sich Mailand dem Kaiser, der daraufhin einen Teil seines Heeres entließ.75
Zwei Monate später, am 11. November 1158, eröffnete Friedrich auf den Feldern bei Roncaglia eine große Reichsversammlung und beriet dort mit den geistlichen und weltlichen Fürsten vierzehn Tage lang über die Erneuerung der Reichsrechte in Italien. Es ging dabei um nichts weniger als um die systematische Sicherung der Herrschaft von Kaiser und Reich in einer Region, deren Wirtschaftskraft in den letzten Jahren stetig gewachsen war und deren Städte als die wesentlichen Träger dieses Aufschwungs sich Schritt für Schritt aus älteren herrschaftlichen Bindungen lösten. Die kommunale Bewegung begründete die Stadtgemeinde als Korporation der Bürger, verlangte politische Mitbestimmung und öffnete Räume persönlicher Freiheit, die es so bisher nicht gegeben hatte. Persönliche Freiheit aus der Stärke der Korporation und mitbestimmte Stadtregierung durch die Ratsverfassung, eidliche Verpflichtung zu gegenseitiger Hilfe und kollektive Freiheit der Stadt bedingten einander, brachten ein hohes Maß an Rationalität durch geregelte Beratung in gewählten Gremien und damit einen Modernisierungsschub, dem die hergebrachten Herrschaftsformen der deutschen Könige und ihres Adels auf die Dauer nicht gewachsen sein sollten. Friedrich I. suchte seinerseits nach modernen Mitteln der Herrschaftslegitimation und vertraute im übrigen auf militärische Stärke, der sich die Städte am Ende würden unterwerfen müssen.
Vier Juristen der Rechtsschule von Bologna hatten im Auftrag des Kaisers mit Hilfe von Richtern aus vierzehn lombardischen Städten ein Gutachten zur Definition der Regalien ausgearbeitet. Diese bestanden demnach im wesentlichen aus der Vollmacht des Kaisers zur Einsetzung von Gerichtsbehörden und zur Güterkonfiskation bei Majestätsverbrechen, aus seiner Oberhoheit über Verkehrswege, Abgaben, Silbergruben, Münze und Strafgelder, aus seinem Anspruch auf vakante Güter und auf außerordentliche Steuererhebung im Kriegsfall. Daraus ergaben sich für den Kaiser nicht nur erhebliche und regelmäßig fließende Einnahmen baren Geldes, sondern er war auch die einzige Quelle aller Herrschafts- und Gerichtsgewalt, oberste Instanz für Landfrieden und Lehnrecht. Die Städte sollten das anerkennen, sich durch Eide auf Achtung dieses Kaiserrechts verpflichten und Geiseln stellen.76 Das war ein Maximalprogramm. Schon im folgenden Jahr zeigte sich, daß Friedrich mit seinen Roncalischen Gesetzen den Bogen überspannt und Anlaß zu einem Konflikt gegeben hatte, der sich bald als unbeherrschbar erweisen sollte.
Als erste wehrten sich die Bürger, zunächst in Crema und Mailand, bald aber auch anderswo, gegen die Einsetzung kaiserlicher Amtleute in ihren Städten, dann protestierte der Papst gegen Versuche, auch den Kirchenstaat diesen Gesetzen zu unterwerfen. Friedrich mußte deshalb im Februar 1159 Boten nach Deutschland schicken, um mit Appellen an die Treuepflicht (fidelitas) militärische Hilfe für die sich anbahnende Auseinandersetzung einzuwerben. Er konnte nicht absehen, wie stark die Unterstützung schließlich sein würde, denn eine allgemeingültige Antwort auf die Frage, wer zur Heerfolge verpflichtet war, gab es nicht, weil kein Reichsrecht vorhanden war, das so etwas hätte regeln können.77 Ob jemand dem Ruf des Königs folgen mußte, ihn überhören durfte, die persönlichen Vorteile und Nachteile einer Beteiligung abwägen konnte, hing im wesentlichen von der Art seiner Beziehungen zum König ab: Hatte er Sanktionen zu erwarten? Durfte er auf Gegenleistungen für seine Heerfolge hoffen? Hatte er die gewissermaßen moralische Verpflichtung des Standesherrn, empfangene Gunst zu vergelten? Bot Königsferne die bessere Voraussetzung für ungestörten Ausbau eigener Landesherrschaft oder war dafür Förderung nötig, die nur aus der Königsnähe kommen würde? Deswegen konnte der Kaiser den Herren nicht viel anderes schreiben, als daß er »ihre Bereitwilligkeit, den Bestand des Reiches zu erhalten und den Angriff der Feinde abzuwehren, auf die Probe stellen« wolle.78
Auch Heinrich der Löwe hat diese Botschaft erhalten und sich in den Monaten April und Mai bemüht, zur Befriedung des Landes für die Zeit seiner Abwesenheit alle in Sachsen schwebenden Konflikte zu regeln. Mit König Waldemar von Dänemark, der ihn gegen ein Honorar von mehr als tausend Mark Silber um Vermittlung zum Abwenden häufiger Angriffe der Slawen gebeten hatte, schloß er Freundschaftspakte und verpflichtete die Slawenfürsten durch Eide zum Frieden gegenüber den Sachsen und Dänen.79 Seine Begegnung mit dem dänischen König und dem Bischof Absalon von Roskilde anläßlich der Verhandlungen über den Freundschaftsbund gestaltete Heinrich der Löwe zur repräsentativen Darstellung seiner Macht und Würde, indem er in seinem Zelt für beide ein Gastmahl mit so ausgesucht raffinierter Speisenfolge und so vielen Adligen beim Tischdienst gab, daß die dänischen Gäste schnell begriffen, daß es hier mehr um den Ruhm (gloria) des Gastgebers als um den Zweck (usus) des Treffens ging.80
Ende Mai 1159 brach Heinrich der Löwe dann mit tausendzweihundert Panzerreitern nach Italien auf; außer dem Grafen Adolf II. von Holstein begleiteten ihn noch andere sächsische und bayerische Adlige. Mit dieser großen Streitmacht übernahm der Herzog das Geleit der Kaiserin Beatrix, die ebenfalls Truppen nach Italien brachte, und am 20. Juli trafen beide beim Belagerungsheer des Kaisers vor Crema ein. Auf der Nordseite der Stadt errichtete Heinrich der Löwe das Lager für seine Truppen.81 Anfang August zog er mit dem Kaiser von Crema aus gegen Mailand, das sich mit Brescia und Piacenza zusammengetan hatte. Die drei Städte suchten das Bündnis mit Papst Hadrian IV. und versprachen ihm, ohne seine Zustimmung niemals Frieden mit dem Kaiser zu schließen; der Papst kam ihnen mit der Ankündigung entgegen, den Kaiser binnen vierzig Tagen zu exkommunizieren. Zum erstenmal nahm das später so wirkungsvolle Bündnis der lombardischen Städte mit dem Papst konkrete Form an. Wegen Mangel an Pferdefutter, der ewigen Schwachstelle mittelalterlicher Reiterheere, mußten der Kaiser und der Herzog ihr Unternehmen allerdings bald abbrechen; sie wandten sich wieder der Belagerung von Crema zu und setzten jetzt eigens konstruierte Belagerungsmaschinen ein. Heinrich der Löwe hat sie genau studiert und später im Krieg nördlich der Elbe ähnliches Gerät verwendet.
Vor Crema erhielt der Kaiser die Nachricht vom Tod Papst Hadrians IV., der am 1. September 1159 gestorben war. Seit der Weigerung der deutschen Fürsten, nach der Kaiserkrönung im Sommer 1155 den vom Kaiser dem Papst in Aussicht gestellten Feldzug gegen die Normannen in Süditalien anzutreten, hatte sich Hadrian IV. neu orientieren müssen, weil es König Wilhelm I. von Sizilien inzwischen gelungen war, sich gegen adlige Opposition und byzantinische Angriffe durchzusetzen, so daß er nun aggressiv gegen den Kirchenstaat vorgehen konnte. Um dem zuvorzukommen, schloß der Papst mit Wilhelm im Juni 1156 in Benevent einen Vertrag und belehnte ihn mit dem Königreich Sizilien, dem Herzogtum Apulien und dem Fürstentum Capua, so daß die normannische Königsherrschaft jetzt öffentlich als legitim anerkannt war. Darüber hinaus garantierten sich Papst und Normannenkönig ihre jeweiligen territorialen Besitzstände, so daß es fortan geregelte Beziehungen zwischen ihnen gab, während sich das Verhältnis führender Vertreter der Kurie zum Kaiser deutlich verschlechterte. Diese Spaltung des Kardinalskollegiums in eine kaiserfeindliche Mehrheit und eine prokaiserliche Minderheit war durch die Versuche zur Anwendung der Roncalischen Gesetze auf den Kirchenstaat vertieft worden und wirkte sich am 7. September bei der Wahl des Nachfolgers Hadrians IV. aus.
Die Mehrheit, etwa zwei Drittel der Kardinäle, sprach sich für den Kanzler der Kurie Roland Bandinelli als Papst Alexander III. aus, während die Minderheit den Kardinal Oktavian als Viktor IV. erhob.82 Weil es weder ein Mehrheitswahlrecht noch eine im Falle des Dissenses entscheidungsbefugte Institution außerhalb des Kardinalkollegiums gab, blieb es nun der gesamten lateinischen Christenheit überlassen, welchem der beiden Päpste sie folgen wollte und welches Ordnungsprinzip sich durchsetzen sollte: Die vom kanonischen Recht definierte Autorität des Papstes oder die römischrechtlich zur Amtsgewalt erklärte Autorität des deutschen Königs als römischer Kaiser. Roland Bandinelli war ein bedeutender Jurist, der in Bologna gelehrt hatte; als Berater und Legat Hadrians IV. hatte er 1157 auf dem Hoftag von Besançon die Auseinandersetzung mit Rainald von Dassel geführt, so daß seine Position für jedermann klar erkennbar war. Oktavian gehörte zu einer der führenden Familien in der Sabina, den Monticelli, die als Seitenlinie der römischen Crescentier zum europäischen Hochadel gerechnet wurden. Er galt als specialis amator Theutonicorum, als besonderer Freund der Deutschen,83 und hatte mehrfach Gesandtschaften zu Friedrich I. übernommen.
Gleich nach der Wahl versuchten Pfalzgraf Otto von Wittelsbach und Graf Guido von Biandrate als Gesandte Friedrichs in Rom vergeblich, Viktor IV. zu allgemeiner Anerkennung zu verhelfen. Der Kaiser selbst schickte sogleich den Bischof Wilhelm von Pavia nach Frankreich, um König Ludwig VII. klarzumachen, was er schon von den deutschen, burgundischen und aquitanischen Großen verlangt hatte: Der neue Papst müsse dem honor imperii, der Ehre des Reiches, ebenso gerecht werden wie dem Frieden und der Einheit der Kirche. Das bedeutete, wie Friedrich am 16. September von Crema aus an Erzbischof Eberhard von Salzburg schrieb, daß niemand sich voreilig und ohne Absprache mit ihm für einen der Gewählten entscheiden dürfe.84 Um angesichts der Papstkrise die lombardischen Städte einzuschüchtern, versammelte der Kaiser zwei Tage später die wichtigsten Großen im Zelt Heinrichs des Löwen, verkündete die Reichsacht über die Bewohner von Crema und sprach den Bürgern aller anderen Städte, soweit sie sich derzeit in Crema aufhielten, ihre Eigengüter und Lehen ab.85
Immer noch hielt Crema indessen der Belagerung stand. Ende September kam Welf VI. mit dreihundert Panzerreitern aus Deutschland an und bezog Stellungen im Osten der Stadt, ebenso viele Reiter brachte der Ende Juli zum Erzbischof von Köln gewählte Kanzler Rainald von Dassel über die Alpen mit zurück.86 Nun befahl der Kaiser »dem Kanzler Roland und den Kardinälen, die ihn zum Papst gewählt haben«, auf einem Konzil zu erscheinen, das er für den 13. Januar 1160 nach Pavia einberufen hatte, und sich dort dem internationalen Schiedsgericht zu stellen. Zu diesem Konzil lud er in einer Vielzahl von Briefen »die beiden, die sich römische Päpste nennen«, ein, ferner »alle Bischöfe unseres Reiches und anderer Königreiche, nämlich Frankreichs, Englands, Spaniens und Ungarns«. König Heinrich II. von England wurde ausdrücklich gebeten, so viele Vertreter der englischen Kirche wie möglich nach Pavia zu schicken und sich vorerst neutral zu verhalten.87
Anfang November erschienen Gesandte Alexanders III. vor Crema, wo sie der Kaiser nur auf dringenden Rat der Fürsten und auch dann noch höchst unwillig empfing. Ein entschiedener Anhänger Alexanders III., der Kardinaldiakon Boso, einst Kämmerer Hadrians IV., hat sechs Jahre später aufgeschrieben, daß Friedrich die Gesandten hätte hängen lassen, wenn Welf VI. und Heinrich der Löwe nicht persönlich dagegen eingeschritten wären.88 Selbst wenn dieser Bericht tendenziös entstellt ist, bleibt doch die Frage, warum Boso als Retter der Legaten ausgerechnet Welf VI. und Heinrich den Löwen ausgewählt hat. Offenbar konnte man ehestens diesen beiden eine solche Aktion zutrauen, denn sowohl durch die Vermittlungstätigkeit im Winter 1157/58 als auch durch seine Strafexpedition gegen die Grafen von Eppan hatte Heinrich der Löwe einen bestimmten Ruf erworben.
Unterdessen zog sich die Belagerung von Crema unerwartet lange hin, so daß der Kaiser die Geduld verlor und vierzig von der Stadt gestellte Geiseln hinrichten ließ, anschließend noch sechs vornehme Mailänder Ritter, darunter den Neffen des Erzbischofs von Mailand. Weil die Belagerungsmaschinen von den Mauern aus sehr wirkungsvoll beschossen wurden, ließ Friedrich Gefangene vor die anrollenden Holztürme binden, aber die Verteidiger schonten weder ihre Mitbürger noch Freunde oder Verwandte, sondern töteten sie im fortgesetzten Einsatz der Steinschleudern.89 Später, im November oder Dezember, gelang es dann, den Stadtgraben von Crema teilweise aufzufüllen und mit dem darüber geführten Rammbock eine Bresche in die Mauer zu schlagen, doch die Stadt konnte dadurch nicht genommen werden, so daß der Kaiser den Termin des Konzils vom 13. Januar auf den 2. Februar verschieben mußte. Immerhin rechnete man demnach doch mit dem baldigen Fall der Stadt, zumal es in der ersten Januarhälfte gelungen war, den leitenden Ingenieur der Verteidigungswerke gegen ein hohes Honorar auf die kaiserliche Seite zu ziehen. Solche Spezialisten waren teuer bezahlte, sehr gesuchte und deshalb unabhängige Leute, die einen herrenmäßigen Lebensstil pflegen konnten und ritterlich lebten. Dem übergelaufenen Cremenser Meister Marchese schenkte der Kaiser jedenfalls als Begrüßungsgabe ein für den Kampf sorgfältig abgerichtetes Streitroß (desterius). Sogleich baute Marchese eine neuartige Angriffsmaschine, von der eine Brücke nach vorn ausgeklappt werden konnte, und mit diesem Gerät begann am 21. Januar der Sturm auf Crema. Wieder wurde mit großer Härte gekämpft; eigenhändig tötete der Kaiser als vorzüglicher Bogenschütze mehrere der Verteidiger. Dem Ritter Bertolf von Urach, der im ersten Sturmtrupp in die Stadt eingedrungen und dabei ums Leben gekommen war, zog einer der Verteidiger die Kopfhaut ab und band sie an seinen Helm, »nachdem er sie vorher aufs sorgfältigste gekämmt hatte«.90 Selbst dieser Angriff führte noch nicht zum Ziel, doch immerhin willigten die Bürger von Crema jetzt in Verhandlungen ein, die Heinrich der Löwe gemeinsam mit dem Patriarchen Pilgrim von Aquileja führte und dabei eine Kapitulation gegen freien Abzug mit tragbarer Habe vereinbarte. Am 26. Januar gewährte der Kaiser auf dieser Grundlage Frieden. Er blieb noch bis zum Ende des Monats am Ort, um die Zerstörung der Stadt einzuleiten, bei der sich die Bürger von Cremona besonders hervortaten.91
Heinrich der Löwe hatte an allen diesen Kämpfen teilgenommen und reiste mit dem Kaiser am 2. oder 3. Februar nach Pavia ab, wo Friedrich am 5. Februar das Konzil eröffnete. Im vollen Bewußtsein seiner Kompetenzen als Schutzherr der römischen Kirche behandelte Friedrich das Schisma als Rechtsstreit um die Frage, wer der rechtmäßige Papst sei. Er sah sich dabei als Nachfolger der römischen Kaiser Justinian und Theodosius, die solche Fragen entschieden hatten,92 und knüpfte auch an die Position Kaiser Heinrichs III. an, der 1046 auf der Synode von Sutri über mehrere Päpste gerichtet hatte. Obwohl nach den Umwälzungen der gregorianischen Reform kaum noch auf allgemeine Anerkennung einer solchen kaiserlichen Kompetenz gerechnet werden durfte, versuchte Friedrich die Wahl Viktors IV. nachträglich zu legitimieren und das Schisma mit der Exkommunikation Rolands rasch zu beenden.
Schon die Beteiligung an seinem Konzil aber mußte dem Kaiser die engen Grenzen seines Handlungsspielraums vor Augen führen, denn es kamen etwa fünfzig Erzbischöfe und Bischöfe, sehr viele Äbte und Pröpste aus Deutschland und Reichsitalien, nicht hingegen Vertreter der französischen und der englischen Kirche, auch nicht Alexander III., der jedes Gericht über einen Papst als illegal ansah. Nach der Eröffnung verließ der Kaiser die Versammlung, die nunmehr allein beriet und sich nach wenigen Tagen für Viktor IV. entschied. Dieses Ergebnis war als solches nicht überraschend, aber Heinrich dem Löwen zeigten die zugrunde liegenden Voten künftige Schwierigkeiten an. Vom deutschen Episkopat hatten sich zwar die Erzbischöfe von Mainz, Köln, Magdeburg und Bremen samt ihren Suffraganen mit mehr oder weniger großen Bedenken für den kaiserlichen Papst ausgesprochen, aber die Erzbischöfe von Trier und Salzburg erklärten sich für Alexander III., die Bischöfe von Bamberg, Passau und Regensburg wollten ihre Entscheidung vom Votum der gesamten Kirche abhängig machen; die Botschafter der Könige von Frankreich und England äußerten sich gar nicht, sondern forderten kaiserliche Gesandtschaften an die Höfe Ludwigs VII. und Heinrichs II. Obwohl alle Bistümer seines bayerischen Herzogtums zur Diözese Salzburg und damit nach der Entscheidung Erzbischof Eberhards nun zur Obödienz Alexanders III. gehörten, stimmte Heinrich der Löwe für Viktor IV., ebenso hielten es die Herzöge Welf VI., Berthold von Zähringen und Friedrich von Schwaben.93
Nach dieser Entscheidung und bei näherer Analyse des Abstimmungsverhaltens, der offenen oder versteckten Opposition, durfte sich der Kaiser keineswegs als Sieger fühlen, denn jetzt würde auf europäischer Ebene der Kampf um die allgemeine Anerkennung des rechten Papstes beginnen und auch mit den Mitteln einer frühen Publizistik durch Briefe, Streitschriften und Rundschreiben geführt werden müssen. Unter dem Druck ihrer Landeskirchen neigten Ludwig VII. von Frankreich und Heinrich II. von England eher zu Alexander III., auf dessen Seite sich auch der einflußreiche Zisterzienserorden stellte. Besonderes Gewicht hatte das Milieu der französischen hohen Schulen, denn dort studierten viele Ausländer, die in ihrer Heimat schon hohe Kirchenämter innehatten oder dafür vorgesehen waren. In Paris hörten sie überzeugende Argumente zugunsten Alexanders III. Im Sommer 1160 schrieb Johannes von Salisbury, der durch Studien in Frankreich gebildete Sekretär und Berater des Erzbischofs Theobald von Canterbury, an den ihm befreundeten englischen Magister Radulf von Sarre nach Frankreich, daß die Vorgänge in Besançon gezeigt hätten, wie frühzeitig Friedrich begonnen habe, Roland als seinen Feind zu betrachten, und daß deshalb zu befürchten sei, der Kaiser werde Ludwig VII. von seinem bis jetzt noch festen alexandrinischen Standpunkt abbringen. Die Beschlüsse des Konzils von Pavia, auf dem der Kaiser die nur Gott unterstellte römische Kirche zu richten gewagt habe, seien nicht akzeptabel, denn: »Wer hat die universale Kirche dem Urteil einer partikularen unterworfen? Wer hat die Deutschen zu Richtern über die Nationen bestellt? Wer hat diesen rohen und heftigen Menschen die Vollmacht gegeben, einen Fürsten ihrer Wahl über die Häupter der Menschenkinder zu setzen? Tatsächlich hat ihre blinde Raserei (furor) das immer wieder versucht, aber durch Gottes Willen ist es jedesmal gescheitert, und sie haben sich für ihr eigenes Unrecht geschämt.«94 Mochte hier auch ein besonderes Ressentiment gegen die Deutschen die Feder führen, so hatte Johann von Salisbury doch in einem entscheidenden Punkt recht: Noch niemals in der jüngeren Kirchengeschichte seit der Mitte des 11. Jahrhunderts hatte sich ein kaiserlicher Papst gegen den gewählten Konkurrenten behauptet. Es war keineswegs sicher, daß Friedrich seinen Kandidaten gegen den vorhersehbaren Widerstand würde durchsetzen können, wenn sich alle antikaiserlichen Kräfte hinter Alexander III. versammelten.
Nach dem Konzil von Pavia beriet sich der Kaiser mit den Fürsten über das weitere Vorgehen und entließ daraufhin das Heer. Nach den verwüstenden Feldzügen zweier Jahre hielt er es für zweckmäßig, »wenn das Land einige Ruhe habe und sich erhole, bis es nach der Feldbestellung im kommenden Jahr neue Heimsuchungen ertragen und ein neues Heer aufnehmen und ernähren könne«.95 Damals ging auch Heinrich der Löwe mit seinem Aufgebot nach Sachsen zurück, während der Kaiser selbst gemeinsam mit Herzog Friedrich von Schwaben, Pfalzgraf Konrad bei Rhein, Pfalzgraf Otto von Wittelsbach und einigen anderen Fürsten in Italien blieb.96