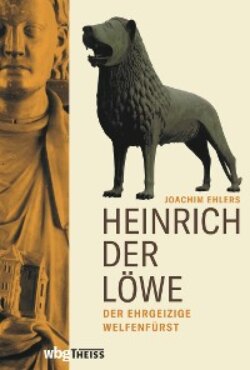Читать книгу Heinrich der Löwe - Joachim Ehlers - Страница 14
Das Land nördlich der Elbe
ОглавлениеDie sächsischen Unsicherheiten hatten sich auch auf Nordalbingien ausgewirkt, zumal die einheimischen Holsten keineswegs damit einverstanden waren, daß Lothar III. dort einen Grafen eingesetzt hatte. Sie empfanden das Wirken Adolfs II. vielmehr als neuartige herrschaftliche Bedrohung der altüberkommenen Freiheit einer bäuerlichen Kriegergesellschaft, für die »Stehlen und Verschwenden Zeichen des Ansehens sind. Einer der nicht Beute machen kann, ist dumm und ruhmlos.«42 Wer unter solchen Voraussetzungen die Rechtsprechung im Grafengericht durchsetzen wollte und das Fehdewesen der Familien mit Hilfe des allgemeinen Landfriedens allmählich kriminalisierte oder Heerfolge beim gräflichen Aufgebot verlangte, setzte in der Tat einen tiefgreifenden Prozeß der Zivilisierung und Modernisierung in Gang, der Holstein an die Organisationsstandards des karolingisch geprägten Reiches heranführen würde und damit den Widerstand des hochkonservativen Landes provozierte. Zu diesen Standards gehörte auch eine Kirchenorganisation, für die es bisher kaum mehr als schwache Ansätze gab.
Seit Mitte der zwanziger Jahre hatte der Priester Vicelin im Auftrag Erzbischof Adalberos von Bremen als Missionar im slawischen Grenzgebiet gearbeitet und das Chorherrenstift Neumünster gegründet. Auf Grund seiner großen Erfahrung und eines offenbar gut entwickelten Sinns für pragmatisches Handeln wurde er zum wichtigsten Berater Lothars III. für den nordelbischen Raum, und einem Hinweis Vicelins folgend ließ der König 1134 auf einer Anhöhe in Wagrien die Burg Segeberg erbauen. Zu ihren Füßen gründete er ein Kanonikerstift, von dem Mission und erste Ansätze einer Pfarreiorganisation ausgehen sollten. Der holsteinische Pfarrer Helmold von Bosau, dem wir ungewöhnlich detaillierte und farbige Schilderungen dieser norddeutschen Welt im Wandel verdanken, hat hier seine erste Ausbildung erhalten, die er an der Stiftsschule St. Blasius in Braunschweig fortsetzte; die bewegte Geschichte der Region hat er aus nächster Nähe erlebt und als zutiefst betroffener Zeitgenosse zwischen 1163 und 1172 in seiner Chronik ausführlich beschrieben.43
Das Land nördlich der Elbe
Östlich des alten Limes Saxoniae, des »Sächsischen Limes« zwischen Elbe und Kieler Förde, erstreckte sich bis zur Warnow das Gebiet eines slawischen Großstammes mit den Teilstämmen der Wagrier, Polaben und Abodriten; die Abodriten haben dem Großstamm ihren Namen gegeben, Kessiner und Zirzipanen schlossen sich ihm an. Der Raum zwischen Peene und Oder galt als Einflußgebiet der Pomoranen (»Pommern«), die ihr eigentliches Herrschaftsgebiet weiter östlich zwischen Oder und Weichsel hatten. Die Insel Rügen und das südlich anschließende Küstengebiet der Ostsee gehörten den Ranen.
Die Erschließung der nordelbischen Gebiete für die sächsische Herzogsgewalt hatte soeben erst begonnen, als Lothar starb und die folgenden Kämpfe zwischen Heinrich dem Stolzen und Albrecht dem Bären die frühen Organisationsstrukturen an der Slawengrenze erheblich gefährdeten. Albrecht der Bär vertrieb Adolf II. von Schauenburg aus der Doppelgrafschaft Holstein-Stormarn, denn der Graf hielt unbeirrbar fest zu Richenza und Heinrich dem Stolzen. Im Jahre 1138 setzte Albrecht Heinrich von Badwide an Adolfs Stelle, einen bisher ganz unbekannten Adligen aus der Gegend von Uelzen. Dieser Wechsel gelang deshalb, weil Adolf II. keine Unterstützung bei den Holsten fand, die vielmehr froh waren, den Vertreter herzoglicher Gewalt mit seinen Aktivitäten gegen die Autonomie der altholsteinischen Familienverbände losgeworden zu sein. Anders als sein Vorgänger scheint Heinrich von Badwide kluge Rücksicht auf solche Empfindlichkeiten genommen zu haben, denn er wurde zunächst akzeptiert, wobei auch Einsicht der Holsten in die akute Gefährdung ihres Landes mitgewirkt haben mag, dessen Abwehrkräfte nicht durch innere Konflikte geschwächt werden durften. Helmold von Bosau beklagte die Herrschaft der beiden Slawenfürsten Pribislaw in Wagrien und Polabien und Niklot im Gebiet der Abodriten, denn sie seien nach außen aggressiv und hätten in ihren Gebieten die heidnische Reaktion gestärkt. »Außer Hainen und Hausgöttern, von denen Fluren und Ortschaften voll waren, wurden am meisten verehrt Prove, der Gott des Oldenburger Landes, Siwa, die Göttin der Polaben, und Radigast, der Gott im Gebiet der Abodriten. Sie hatten eigene Priester, besondere Opfer und verschiedene Kultformen . . . Unter den vielgestaltigen Gottheiten der Slawen ragt Swantewit hervor, der Gott von Rügen; . . . darum opfern sie ihm zu Ehren alljährlich einen Christen, auf den das Los gefallen war. Sie schicken dorthin aus allen slawischen Ländern festgesetzte Abgaben zu den Opfern.«44
Weil die Religion der Slawen anders als die christliche nicht universal auf alle Menschen bezogen war, sondern gentil auf Gruppen und Verbände mit jeweils besonderen Göttern, war ihr durch Mission schwer beizukommen, denn die Existenz der Gruppe hing von der gemeinsamen Verehrung derselben Götter ab. Die Leitung dieser Kulte war Priestern anvertraut, denen die enge Verbindung von politisch-sozialer Integration und Religion ebenso bewußt war, wie ihnen die persönlichen Konsequenzen für den Fall vor Augen standen, daß christliche Missionare Erfolg hatten und die alten Götter beseitigten. Jeder getaufte Slawenfürst mußte deshalb in Rechtfertigungszwänge geraten, gefährdete seine gesellschaftliche Stellung, seine politische Autorität, seine Herrschaft. Dennoch war das Heidentum nach Helmolds Meinung nur deshalb wieder so stark geworden, weil der sächsische Adel alle Missionserfolge immer wieder zunichte gemacht hatte, indem er rigorose Abgaben- und Tributforderungen an die soeben getauften Slawen stellte. »Vom Christentum war keine Rede« (de Christianitate nulla fuit mentio), sondern es ging um Ausbeutung, und deshalb tadelt Helmold scharf »die Vornehmen der Sachsen, die . . . am Werke des Herrn stets unfruchtbar und unnütz befunden worden sind«.45
Das Ergebnis dieses unklugen Verhaltens ließ nicht lange auf sich warten. Im Jahre 1138 griff Pribislaw Segeberg von Wagrien aus an, zerstörte Siedlungen im Umland und auch das Stift, so daß die Kanoniker über die Trave nach Högersdorf flüchten mußten. Im folgenden Winter holte dann Heinrich von Badwide an der Spitze eines Aufgebots der Holsten und Stormarner zum Gegenschlag aus und fiel in Wagrien ein, im Sommer darauf eroberten die Holsten auf eigene Faust die Burg Plön, denn inzwischen hatte Heinrich von Badwide aus der Grafschaft weichen müssen. Er hatte seinen Rückhalt verloren, weil Albrecht der Bär im Mai 1139 seine sächsische Herzogswürde aufgegeben hatte und Heinrich der Stolze Adolf II. wieder einsetzte. Auf seinem Rückzug brach Heinrich von Badwide die Burgen in Hamburg und Segeberg, um den Konkurrenten zu schwächen. Auf diese Weise setzten sich Konflikte fort, die ihren Ursprung auf der Ebene von Reich und König hatten, von dort auf den sächsischen Dukat und schließlich auf die regionale Ebene durchschlugen, wo sie dann vollends in Selbstzerstörung mündeten. Die Belehnung Heinrichs von Badwide mit Wagrien durch Gertrud gleich nach dem Tod Heinrichs des Stolzen zeigt das deutlich. Ob die Herzogin die Entscheidung ihres Gemahls aus persönlicher Abneigung gegen Adolf II. umstieß, wie Helmold meint,46 oder im Sinne der Wünsche Konrads III. handelte, wird sich nicht mehr klären lassen, die Tatsache selbst aber ist ein deutlicher Hinweis auf die widerstreitenden Kräfte in der Krisenregion nördlich der Elbe.
Der Tod Heinrichs des Stolzen hatte Adolf II. geschadet und Heinrich von Badwide begünstigt; ein anderer Todesfall kehrte das Verhältnis nicht einfach wieder um, sondern machte den Weg frei für einen klugen Vergleich, der zur dauerhaften Konsolidierung führen sollte. Sobald Gertrud 1143 »aus den Angelegenheiten des sächsischen Herzogtums ausgeschieden war« (alienata est a negociis ducatus), begab sich Adolf II. zu Heinrich dem Löwen und seinen Beratern (consiliarii), um Wagrien zurückzubekommen. Die klugen Räte des noch unmündigen Herzogs – wir wissen nicht, wer sie waren – brachten ein konsensfähiges und für die Zukunft erstaunlich haltbares Abkommen zustande, das Heinrich dem Löwen seinen Weg im Norden erst eigentlich gebahnt hat: Adolf II. wurde als Graf in seine alte Stellung zurückgeführt und erhielt gegen eine beträchtliche Ablösezahlung Wagrien mit dem Burgplatz Segeberg als Zentrum, für Heinrich von Badwide richtete man im Land der Polaben eine neue Grafschaft um die schon in slawischer Zeit existierende Ratzeburg ein.47 Bisher hatte in diesen Gebieten Pribislaw geherrscht, der fortan aus den Quellen verschwindet und erst im Jahre 1156 als privatisierender Grundherr in der Nähe von Oldenburg wieder erwähnt wird.48
Für den Schauenburger bedeutete das Abkommen einen großen Erfolg. Die Grafschaft Holstein-Stormarn reichte jetzt bis zur Ostsee, und Wagrien war Kolonialland, in dem Adolf ohne einschränkende Konkurrenz einheimischer Familien als Graf wirken konnte und noch dazu die Chance zum Aufbau einer eigenen Landesherrschaft hatte. Diese offene Struktur einer peripheren Großregion sollte den Raum alsbald auch für Heinrich den Löwen zu einem seiner wichtigsten Herrschaftskomplexe werden lassen. Hier hat er am Rande des Königreiches ein Reich begründet und dessen Grenzen durch Eroberung wesentlich erweitert, eine von Ministerialen dominierte Verwaltung geschaffen und die eigenen Kompetenzen so weit steigern können, daß er Bischöfe einsetzte. Damit übte er ein Recht aus, das im ganzen Reichsgebiet sonst nur dem König zustand: Für das Land nördlich der Elbe erlangte der Herzog die Kirchenhoheit.
Adolf von Schauenburg hat seine neuen Möglichkeiten sogleich genutzt und von den Erfahrungen seiner früheren Amtszeit im Norden so weit profitiert, daß er im Umgang mit den Einheimischen diesmal geschickter war. »Er brachte seinem Volke Gerechtigkeit, schlichtete Streitsachen und befreite Unterdrückte aus der Gewalt der Mächtigen. Dem Klerus war er besonders zugetan und ließ ihn weder in Werken noch in Worten von jemandem beleidigen. Viel Mühe gab er sich, die aufsässigen Holsten zu bändigen; das ist nämlich ein freiheitsliebendes, halsstarriges Volk, bodenständig und wild, das das Joch des Friedens nicht tragen wollte. Doch dieser Mann überwand sie mit Klugheit, und er hatte über sie nachgedacht (philosophatus est in eis). Mit bezaubernden Gesängen lockte er sie heran, bis er diesen, ich möchte sagen: ungezähmten Wildeseln den Zaum übergeworfen hatte.«49 Er baute die Burg Segeberg wieder auf und leitete sogleich die Besiedlung seiner dünn bevölkerten Grafschaft ein, indem er Boten nach Flandern, Holland, Westfalen und Friesland schickte mit der Nachricht, daß jeder, der zu wenig Land besitze, mit seiner Familie zuwandern könne, um wertvollstes Acker- und Weideland zu erhalten. Auch die Holsten ermunterte er entsprechend, so daß alsbald große Siedlungskomplexe ausgelegt werden konnten, in denen die Einwanderer nach eigenem Recht unter gräflichem Schutz leben würden: für die Holsten westlich von Segeberg, an der Trave und nach Norden in Richtung auf den Plöner See; für die Westfalen östlich von Segeberg; für die Holländer in der Gegend von Eutin; für die Friesen südöstlich von Eutin im Raum Süsel. In diesen Gebieten existierten, wie aus der Verteilung slawischer (Bosau, Eutin, Zarnekau) und deutscher (Blumental, Meinsdorf, Rodensande) Ortsnamen im Raum Eutin hervorgeht, spätslawische und frühe deutsche Siedlungen weiterhin nebeneinander, zu Vertreibungen mußte es nicht kommen. Allein das Oldenburger Land mit den Küstenregionen blieb gegen Tributzahlungen den Slawen vorbehalten,50 und in dieses Reservat hatten die neuen Herren Pribislaw offensichtlich abgedrängt. Mit dem Abodritenfürsten Niklot schloß Adolf II. Freundschafts- und Schutzabkommen (amiciciae), um dem Land Frieden zu sichern. Der Bericht Helmolds gibt ungewöhnlich genaue Nachrichten über diese erste Phase der hochmittelalterlichen Ostsiedlung, bei der große Bevölkerungsgruppen aus dem westlichen Altsiedelland über die Elbe/Saale-Linie hinwegzogen und damit die alte, seit der Zeit Karls des Großen nicht veränderte Ostgrenze des Reiches immer massiver überschritten.
Graf Adolf II. leitete jedoch nicht nur die große Siedlungsbewegung des Hochmittelalters ein, sondern gründete auch den späteren Vorort des mittelalterlichen und neuzeitlichen Ostseehandels, indem er 1143 an der Trave oberhalb einer 1138 zerstörten slawischen Burgstadt Liubice (»Alt-Lübeck«) auf einer von Trave und Wakenitz gebildeten Halbinsel einen Fernhandelsplatz anlegte. Von der älteren slawischen Anlage übernahm er den Namen Lubeke/Lübeck, und wahrscheinlich sind Fernhändler aus dem zerstörten Liubice an den neuen Ort gekommen, der wohl in der Gegend der heutigen Petrikirche gelegen hat. Auf der Trave konnte die Ostsee erreicht werden, ein Hafen war am Ufer mit einfachen Mitteln anzulegen, und die Fernkaufleute brachten ihre Erfahrungen ein, so daß der Ort sehr schnell die bestehenden Handelsverbindungen aus dem Hinterland in die Ostsee auf sich zog.51 So mächtig sollte die Gründung Adolfs von Schauenburg aufblühen, daß Heinrich der Löwe zehn Jahre später seine Hand darauf legte.