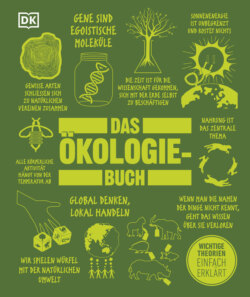Читать книгу Big Ideas. Das Ökologie-Buch - John Farndon - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеÖKOLOGISCHE VORGÄNGE
1917
Joseph Grinnell veröffentlicht seine Forschungen zur Kalifornienspottdrossel und führt die Theorie der ökologischen Nische ein.
1957
Robert MacArthurs Forschungen an Waldsängern in Nordamerika zeigen, wie verschiedene Arten die direkte Konkurrenz vermeiden und koexistieren.
1965
Dan Janzen beobachtet die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Akazien und Ameisen und schließt auf die Entwicklung einer mutualistischen Symbiose.
1925–1926
Die Lotka-Volterra-Regeln beschreiben mit mathematischen Gleichungen die Wechselwirkung zwischen Räuber und Beute.
1961
Joseph Connell zeigt, dass verschiedene Seepocken in verschiedenen Gezeitenzonen leben, obwohl sie in allen Zonen leben könnten.
1969
Robert Paine prägt den Begriff »Schlüsselarten« für Arten, die eine Schlüsselrolle innerhalb eines Ökosystems innehaben.
1970er
Roy Anderson und Robert May zeigen, wie Epidemien Wachstumsraten von Populationen beeinflussen.
1977
Veröffentlichungen von Ronald Pulliam, Eric Charnov und Graham Pyke beschreiben die Theorie des optimalen Nahrungserwerbs, nach der Tiere versuchen, bei der Suche nach Ressourcen möglichst wenig Energie aufzuwenden.
2002
Robert Sterner und James Elser sind Pioniere der ökologischen Stöchiometrie. Dabei geht es darum, wie Mengenverhältnisse chemischer Elemente in Organismen diese beeinflussen und von Reaktionen beeinflusst werden.
1972
Knut Schmidt-Nielsen veröffentlicht How Animals Work. Sein Buch beeinflusst die Ökophysiologie enorm.
1991
Earl Werner veröffentlicht seine Ergebnisse zu nicht konsumtiven Effekten von Räubern auf Beutepopulationen.
Im 5. Jahrhundert vor Christus erkannte der griechische Historiker Herodot, dass Krokodile ihre Mäuler öffnen, damit bestimmte Vögel Kleintiere aus ihren Zähnen herauspicken konnten. Er beschrieb damit wohl als Erster einen ökologischen Prozess, in diesem Fall eine Symbiose zwischen Reptilien und Vögeln. Im 4. Jahrhundert beobachteten Aristoteles und Theophrastos weitere Interaktionen zwischen Tieren und ihrer Umwelt.
In den zwei Jahrtausenden danach fanden zahllose weitere Naturbeobachtungen statt. Ein grundlegendes Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt war aber schwierig, weil man sehr kleine Objekte sowie Vorgänge in der Nacht und unter Wasser nicht beobachten konnte. Zudem konnten die meisten Naturinteressierten kaum mehr als ihre unmittelbare Umgebung erkunden. Mit fortschreitender Technik und verbesserten Reisemöglichkeiten wurden Forschern wie Robert Hooke, Antoni van Leeuwenhoek, Carl von Linné, Alexander von Humboldt, Alfred Russel Wallace, Charles Darwin und Johannes Warming ökologische Vorgänge zunehmend bewusst. Sie legten die Basis für die Ökologie als Wissenschaft, auch wenn sie das Wort noch nicht verwendeten.
Mathematische Modelle
Schon früh erkannte man, dass einer der grundlegendsten ökologischen Prozesse der Kampf ums Überleben ist: Pflanzenfresser müssen Pflanzen finden, Fleischfresser ihre Beute und Beutetiere müssen Räubern entkommen. Räuber tun ihr Möglichstes, um ihre Beutetiere zu jagen, und diese tun ihr Möglichstes, um nicht gefressen zu werden. 1920 führte Alfred Lotka eines der ersten mathematischen Modelle der Ökologie ein. Die heute Lotka-Volterra-Modell genannten Räuber-Beute-Gleichungen sagen die Populationsschwankungen der beiden Gruppen vorher.
Anfang des 20. Jahrhunderts führte Joseph Grinnell in den USA umfangreiche Studien bezüglich der Ansprüche von Tieren an ihren Lebensraum durch. Demnach besetzen Arten bestimmte »Nischen« – und wenn zwei Arten ähnliche Nahrungsbedürfnisse haben, wird eine die andere verdrängen. Darwin hatte das schon bei der Reise mit der Beagle beobachtet, Grinnells Axiome führten die Idee weiter. 1934 zeigte Georgi Gause im Labor, was er das Konkurrenzausschlussprinzip nannte. William E. Odum meinte im Jahr 1959, »die ökologische Nische eines Organismus hängt nicht nur davon ab, wo er lebt, sondern auch davon, was er tut«.
Aus der Natur ins Labor
Laborexperimente und Naturbeobachtungen ergeben wichtige Daten zu ökologischen Vorgängen. Freilandexperimente, bei denen ein Ökosystem teilweise verändert wird, um Hypothesen zu testen, wurden vor Joe Connells Arbeiten zu Seepocken in Schottland jedoch nicht wissenschaftlich präzise durchgeführt. Erst seine 1961 veröffentlichten Ergebnisse beruhten auf sorgfältiger Planung, sie waren abgesichert und wiederholbar.
Connell definierte den »Goldstandard« für Freilandexperimente, doch Versuche im Labor blieben genauso wichtig, wie Earl Werner 30 Jahre später zeigte. Er erkannte die nicht konsumtiven Effekte räuberischer Libellenlarven auf das Verhalten und die körperliche Entwicklung ihrer Beute (Kaulquappen).
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wurden viele neue ökologische Vorgänge erkannt. Arbeiten von Robert MacArthur und anderen Forschern zur Konkurrenz zwischen Arten führten zur Theorie des optimalen Nahrungserwerbs. Sie erklärt, warum Tiere bestimmte Nahrungsquellen nutzen und andere nicht. Symbiosen versteht man dank Biologen wie Daniel Janzen besser. Robert Paines Forschungen mit Seesternen und Muscheln stärkten das Konzept der Schlüsselarten, die einen unverhältnismäßig hohen Einfluss auf ihr Ökosystem haben.
Neue Techniken
Technische Fortschritte, etwa genauere chemische Messverfahren, die Erdfernerkundung durch Satelliten sowie Computer, die enorme Datenmengen verarbeiten können, haben neue Forschungsbereiche eröffnet.
Die ökologische Stöchiometrie etwa erforscht den Fluss von Energie und chemischen Elementen durch Nahrungsnetze und Ökosysteme. Wie bei vielen Konzepten der Ökologie liegen ihre Anfänge einige Jahre zurück, verbreiteten sich aber erst 2003 durch das Buch Ecological Stoichiometry: The Biology of Elements from Molecules to the Biosphere von Robert Stern und James Elser. Neue Techniken werden gewiss auch in Zukunft unser Verständnis ökologischer Prozesse vertiefen.