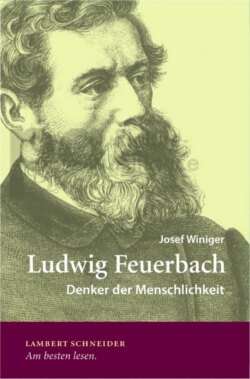Читать книгу Ludwig Feuerbach - Josef Winiger - Страница 17
Doktor der Philosophie
ОглавлениеDas letzte Studienjahr, auch dies schrieb die bayerische Studienordnung vor, musste auf einer Landesuniversität absolviert werden. Außerdem war im Oktober 1825 König Max I. Joseph gestorben, und sein Sohn Ludwig I. wollte zunächst das Stipendium für die Feuerbach-Söhne nicht weiterzahlen.141 Auch aus diesem Grund kam Berlin als Studienort nicht länger in Frage. Der Abschied fiel nicht leicht: „Berlin wird mir immer teurer, je länger ich hier bin, und ich denke ungern an den Zeitpunkt, wo ich es verlassen muss“, hatte er seiner Mutter schon nach einem Jahr geschrieben. Für den Mangel an schönen Landschaften, in denen sich wandern ließ, entschädigte ihn das imposante Stadtbild. Berlin war seine „geistige Geburtsstadt“ geworden.142
Ludwig Feuerbach kehrte also im Frühjahr 1826 nach Ansbach zurück. Zu seinem Meister hatte er beim Abschied gesagt: „Zwei Jahre habe ich Sie nun gehört, zwei Jahre ungeteilt Ihrer Philosophie gewidmet. Nun habe ich aber das Bedürfnis, mich in das direkte Gegenteil zu stürzen. Ich studiere nun Anatomie.“ Doch „häusliche Missverhältnisse“ setzten diesem Vorhaben Hindernisse entgegen.143 Karls Gesundheitszustand hatte sich dramatisch verschlechtert, möglicherweise bestand der Vater auch darauf, dass sich Ludwig auf die Staatsprüfung für den Unterricht an bayerischen Gymnasien vorbereitete, um die Aussicht auf einen halbwegs sicheren Broterwerb zu erhalten (in Bayern wurde zu dieser Zeit Philosophie auch im Lyzeum unterrichtet). Jedenfalls studierte er hauptsächlich Philologie und Geschichte, und zwar im Selbststudium im Elternhaus, weil die Fächer an keiner bayerischen Universität ernsthaft gelehrt wurden. Daneben vertiefte er seine Kenntnisse in der Geschichte der Philosophie, vor allem der Antike.144
Erst ein Jahr später, Ostern 1827, immatrikulierte er sich an der Universität Erlangen, um sein Studium abzuschließen. Hier nun machte er wahr, was er Hegel angekündigt hatte, und studierte Naturwissenschaften. Nachdem er bereits in Berlin nebenher Vorlesungen in Mathematik, Physik und „Astrognosie“ besucht hatte, hörte er jetzt in Erlangen Botanik, Anatomie und Physiologie, freilich „nur allgemein“.145 Für eine eingehende Beschäftigung reichte wohl die Zeit nicht, denn schon nach einem Jahr legte er seine vorschriftsgemäß lateinisch abgefasste Doktorarbeit vor, deren Titel lautete: De infinitate, unitate atque communitate rationis – „Über die Unendlichkeit, Einheit und Allgemeinheit der Vernunft“. Nach bestandenem mündlichem Examen erhielt er am 25. Juni 1828 die Würde eines Doktors der Philosophie. Unverzüglich strebte er auch die Habilitation an, denn das Berufsziel Universitätsdozent stand schon länger fest.146 Dazu hatte er seine Doktorarbeit in gedruckter Form als Habilitationsschrift vorzulegen und öffentlich zu verteidigen. Er überarbeitete und erweiterte also die Dissertation und formulierte auch den Titel prägnanter: De ratione, una, universali, finita – „Über die eine, allgemeine, unendliche Vernunft“.147 Am 15. November übersandte er sie dem Dekan. Ein weiteres Exemplar schickte er an Hegel, und einige Wochen später – „zum Zeichen meiner ungeheuchelten Hochachtung und Verehrung“148 – eines an Schelling. Am 13. November 1828 verteidigte er seine Habilitationsschrift. Einer der Opponenten war der um zwei Jahre jüngere Adolph von Harleß, dem Feuerbach kurze Zeit später seinerseits – mit einer witzig-boshaften Rede – bei der Habilitation opponieren sollte. Die „Opposition“ blieb auch künftig bestehen: Harleß wurde bald zum Begründer und Exponenten der „erweckten“ protestantischen Theologie, die als „Erlanger Theologie“ bekannt wurde. Die Gegensätze hätten nicht schärfer sein können – „mich ekelt’s, seinen Namen nur auszuschreiben“ wird Feuerbach ein knappes Jahrzehnt später bitter kommentieren.149
Mit seiner Dissertation oder vielmehr Habilitationsarbeit vermochte Ludwig sogar den Vater von seiner Berufswahl zu überzeugen: Die Schrift verrate „einen großen Denker“, befand der philosophisch geschulte Strafrechtler, zudem besitze Ludwig „zugleich die Gabe der Sprache und eine geläufige Zunge nebst einer mehr als hinreichenden Portion philosophischer Dreistigkeit und kühlen Selbstvertrauens“.150 Philosophisch dreist muss ihm – und mit ihm vielen von der Spätaufklärung geprägten Menschen seiner Generation – schon die erste Seite vorgekommen sein: Mit mildem Spott wischt hier Feuerbach den Kantianismus der Elterngeneration vom Tisch: Die Schranken, die die Kantianer dem philosophischen Erkenntnisdrang setzen wollten, seien bloß „kümmerliche Schreckmittel“. Der vierundzwanzigjährige Privatdozent Feuerbach akzeptiert keine erkenntnistheoretische Begrenzung des Denkens: „Ein in irgendwelche Schranken gebanntes Denken, dem nur entsprechend begrenzte Dinge … zugänglich wären, würde … kein Denken sein, sondern sinnliche Wahrnehmung.“151 Feuerbach will das Allgemeine, Verbindende, Universale. Und er findet es in der Vernunft. Sie ist das, was das Individuum aus seiner Beschränktheit und Vereinzelung heraushebt: Die Vernunft ist nicht ein Organ, das den einzelnen mit einer bestimmten Fähigkeit ausstattet – so wie er mit den Ohren hören kann –, sondern Teilhabe an einem Übergeordneten: „Sofern ich denke, höre ich auf, Individuum zu sein. Denken ist daher dasselbe wie Allgemeinsein.“ – „Das Denken selbst hängt in sich zusammen durch alle Menschen hindurch. Und wenn es auch gleichsam verteilt ist auf die Einzelnen, so ist es doch ein Kontinuum, ununterbrochen fortdauernd, eines, sich selbst gleich, von sich selbst untrennbar.“ – „Denkend bin ich verbunden, oder vielmehr: Ich bin eins mit allen, ich selbst bin geradezu alle Menschen.“ Oder zugespitzt, in Anlehnung an das Cogito ergo sum von Descartes: Cogito, ergo sum omnes homines – „Ich denke, also bin ich alle Menschen.“152
Feuerbach verwendet viel Mühe darauf, diese Identität des Allgemeinen und des Einzelnen im Falle des Denkens zu beweisen. Überzeugend sind seine Beweise freilich für den heutigen Leser so wenig wie später für ihn selbst. Die ganze Arbeit ist auch weniger eine systematische Deduktion, die Argumentation ist über weite Strecken eher apologetisch: Feuerbach will seine grundsätzliche erkenntnistheoretische Position rechtfertigen. Und diese lautet: Letztgültige philosophische Erkenntnis der Wahrheit ist möglich. Er nimmt den Panlogismus, den Hegel in seinem Werk praktiziert, beim Wort, treibt ihn sogar auf die Spitze. Er zieht aus ihm die „Nutzanwendung“, dass alle Wirklichkeit in endgültiger Weise begrifflich zu fassen sei. Dem philosophischen Erkenntnistrieb sind keine Grenzen gesetzt: „Diesem Eifer ist es eigentümlich, dass er sich nicht nach den Vorschriften Kants oder anderer, die dessen Spuren gefolgt sind, richtet. Er lässt sich nicht in dem Bereich und innerhalb der Grenzen festhalten, die diese Philosophen dem Geist andichten, sondern treibt uns gleichsam über uns selbst hinaus … Er reißt uns fort zur Erforschung und Erkenntnis des Wahren und Unendlichen, und dies mit einer Gewalt, nicht geringer als die, mit der alle Körper zum Erdmittelpunkt gezogen werden.“153 Die zwei Jahre bei Hegel haben ihm diese euphorische Zuversicht eingepflanzt. Begeistert beruft er sich auf Giordano Bruno: „Welches ist nun dieses Geistes Ziel und Bestimmung? Zu erreichen das höchste Wahre für den Verstand und das höchste Gut für den Willen. Dass dem also sei, davon zeugt schon die Unersättlichkeit des menschlichen Verstandes und Begehrungsvermögens.“154 Im Begleitbrief, mit dem er seine Arbeit an Hegel schickt, drückt er seine Zuversicht mit einiger Emphase aus. Es gelte jetzt, schreibt er, „sozusagen ein Reich zu stiften, das Reich der Idee, des sich in allem Dasein schauenden und seiner selbst bewussten Gedankens“. Mit der „Alleinherrschaft der Vernunft“ sei eine neue Ära angebrochen, habe „eine neue Geschichte“ begonnen, ja, „eine zweite Schöpfung“.155
Seine Zuversicht hat religiöse Qualität, was Feuerbach durchaus selbst sieht, wenn er anmerkt, dass „die Philosophie denselben Ursprung wie die Religion“ habe. Es zeigt sich auch darin, dass manche Beweisführungen geradezu an Descartes’ Gottesbeweis gemahnen. Etwa, wenn er schreibt, „in unserem Bemühen, das Unendliche zu erkennen“, sei „dieses Unendliche selbst schon enthalten“. Oder wenn er von den Konsequenzen her argumentiert: „Denn verneinen, dass die Wahrheit als solche von der Vernunft erfasst werden könne, heißt verneinen, dass es Wahrheit gibt.“ Stellenweise lässt er sogar die pantheistische Ausrichtung dieser „religiösen“ Sicht durchblicken, so wenn er vom Denken sagt, dass „alle Dinge durch einen verborgenen Antrieb oder Anstoß zu ihm hingeführt werden, nach ihm streben“.156 Das klingt nach Jakob Böhme, den Feuerbach damals begeistert las.
Pantheismus und Böhme-Begeisterung hätten Feuerbach in den Augen eines Heinrich Heine in die Nähe der Spätromantik rücken können. Bemerkenswerterweise geht aber Feuerbach nicht nur auf Distanz zum Kantianismus seiner Elterngeneration, sondern auch zur Romantik. Im Text selbst ist diese Kritik der Romantik philosophisch verschlüsselt, etwa wenn er die „Philosophie des Selbst“ als Sackgasse bezeichnet. In einer Anmerkung, die er in die Druckfassung einrückt, wird er explizit und nennt Namen: Weiller, Jacobi, (beide persönliche Freunde seines Vaters und von diesem hoch verehrt) und Novalis. Doch er meint nicht nur sie, sondern eine ganze, beherrschende Zeitströmung: „Viele Philosophen unserer Zeit haben gerade das, was niemals in die Philosophie aufgenommen werden kann, sondern immer außer ihr liegt, das einzelne und zufällige Individuum (d.h. sich selbst), zum Prinzip und Inhalt des Philosophierens zu machen versucht.“157
Was Paul Johann Anselm Feuerbach bei seinem Sohn das „kühle Selbstvertrauen“ nannte, war also das erstaunlich klarsichtige Einschlagen eines philosophischen Weges, der von keinem der zeitgenössischen „Trends“ vorgezeichnet worden war. Hegel war natürlich das große Vorbild, doch Feuerbach war nicht einfach „Hegelianer“ in dem Sinne, dass er dem Meister nachgeeifert oder ihn gar kopiert hätte. Hegels grandioses Gedankengebäude bildete die existentiell prägende Erfahrung, die Hegelsche Spekulation das „Organ“ oder „Werkzeug“ seines Philosophierens. Allerdings auch nicht mehr: Hegels System hatte für ihn nicht die „Bedeutung der letzten und obersten Wissenschaft im Zyklus der philosophischen Wissenschaften“.158