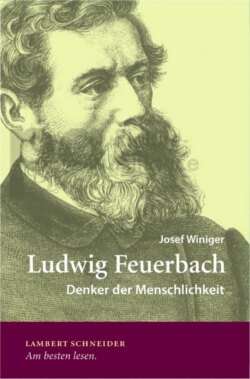Читать книгу Ludwig Feuerbach - Josef Winiger - Страница 19
Gedanken über Tod und Unsterblichkeit
Оглавление„Bei den Griechen und Römern konnte die Philosophie wohl gedeihen, da die heidnische Religion keine Dogmen hatte; aber bei uns verderben diese alles. Die Schriftsteller müssen mit einer Behutsamkeit zu Werke gehen, wodurch der Wahrheit Zwang angetan wird. Das Pfaffengeschmeiß rächt die kleinste Verletzung der Orthodoxie; man wagt es nicht, die Wahrheit entschleiert zu zeigen.“ Das hatte Friedrich II. von Preußen an Voltaire geschrieben, und Ludwig Feuerbach stellte es als Motto seiner ersten öffentlich verbreiteten Druckschrift voran: Gedanken über Tod und Unsterblichkeit – aus den Papieren eines Denkers, nebst einem Anhang theologischsatirischer Xenien.168 Das Werk erschien anonym – „herausgegeben von einem seiner Freunde“ – im Sommer 1830, also fast simultan mit dem Ausbruch der Pariser Julirevolution. Es wurde sofort verboten. Von den gedruckten siebenhundertfünfzig Exemplaren konnten ganze fünfzig verkauft werden. Als das Verbot im April 1831 wieder ausgesetzt wurde, war der Skandaleffekt durch die sich überstürzenden Ereignisse jener Jahre wohl bereits verpufft. In Erlanger Universitätskreisen freilich hatte die Schrift ihre Wirkung getan: Feuerbach war verfemt, auch die Studenten sollten ihn meiden, es wurde Druck auf sie ausgeübt, um sie vom Besuch seiner Vorlesungen abzuhalten. Hier war Feuerbach nämlich sogleich (wenn auch nie offiziell) als Autor identifiziert worden: Seine aufsehenerregende Rede, die er im Jahr zuvor als Opponent von Harleß bei dessen öffentlicher Verteidigung der Habilitationsschrift gehalten hatte, war in Erinnerung geblieben. Feuerbach hatte dort seinen Gegner auf das spekulative Glatteis geführt und listig argumentiert, wenn Harleß erkläre, dass das Böse weder von Gott, noch von den Dingen, noch von den Menschen käme, so bliebe nur die Theologie als mögliche Ursache übrig: „Also bleibt nichts anderes übrig, von dem her das Böse in den menschlichen Geist eingedrungen sein könnte, als Du selbst, als Theologe, mit deiner Beweis- und Denkungsart.“169 Das war weit mehr als Opponenten-Geplänkel gewesen, das war ein Frontalangriff auf die Theologie – von derselben Direktheit, wie sie uns nun in Feuerbachs erstem Buch dutzendfach entgegentritt.
Ein früher Biograph äußerte die Vermutung, Feuerbach habe sich in der ersten Begeisterung über die Julirevolution dazu überreden lassen, den brisanten Text an die Öffentlichkeit zu geben.170 Das ist unwahrscheinlich: Die Drucklegung weist zwar alle Anzeichen der Hast auf, doch zwischen dem Pariser Aufstand (27.–29. Juli) und dem Verbot des bereits im Handel befindlichen Buches liegen weniger als zwei Wochen, eine zu kurze Frist. Dennoch besteht eine Analogie zwischen der gesellschaftlich-politischen Eruption und Feuerbachs Gedanken über Tod und Unsterblichkeit: Philosophisch-weltanschaulich wirkt das Buch wie der gewaltsame Ausbruch eines Vulkans, in dem es schon lange gebrodelt hat. Feuerbach selbst wird später von einem „Lavastrom“ sprechen. Und wenn er sagt, „titanische Genialität und übersprudelnde Bilderfülle“ zeichne die Schrift aus,171 ist man versucht, an Mahlers erste, die Spätromantik gleichsam hinwegfegende Symphonie „Titan“ zu denken.
Das Buch enthält zwei Teile: Der erste Teil entspricht einer philosophischen Abhandlung in klassischer Gliederung: Vorrede, dreiteiliges Hauptstück, Schluss. Eingeschoben zwischen dem dritten Teil des Hauptstücks und dem Schluss ist eine Art Lehrgedicht: „Reimverse auf den Tod“. Der zweite Teil, als Anhang bezeichnet, ist eine Sammlung von über dreihundertfünfzig Xenien, die zum Teil aus mehreren Distichen bestehen. Geschrieben hatte Feuerbach die im Buch versammelten Texte schon weit vor 1830, also auch vor der bereits besprochenen Promotions- und Habilitationsschrift. Die aphoristischen, thematisch nicht gruppierten Xenien des Anhangs sind sogar mit ziemlicher Sicherheit bereits in Berlin, zu einem kleinen Teil vielleicht schon in Heidelberg entstanden. Die in sich geschlossene Abhandlung des ersten Teils und die Reimverse verfasste Feuerbach wohl in der in Ansbach verbrachten Zeit zwischen Berlin und Erlangen, also im wesentlichen im Jahr 1827.172
Das Bild vom braven und frommen jungen Ludwig Feuerbach, das man aus der Lektüre des Briefwechsels bis zu dieser Zeit gewinnen könnte, erfährt von den ersten Seiten an kräftige bis deftige Korrekturen. Das Buch beginnt mit einem fünfstrophigen Gedicht, das betitelt ist: „Demütige Bitte an das hochweise und hochverehrliche Gelehrtenpublikum, den Tod in die Akademie der Wissenschaften zu rezipieren“ – der Tod verstehe sich nämlich auf die Philosophie wie kein zweiter. Was Feuerbach damit meint, entwickelt er in einer langen Abhandlung, einer Art Essay. In der Einleitung gibt er einen historischen Überblick über das Problem: In der römischen Antike seien die Menschen noch ganz selbstverständlich und ungeteilt diesseitig gewesen: Weil „der Römer keine Trennung und Kluft kannte zwischen Vorstellung und Wirklichkeit, Möglichkeit und Kraft, Idealität und Realität, so kannte er auch hiemit keine Fortdauer seines Selbst“. Im Mittelalter sei die Unsterblichkeit zwar zum Glaubensartikel geworden, doch das habe sich nicht entscheidend ausgewirkt: Der Glaube an Himmel und Hölle habe noch kein ewiges Leben der Individuen gemeint, er habe vielmehr den Sinn eines Glaubens an die Vergeltung des Guten und des Bösen gehabt. Mit dem Protestantismus sei dann die Person in den Vordergrund gerückt, zunächst als Person Christi, doch im 18. Jahrhundert habe sich dieser Protestantismus zum „Rationalismus und Moralismus“ entwickelt, in dem nur noch „die pure nackte Persönlichkeit“ zählte.173
Dieser sich als letzte Wahrheit begreifenden Person könne aber das irdische Leben in seiner Unvollkommenheit nicht genügen, weshalb sie sich ein Jenseits konstruiere, in dem sie ihre Idealität realisiert findet. Gleichzeitig verliere man das „Allgemeine, das Ganze“ – und nur das ist für Feuerbach das „wahrhaft Wirkliche und Wesentliche“ – aus den Augen. So sei unter anderem ein wirkliches Geschichtsverständnis nicht mehr möglich: Die Philosophiegeschichte werde zur „Geschichte von Meinungen, von sonderbaren, paradoxen Einfällen“, und die Weltgeschichte wisse „nur von Menschen, nicht von der Menschheit“; folgerichtig, so spottet Feuerbach, avancierten bei diesen Leuten „die geheimen Kabinettsgrillen der Minister, die Papageien und Schoßhündchen der Prinzessinnen und Königinnen, die Flöhe und Läuse, die auf den Köpfen der großen Herren und Helden nisten, zu den Trägern, den Bewegern und erhabnen Stützen des Weltalls“. Und schließlich verstünden sie auch nichts von der Natur, die bei ihnen zum Sammelsurium von kuriosen Objekten verkomme.174
Diese Kritik der Verabsolutierung der Person ist sicherlich von Hegel angestoßen. Doch sie wird beim jungen Feuerbach zum ersten Ansatz einer Kritik, deren Intention weit über die Fachphilosophie hinausreicht: „Demjenigen, der die Sprache versteht, in welcher der Geist der Weltgeschichte redet, kann die Erkenntnis nicht entgehen, dass unsre Gegenwart der Schlussstein einer großen Periode in der Geschichte der Menschheit ist und der Anfangspunkt eines neuen geistigen Lebens.“175 Es geht ihm um nichts weniger als um den Aufbruch in eine neue Zeit. Seine Kritik, die sich gegen den Rationalismus der Spätaufklärung und den „Pietismus“ der Romantik gleichzeitig richtet, ist nicht akademisch motiviert, sondern emanzipatorisch.
Aus welcher Haltung, aus welchem „Glauben“ heraus sie erwächst, wird in den drei Hauptteilen erkennbar. Der erste Teil ist überschrieben mit Gott. Die ersten Sätze könnten von einem Theologen geschrieben sein: „Gott ist die Liebe. Der Mensch liebt, aber Gott ist die Liebe.“ Die Gedankenführung nimmt allerdings einen unerwarteten Verlauf: Gott ist der „letzte Grund aller Vergänglichkeit“, deshalb auch der Grund des Todes. Wir sterben, weil Gott, das Unendliche in uns ist. Der Tod ist unsere Teilhabe am Göttlichen: „Das, dem nichts Göttliches innewohnte, könnte nicht sterben.“176
Einerseits ist das negativ, als Kritik gemeint: Ein Leben nach dem Tod zu wünschen, sei „grenzenlose Verirrung“: „Es gibt keinen halben, keinen zwiespältigen und zweideutigen Tod; in der Natur ist alles wahr, ganz, ungeteilt, vollständig; die Natur ist nicht zwiespältig; sie lügt nicht; der Tod ist daher die ganze, die vollständige Auflösung deines ganzen und vollständigen Seins.“
Doch andererseits – und dies ist die Stoßrichtung der Schrift – bedeutet es die ungeteilte Bejahung des diesseitigen Lebens als dem eigentlich Göttlichen. In der Tat sei dies „mystisch“, nimmt Feuerbach dem „lieben Leser“ das Wort aus dem Mund: Aber man müsse eben schon zu Lebzeiten Mystiker sein, wenn man nicht im Augenblick des Sterbens dazu gezwungen werden wolle.177
In einer Offenheit, die skandalisieren musste, lehnt Feuerbach den Personen-Gott ab. Das Thema wird ihn noch jahrelang beschäftigen, eines der zentralen Argumente erscheint bereits jetzt: Der Glaube an einen als Person gedachten Gott ist Egoismus. Wer Gott so sieht, dem ist er nur „Gewährleistung seiner selbst und seines eignen Daseins, Gott ist ihm nur Hauspapa, Wachtmeister und Nachtwächter seiner selbst, Genius, Schutzpatron“.178 Dieses Gottesbild ist auch unverträglich mit der Liebe, wie Feuerbach sie will: Die Person ist immer Unterscheidung, Sonderung. Lieben heißt aber, das Fürsichsein aufzugeben. Zu wahrer Liebe fähig ist deshalb nur der Pantheist – „außer dem Pantheismus ist alles Egoismus“.179 Hymnisch feiert Feuerbach die Liebe als das „allverzehrende und peinigende Fegefeuer“ und beruft sich begeistert auf Jakob Böhme, den er über eine Seite lang zitiert.180 Es ist eine persönliche, „weltanschauliche“ Standortbestimmung des jungen Philosophen.
Im zweiten, mit „Zeit, Raum, Leben“ betitelten Teil klingt ein anderes Thema an, das Feuerbach in den kommenden Jahren ebenfalls intensiv beschäftigen wird: Das Verhältnis zur Natur. Er leitet es mit einer Betrachtung über die Empfindung ein (ein Thema, das er auch in der Dissertation berührt, freilich nur negativ, weil die Empfindung als das „Besondere“ im Gegensatz zur Allgemeinheit der Vernunft steht). An mehreren Stellen schimmert bereits jene Aufmerksamkeit auf den Selbstwert der Sinnlichkeit durch, die später einmal ausschlaggebend werden wird. Die verwendeten Metaphern sprechen für sich selbst: „Ich empfinde nur dadurch, dass ich gleichsam aus dem … ununterbrochnen Fluss der Zeit die Perle des Augenblicks absondere und in den engen Raum desselben mein Sein zusammenfassend einschließe.“ – „Wie das Sonnenlicht, zusammengedrängt und gesammelt, Feuer wird, brennt, so entsteht nur durch die Zusammendrängung meines ganzes Seins auf den Brennpunkt eines Augenblicks in mir das Feuer der Empfindung.“181
Natürlich stehen Raum und Zeit für das Vergängliche, Individuelle, Besondere, also Beschränkte, und nur die Vernunft ist das Allgemeine, Aufhebung der Beschränkung: Feuerbachs „Glaubensbekenntnis“ ist noch ganz eindeutig der spekulative Idealismus. Gegen die dualistische Sichtweise, die diesem Idealismus innewohnt (wie Feuerbach später erkennen wird), macht sich aber eine Aufgeschlossenheit, ja Sympathie der Sinnlichkeit gegenüber geltend: „Der Raum ist das sinnliche Dasein, die äußerliche Form der göttlichen Liebe … die Zeit die sinnliche Form derselben, wie sie verzehrendes Feuer“ ist. Die Zeit ist „nicht Feindin … sondern vertraute Tochter und Freundin des Wesens“, und „die Einheit des Wesens ist nicht bloß Kontraktion, Konzentration, sondern zugleich unbeschränkt Ausdehnung, das Außersichsein der Freude und Liebe.“182
Dieser positive, bejahende, lebensrelevante Gehalt der Gedanken vermag auch den heutigen Leser noch zu fesseln, auch wenn er sich über längere Strecken durch das Gestrüpp der Begriffsspekulation zu kämpfen hat und der „Lavastrom“ der Gedanken, wie Feuerbach später selbst urteilen wird, recht „formlos“ mal dahin, mal dorthin fließt.183 Weniger spannend, sogar seltsam blutleer, liest sich der dritte, mit „Geist, Bewusstsein“ überschriebene Teil: Es ist eine Art Ethik, die der „Denkende und der tiefer Schauende“ von der Einsicht in die Allgemeinheit des Geistes ableitet. Und erneutes Glaubensbekenntnis: „Der wahre Glaube an die Unsterblichkeit ist der Glaube an den Geist selbst, an das Bewusstsein, an ihre absolute Wesenhaftigkeit und unendliche Realität.“184 Mit der seltsamen Blässe dieser idealistischen Ethik wird Feuerbach ebenfalls noch Jahre zu kämpfen haben.
Die Gedanken über Tod und Unsterblichkeit sind – entgegen dem ihnen noch lange anhaftenden Ruf einer entsetzlichen Ketzerschrift – in erster Linie ein positiver Entwurf, der, zumal in der bewegten Zeit zwischen der Julirevolution und dem Hambacher Fest, von jungen Intellektuellen begeistert aufgenommen wurde. Symptomatisch ist die Reaktion der Feuerbach-Brüder, vor allem Anselms, der das Buch als das „fünfte Evangelium“ pries.185 Was die Obrigkeit auf den Plan rief, war die beispiellose Freimütigkeit, mit der Feuerbach zentrale christliche Glaubensinhalte – Gott als Person, Unsterblichkeit der Seele – verwarf und sich zum Pantheismus bekannte. Und natürlich die Schärfe des Spotts, mit dem er die kritisierten Dogmen bedachte. Schon im Text der Abhandlung wird dieser Spott stellenweise keck, doch „derb satirisch“ wird er freilich erst in den Xenien des Anhangs. An den Satire-Charakter des Genres war man seit den Xenien von Goethe und Schiller gewöhnt, das Beispiel war ja auch schon mehrfach nachgeahmt worden. Doch was der junge Philosoph hier bot, ließ bei so manchem das Lachen gefrieren:
Vor dem Chirurg entblößt auch die Dame selbst, was sie verbirgt sonst; Wo der Chirurg anfängt, hört der Ästhetiker auf. So auch die Theologie zeigt mir, als ihrem Chirurgus, Jetzo so manches, was sonst gern sie verbirget aus Scham. Worte natürlich gebrauch’ als Chirurg ich, welche nicht passen In der Damen und Herrn Zirkel am Abend beim Tee.
Der Anspruch ist nicht eben bescheiden:
Wer ist ein derber Satiriker? Der, so die Quellen studieret, Draus das Übel entspringt, und sie dann offen auch zeigt. Freilich eure Satire, die sengt von der Haut nur die Haare, Aber das faulende Fleisch lässet sie unverletzt stehn.186
Durch sein allzu offenes Zeigen hatte Feuerbach es sich mit allen Autoritäten, den politischen wie den akademischen, verscherzt. Der Vater prophezeite ihm: „Diese Schrift wird Dir nie verziehen, nie bekommst du eine Anstellung.“187 Er sollte Recht behalten. Doch in einer rückblickenden Bewertung schreibt Feuerbach auch, er sei mit den Xenien „seiner eigenen spätern philosophischen Entwicklung in kühnen Sätzen poetisch vorausgeeilt“.188 Eines der grundlegenden Argumente seiner Religionskritik wird lauten, das Christentum habe sich historisch überlebt. Dieses Thema erscheint in den Xenien vielfach abgewandelt:
Einst war Christus das Geist und Erkenntnis spendende Weltlicht, Doch Nachtwächter nur ist jetzt er dem Mystiker noch.
Ach, Jahrhunderte zullen sie schon am Euter der Bibel, Dass er nun endlich ist leer und selbst die Kuh auch dahin!
Äußerst heftig geht Feuerbach mit der „vernünftigen“ Gläubigkeit der Aufklärung ins Gericht. Auch dies ist für lange Zeit ein grundlegendes Argument seiner Religionskritik:
Bleibet er stehn beim Glauben, so ist er leidlich vernünftig; Lässt er sich ein auf Vernunft, wird gleich ein Esel daraus.
Reicht der Glaube nicht hin, so muss die Vernunft aushelfen. Gehet aus der Verstand, steuert der Glaube der Not.
Die bösesten Pfeile schießt er gegen die „Pietisten“ ab:
Wisset, die Pietisten sind nichts als die ekligen Würmer, In die endlich zerfiel Petri verwesender Leib.
Schließlich attackiert er ganz unverblümt die staatliche Protektion des christlichen Glaubens:
Sonst war freilich die Religion die Stütze des Staates, Aber jetzt ist der Staat Stütze der Religion.
Schon wird der Glaube sogar jetzt gemacht zu einem Gesetze; Bald ist die Polizei Basis der Theologie.
Viele der Xenien wirken wie persönliche Notate, Zeugnisse vor allem der Berliner Studienjahre: Scharfe Ablehnung des sich auf Kant berufenden „Vulgärrationalismus“, dem er schon in Heidelberg bei Paulus begegnet war; ebenso scharfe Abrechnung mit Marheinekes Dogmatik (zwei Xenien beziehen sich namentlich auf ihn). Und nicht zuletzt das Gefühl der Befreiung nach dem Abschied vom Theologiestudium – mit der wohl damit einhergehenden Entdeckung diesseitiger Freuden:
Fort jetzt mit euch, ihr feigen Philister, ihr trockenen Männer! Dir, oh schönes Geschlecht, weih’ ich mit Liebe den Geist.189
Das schöne Geschlecht, ein gewisser „Hang zur Libertinage“190, die Berliner Tee-Abende bei Kriminalrat Hitzig, die langen Wanderungen in der geliebten Natur, die Abneigung gegen den Vulgärrationalismus der Spätaufklärung, der Pantheismus, die Böhme-Begeisterung, all das hätte Ludwig Feuerbach eigentlich zum Romantiker prädestiniert. Doch der Weg ins Biedermeierlich-Gefühlsselige der Spätromantik, den in den zwanziger und dreißiger Jahren so viele Intellektuelle gingen (selbst wenn sie sich in den Burschenschaften radikal gebärdet hatten), kam für ihn nicht in Frage. Dazu war er zu sehr geprägt von der politisch fortschrittlichen Einstellung in seiner Familie, zu begeistert von Hegels lichtem Denkgebäude, und ein zu fanatischer Wahrheitssucher.