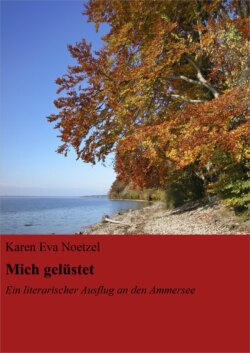Читать книгу Mich gelüstet's nach Idylle - Karen Eva Noetzel - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHELENE BÖHLAU Föhn
Aus dem 1. Kapitel
Im Hügel- und Seeland, im wildreichen Waldland liegt ein weltverlorenes Dorf. Im Süden der ragende Wall der Alpen, die hin und wieder aus ihrer Verschleierung treten, dunkel und drohend, riesenhaft näher rücken, wie im Anmarsch, als wollten sie alle Herrlichkeiten der gesegneten Landschaft mit ihren Gewalten und ihrer blauen Dunkelheit übertürmen und begraben.
Wie beiseite geschoben, hoch über den Landstraßen und Bahngleisen, liegt das einsame Dorf, vergessen vom Menschentreiben, das sich in Sonntagsfluten, die aus der großen Stadt brechen, weitab dahin wälzen in Autos, per Bahn, zu Fuß, zu Rad, im hetzenden Treiben.
Wallfahrer aber steigen in der Bittwoche hinauf zum nahen Kloster und Gnadenort, über steilen, neubeschotterten Weg, den die schlauen Bauern ihnen alljährlich rechtzeitig so steinig zubereitet haben, damit die Züge der Frommen wie eine Dampfwalze darüber hingehen un den schroffen Weg gangbar machen.
„Die Stoanesel“, sagen die Bauern und haben alljährlich ihren Spaß daran, daß ihre Brocken und Trümmer, die sie auf den Weg geschmissen, gut eingetreten werden in den lehmigen Boden.
Es sind recht schlaue Bauern, recht ungestörte Bauern seit Jahrhunderten, Jahrtausenden könnten es auch sein. Sie passen in älteste Zeiten hinein, wie sie heut in die Zeit passen. Kann schon sein, daß es hier im weltverlorenen Neste war – als ein Städter einen alten Bauern huldvoll fragte: „na, Männle- wie alt sind wir denn nun eigentlich?“
„Dös woas i it, wie lang daß sie mi scho haben.“
Es ist hier zeitlos.
Ein wenig abseits vom Treiben der Welt – und wir treten in Urzeiten ein. Ja, mitten im Treiben der Städte, in hoher Kultur kann das auch geschehen. Bricht ein Streit aus zwischen den feingeschliffensten, prominentesten Hirnen unserer Zeit, denen nichts unerreichbar ist, nichts so diamanthart, daß es nicht hinschmelze vor der Glut solcher Hirne von tausend Graden. Ein schlichter Mensch erstarrt vor ihnen in Staunen. – Es ist das Höchste erreicht. – Es geht nicht weiter. Da winkt etwa den gewaltigen Hirnträgern ein kleiner Vorteil. Sie stürzen im Geiste darauf zu. Sie suchen ihn einander zu entreißen – geistiges Zähnefletschen – Fraß. Das Gleiche überall. Aber hier, im weltverlorenen Nest, vor dem der Riesenwall der Berge im Föhnlicht dunkel ragt, ist das Urweltliche heimisch, keine gespenstische Fratze. Schlicht tritt es zutage, naturverbunden im Bösen und Guten.
Für die ungestörten Bauern sind die Trümmer und Steine, die sie den Wallfahrern auf den Weg werfen, ein Scherz, den die Altväter schon trieben.
Es ist hier oben ungestört und die Natur ist groß und ausgebreitet, von Hügelhöhen aus geschaut. Vom Bergwall begrenzt, wie auch das Leben begrenzt ist von solch drohendem Wall im Föhnlicht und im Anmarsch. Es ist ein geheimnisvoller Ort da oben.
Jüngster Zeit sind dort ein paar Häuser erstanden zum Staunen der Bauern.
Auf alten Grundmauern ist ein schönes, großes Landhaus gebaut worden, das sich über dreifach übereinandergetürmten Kellern erhebt. Das Haus liegt an einem sanften Abhang, der auch dem tiefsten der Keller ein wenig Tageslicht durch die gewaltigen Grundmauern zukommen läßt.
Niemand weiß, aus welcher Zeit die alten Mauern stammen, geradeso, wie es das Bäuerlein von sich selbst nicht auszusagen wußte. Dem Bauherrn aber hatten es die drei Keller angetan. Er konnte nicht von ihnen los.
Drei Keller übereinander im Tal am Bach, zur nahen Burg wohl gehörend, die einst nicht unweit auf hohem Riff weit die Seen und Wege überschauend sich erhob. Aus römischer Zeit stammen die Keller nicht – dachte der Bauherr – „Germanisch“ Schatzbewahrer – Nahrungsbewahrer – Hort.
Die römische Zeit lag seinem Wesen fern, trotzdem ein zweitausendjähriges Zeugnis jener Epoche außen am alten Kirchlein eingemauert war und von fremden Leben, das hier einst herrschte, zeugte, von fremden Mächten, fremder, hoher Kultur in der Einöde. Die Giebelseite eines hohen Sarkophags mit dem Steinbild eines römischen Paares. Beide schön, rassig, vornehm. Gesichter und Hände abgehauen. Die weltbezwingende Linie der Schönheit aber hatten alle Bauerngeschlechter nicht verwetzen, zerschaben, zerhauen können. Sie war da – unsterblich – und leuchtete über die Bauerngräber hin, fremd, voll Geheimnis. Dem Bauherrn aber waren seine drei Keller voll Geheimnis und Leben, das ihn selbst anging.
„Drei-Kellermann übereinand“, sagte sein Weib, der die Keller eigentlich nicht nach ihrem Sinn waren, zu tief, zu dunkel um darüber fröhlich zu wohnen.
„Laß gut sein, Götterweib“, meinte der Bauherr verschwiegen lächelnd.
Das Haus aber ruhte mächtig auf den alten Grundmauern – und siehe da: Es hatte selbst seinen Baumeister erstaunt, denn es war in die Höhe gewachsen, wie aus eigenem Gutdünken. Die alten Grundmauern ließen nicht mit sich spaßen. Sie konnten und willten das nicht werden, was sie werden sollten: eine tadellose, moderne Villa. Sie hatten sich in die Höhe gereckt in ungewohnten Maßen.
Und so stand es nun wieder da, das Haus von einst! Die Bauern schauten, und wer sonst vorüberging schaute. Tüchtig stand es da, aus einer festen Zeit, in der Haus und Mann sich nach ureigenen Ideen gebärden konnten.
Vor dem großen Krieg war es aus den Kellermauern herausgekommen und hatte sich ein spitzes Dach augesetzt, unter dem es sich behaglich fühlte -. Nun mochte sich in ihm einnisten, wer da wollte! Ihm blieb’s gleich.
Es hatte Glück! Sein Bauherr und neuer Bewohner war ganz der rechte: ein schlichter, gerader Mann, der, wie sein Haus es getan, als es sich ein Dach nach den Ausmaßen seines tiefsten Grundes aufgestülpt hatte, sich auch nach des Lebens Arbeit, einen Schutz hatte wachsen lassen, der ihm Kopf und Herz schirmte wie ein gutes wetterfestes Dach – seinen schlichten Humor – den ein ordentlicher Mensch genau so braucht, wie das Haus sein Dach.
Sie gehörten also zueinander die beiden, der Mann und das Haus. Das Weib gehörte auch dazu, trotz der drei Keller übereinand’. Eine Schwester war auch noch da, „die Tatten“. Beide Weiber von gutem Schlag dienten ihrem Herrn in aller Ruhe, im Wohlstand und im Behagen des beginnenden Alters. Alle drei stämmige, ausdauernde Gestalten, gut genährt, gesund und brav.
So zogen die drei fröhlichen Alten ein in das Haus, frei und ledig aller Sorgen – und nach einem arbeitsreichen Leben mochten sie vorhaben, die kommenden Jahre wie ein heiteres Fest zu begehen.
Und so lebten sie gute, reichliche Zeiten, hausten sich ein. Alles gedieh. Der Garten stand im Blumenflor wie ein Wunder, die Gemüse bildeten steinharte Köpfe im höchsten Pflanzenwohlleben. Die Beerensträucher, die Obstbäume mustergültig, stramm und glatt, und trugen, wie hierorts nie Bäume getragen hatten. Tomaten glühten, als wüchsen sie im Paradies. Die Hühner legten, wie Bauernhühner es nie vermocht hätten, und zogen wertvolle Völker auf. Alles zeugte von Pflichttreue.
Die Bauern, die am Anwesen vorübergingen, blieben bedächtig stehen, stießen den bayerischen Urlaut, der im Lande viel gilt, aus, mit dem Mann und Weib, bei Staunen, Schadenfreude, Teilnahme, Ärger vortrefflich auskommen – Kurz ausgestoßen und ganz hinten im Hals: „Ah! – ah! – ah! – ah!“ – „Gibt’s des aaah?“ setzten nach langer Schau die Geschwätzigeren noch hinzu – und gingen kopfschüttelnd weiter. Und wenn Tatten, so hatte man sie genannt, hinter einem Johannisbeerstrauch hockend, Beeren pflückte, und solch einen Ausbruch der Gefühle belauschte, schlug ihr das Herz vor Stolz über das reichlich mit Neid gemischte Lob ihrer Geschwister, und es tat ihr wohl vom Wirbel bis zur Zehe.
Ihre Stellung als Wirtschafterin auf herrschaftlichen Gütern hatte sie aufgegeben, um sich ganz dem Haushalt ihrer Geschwister zu widmen. Sie fühlte sich als sommerlicher freier Bach, den nichts mehr hemmte, und liebte, was sich nur lieben ließ.
So lebten sie, als der große Krieg hereinbrach.
Die Söhne zogen hinaus. Der älteste ließ Weib und Kind zurück. Wie Abertausende wurden sie aus ihrer Bahn gerissen und gingen, getrieben von ungeheueren Mächten, ihrem Schicksal zu. – Aus der Bürgerlichkeit ins Urweltliche hinein, das immer gegenwärtig ist – immer bereit, vorzubrechen.
Das Weibervolk trat in das große passive Dulden ein.
Die beiden Frauen über den drei Kellern überkam es dem schweren Südwind gleich, der den dunkeln, treuenden Bergwall vor sich herzutreiben scheint, alles Holde zu zermalmen.