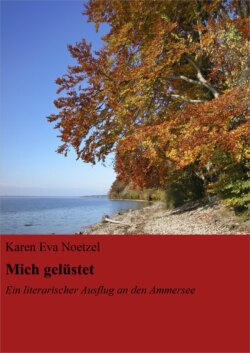Читать книгу Mich gelüstet's nach Idylle - Karen Eva Noetzel - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVorwort
Als „Bauernsee“ geschmäht führte der Ammersee lange Zeit ein Schattendasein neben seinem größeren Bruder, dem Starnberger See. Hier wurden schon im 17. Jahrhundert prunkvolle höfische Seefeste gefeiert. Als der Märchenkönig Ludwig II. dann den See für die Sommerfrische entdeckte, folgte ihm der ganze Hofstaat. Der Starnberger See, ohnehin viel näher an München gelegen, wurde berühmt.
Anders der Ammersee: Still und abgeschieden lag Bayerns drittgrößter See bis ins frühe 19. Jahrhundert da, beherrscht von den Klöstern Andechs und Dießen. Die Bevölkerung stand im Dienste der Geistlichkeit, lebte mehr recht als schlecht von Fischfang, Ackerbau und Transport der Wallfahrer. Einer von ihnen wusste immerhin schon 1813/14 das gastronomische Angebote zu schätzen. „Selten wird man in Bayern ein aehnliches auf dem Land treffen. Der Reisende findet das, was er wünscht: Gut zubereitete Speisen, echten Wein, reichliche und prompte Bedienung, Bereitwilligkeit von seiten des Wirtes und der Bedienenden und echt billige Zeche.“
1878 wird die Ammersee-Schifffahrt motorisiert. Der Dampfer „Marie“ quert das Gewässer der Länge nach. Zwanzig Jahre später kommt die Eisenbahn an den See. Der Badezug von Augsburg erschließt das Westufer. Die Münchner müssen noch bis 1903 warten, ehe sie das östliche Ufer und Herrsching erreichen. Nach und nach ziehen auch die Künstler an den Ammersee. Er gilt als romantisch und idyllisch. Hier kann man das einfache Leben leben. Immer zahlreicher werden die, die am See ein Refugium suchen und finden. Maler gründen in Holzhausen die Künstlerkolonie „Die Scholle“. Zu ihnen gehören etwa Fritz Erler und Leo Putz. Wilhelm Leibl findet hier neue Motive und seine große Liebe – sie endet allerdings tragisch.
Am 5. August 1904 schreibt Thomas Mann an einen Freund: „Ich bade, dichte und lobe Gott den Herren.“ Gemeinsam mit seiner Mutter und dem Bruder Viktor verlebt der künftige Nobelpreisträger rund drei Sommerwochen in der Villa Siebein in Utting. Er schreibt reihenweise Liebesbriefe an seine angebetete Katia Pringsheim, bangt und hofft, dass sie seine Frau werde. Er schreibt die letzte Szene seines Renaissance-Dramas „Fiorenza“. Darin wirbt Piero de' Medici heftig aber erfolglos um eine Frau. Im wahren Leben ging die Sache besser aus.
Während also Thomas Mann einen „schicksalhaften Brautsommer“ durchleidet, wie es der Literaturwissenschaftler Dirk Heißerer treffend formulierte, vergnügt sich derweil der junge Bert Brecht mit Eltern und Bruder am See. Mit dem Badezug sind sie angereist, wie viele Augsburger, für die der Ammersee ein beliebtes Ausflugsziel ist. Der See gefällt Brecht so sehr, dass er später dort ein Haus erwirbt, wenn auch nur für kurze Zeit. Bald muss er vor den Nazis fliehen.
So hat der Ammersee viele in seinen Bann gezogen. Sogar Revolution wurde hier gemacht! Der dänische Arbeiterschriftsteller Martin Andersen Nexö (1869 bis 1954) hat in dem Roman „Die verlorene Generation“ (1948; dt. 1950) diese turbulente Zeit literarisch verarbeitet. Er selbst hielt sich von Herbst 1919 bis April 1920 am See auf.
Mit dem Zug ist sein Alter ego Morten von München nach Herrsching gefahren, eine „schöne Gegend“ mit guter, reiner Luft. „Herrsching war ein Ort mit neunundsiebzig selbständigen Bauern, von denen nur wenige Pferde besaßen; die große Mehrzahl benutzte ihre Milchkühe als Zugtiere. Dicht am See hatten wohlhabende Münchner Bürger ihre Sommerhäuser, deren Fensterläden jetzt fest verschlossen waren. Man behauptete, daß sich gegenüber, auf der anderen Seite des Sees, noch ein Trupp Spartakisten aufhielt, und deshalb gingen die Bauern stets bewaffnet.“
Jede geschilderte Einzelheit seiner Begegnungen und Erfahrungen entsprichen der Wahrheit. So ist überliefert, dass der Schriftsteller im März 1920 Zenzl Mühsam begegnet ist, der Ehefrau des inhaftierten Anarchisten Erich Mühsam. Sie berichtet ihm in einem Brief von dieser Begegnung. Im Roman liest es sich so: „Drüben in der Saaltür stand im roten Pullover Bayerns meistgehaßte Frau, Erich Mühsams Frau Zenzl, und winkte ihm sorglos mit beiden Armen zu!“
Die vorliegende Anthologie vereinigt rund 50 Autorinnen und Autoren: Schriftsteller – viele von ihnen längst vergessen –, Maler, Politiker, Wissenschaftler, Komponisten, Heimatforscher oder Geistliche. Sie alle zeichnen ein unterhaltsames und informatives Bild vom Leben und der Kultur dieses Landstriches über die Jahrhunderte hinweg.