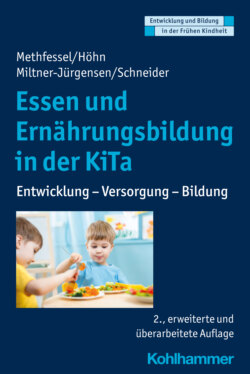Читать книгу Essen und Ernährungsbildung in der KiTa - Kariane Höhn - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1.4 KiTa – eine systemrelevante Institution ohne systemrelevante Unterstützung
ОглавлениеIn einem Lebensbereich, der einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung und dabei auch auf die gegenwärtige und zukünftige Gesundheit der Kinder hat, wird also – positiv formuliert – in der Mehrzahl der KiTas immer noch nicht nach wissenschaftlichen Empfehlungen, sondern nach »bestem Wissen« und/oder Einstellungen der jeweils Verantwortlichen gehandelt. Negativ könnte man dieses Vorgehen auch als willkürlich bezeichnen. Dabei trifft dieser Vorwurf in erster Linie die verantwortlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, die Kommunen und die dort engagierten verantwortlichen Institutionen11 ( Kap. 6 u. 7). In den meisten öffentlichen Bereichen gelten DIN-Vorschriften, sind TÜV-Prüfungen und andere Normierungen und Kontrollen verpflichtend, auch wenn diese nicht die Relevanz wie der Bereich Essen und Ernährung für das Wohlergehen und die Entwicklung des Kindes haben. Falls die Toilettenschüssel einige Zentimeter zu groß ist, kann dies die Betriebsgenehmigung für eine KiTa gefährden. Was für jeden baulichen Aspekt und die bauliche Ausstattung wie auch jedes Außenspielgerät gilt, fehlt für die Qualitätssicherung bei der KiTa-Verpflegung.
Die Chancen, die eine qualitätsorientierte Kindertagesbetreuung für die Entwicklung und Bildung der Kinder bis zum Schuleintritt, für die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit sowie für die Unterstützung von Familien haben kann, wurden in den alten Bundesländern bis Mitte der 1990er Jahre wenig genutzt. Der breitere Ausbau von Kindergärten in den alten Bundesländern begann in den 1960er Jahren (bis auf Ausnahmen) für die Vormittagsbetreuung von Kindern ab vier Jahren. In den folgenden Jahrzehnten wurde es legitimer, Kinder vor dem Schuleintritt einen Kindergarten besuchen zu lassen, um den Übergang in die Schule zu erleichtern. Die Vorstellung, dass die Aufgabe der Erziehung und Betreuung eine Aufgabe der Familien (d. h. konkret meist der Frauen) ist, leitete – und leitet in vielen Bereichen immer noch – die deutsche Familien- und Bildungspolitik in den alten Bundesländern. Dass noch heute nicht in allen Bundesländern die Verpflichtung besteht, Kindern auch bei verlängerten bzw. nicht geteilten Öffnungszeiten einer KiTa von sechs bis sieben Betreuungsstunden pro Tag (d. h. seines Wandels zur ganztägigen Betreuung) eine warme Mittagsmahlzeit anzubieten, ist ein Ausdruck davon. Das Ehegattensplitting, der späte und zögerliche Ausbau der Ganztagsschulen oder der unzureichende Ausbau von KiTas und vor allem von Krippenplätzen sind in diesem Zusammenhang als Ausdruck einer Gesellschaft, die nach wie vor auf die Verfügbarkeit der »Hausfrau« setzt, also eine Person im Familienhaushalt, die zeitlich uneingeschränkt der Versorgung mit Mahlzeiten nachkommt, immer noch kritisch zu diskutieren.
Die Möglichkeiten des »Gute KiTa Gesetzes« werden bisher (Stand Juli 2020) meist für infrastrukturelle Maßnahmen wie den überfälligen räumlichen und personellen Ausbau,12 die Reduktion des Beitrags und die Qualifizierung von (Leitungs-)Personal genutzt. Weniger als die Hälfte der Bundesländer machen allgemeine Angaben zur Förderung der Bildung, nur drei konkrete Angaben (zur sprachlichen Bildung) – und in keinem Bundesland13 für den Bereich »Gesundes Aufwachsen«, zu dem auch eine gesundheitsförderliche Ernährung gehört ( Kap. 6).
Dass »gesundheitliches Aufwachsen« für die Nutzung des Einsatzes der Mittel bisher wenig bis gar keine Bedeutung hat, signalisiert leider nicht, dass in diesem Feld kein Bedarf besteht. Die Sicherung einer qualitätsorientierten Ernährungsversorgung wird vonseiten der Gesetzgeber und Träger weiterhin vor allem den Familien überlassen. In der Diskussion spielen auch ökonomische Argumente eine Rolle.14 Aus volkswirtschaftlicher Sicht bringt der KiTa-Ausbau durch die nachgewiesenen Vorteile in der Bildungs- und Berufsbiografie einen bedeutsamen Gewinn.15 Zudem ist die Notwendigkeit des Ausbaus angesichts des Wandels der Lebensbedingungen und -formen (Bartsch & Methfessel, 2012b) inzwischen auch rechtlich gesichert und – wenn mit 93 % fast alle Kinder und dabei zunehmend Kinder unter drei Jahren in der KiTa betreut werden – mehr und mehr über alle Gesellschaftsschichten gefordert.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie von 2020 haben mehr als deutlich offengelegt, dass sich die gesellschaftlichen Strukturen auf funktionsfähige KiTas stützen – KiTas bekommen die Bedeutung sogenannter systemrelevanter Institutionen. Kinderärzte und die Familienverbände forderten bereits Anfang Mai 2020 die Wiedereröffnung der KiTas und Schulen und warnten vor der Gefährdung des Kindeswohls und vor psychischen und gesundheitlichen Schäden.16 Die Corona-Krise zeigte deutlich, dass die Bedeutung von KiTas ebenso wie die von Schulen in der politischen Diskussion immer noch zu wenig verstanden und/oder berücksichtigt wird und dass die alleinige bzw. vorrangige Zuweisung der Verantwortung an die Familien weder der gesellschaftlichen Entwicklung noch den Bedürfnissen der Kinder gerecht wird. Die hohe Rate erwerbstätiger Elternteile unterstreicht, dass die Vereinbarkeit von Familien und Beruf die stützende Struktur der institutionellen Kindertagesbetreuung erfordert. Die Corona-Krise zeigte leider auch, dass für Kinder aus Familien, die in prekären ökonomischen und sozialen Bedingungen leben, die Versorgung in der KiTa eine große Bedeutung hat, insbesondere auch für ihre Ernährung und Gesundheit.17 Mit dem Bildungs- und Teilhabegesetz hat die Bundesregierung seit 2011 die Grundlage für die Bezuschussung der Inanspruchnahme des Mittagessens in KiTa und Schule für Kinder in sozioökonomisch prekären Lebenslagen geschaffen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales BMAS, 2020).
Bezogen auf das Thema Essen und Ernährungsbildung ist also insgesamt festzuhalten, dass die KiTa eine optimale Möglichkeit für die Versorgung und Prävention für alle sozialen Gruppen bietet – und die Verpflichtung dazu hat. Eine KiTa ist wie die Schule ein
relevantes Setting für Prävention und Gesundheitsförderung im Sinne von Public Health Nutrition (PHN), welche die engen wechselseitigen Beziehungen zwischen Gesundheit und politischen, ökologischen und ökonomischen Bedingungen in den Blick nimmt, … [diese] wird in Deutschland jedoch noch nicht flächendeckend verfolgt. Dadurch werden bestehende Potenziale nicht ausgeschöpft (Kroke et al., 2020b, S. M32).
Der weitere, notwendige KiTa-Ausbau verlangt die Herausbildung neuer Strukturen – nicht nur bezogen auf Betreuungsumfang und -qualität. Auch die Umstellung des Mahlzeitenangebotes – vom gemeinsamen Verzehr des Frühstücks, das aus den (in den Familienhaushalten gefüllten) Brotdosen genommen wird, hin zu einer Versorgung mit zwei bis drei Hauptmahlzeiten und Varianten der Zwischenmahlzeiten – erfordert in der KiTa eine Neuorganisation von Zeiten, Räumen und Kooperationen der Akteure (inklusive Arbeitsbereichen und Arbeitsteilung; Kap. 7). Angesichts der unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen, Anbieterstrukturen und damit verbundenen Verantwortlichkeiten ist auch eine Verbesserung der Zusammenarbeit an den »Schnittstellen« zwischen allen beteiligten Akteuren und Institutionen notwendig. Mit diesen Fragen und Problemen müssen sich die Leitungskräfte vor Ort bisher im Wesentlichen alleine auseinandersetzen. Auf verbindliche finanzielle, personelle und räumlich ausreichende sowie effektive Strukturen können sie sich nicht stützen. Leidtragende sind einerseits die Kinder und ihre Familien und andererseits die pädagogischen Fachkräfte, die alle damit verbundenen Schwierigkeiten bewältigen müssen.
Die Vorstellung, dass die Eltern (allein) für die Ernährung der Kinder verantwortlich sind, ist sowohl überholt als auch rechtlich im Widerspruch zum UN-Recht. Nach der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 (1990 von Deutschland unterzeichnet und seit 1992 in Kraft; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend BMFSFJ, 2018; Deutsches Kinderhilfswerk, 2020) ist der Träger einer KiTa verpflichtet, Kinder nicht nur ausreichend, sondern auch gesundheitsförderlich zu ernähren und zu versorgen. Diesem Anspruch muss entsprochen werden. Da Ernährung grundlegend für Gesundheit und Lebensqualität ist, schließt diese Forderung auch eine Ernährungsbildung ein (Scherbaum et al., 2012a, 2012b; Kap. 6).
Abschließende Anmerkung: In diesem Buch wird mit Ernährung immer nur das Attribut gesundheitsförderlich verbunden und nicht das oft zu lesende, sprachlich bzw. fachlich inkorrekte Attribut »gesund« ( Kasten 1.1).