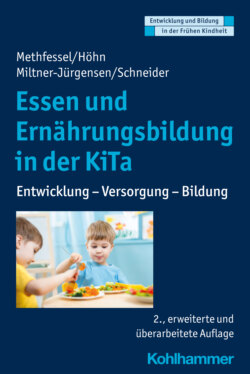Читать книгу Essen und Ernährungsbildung in der KiTa - Kariane Höhn - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.5 Ein Dankeschön
ОглавлениеAbschließend möchten wir allen Kolleginnen und Kollegen danken, denen wir bei unserer Arbeit begegnet sind, die uns bei unserer Arbeit unterstützt haben und von denen wir immer wieder Impulse und aktuelle Informationen bekamen. Besonderer Dank gilt dabei dem Landeszentrum für Ernährung und dem Referat Ernährung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg sowie der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung e. V. Berlin – und allen pädagogischen Fachkräften, die mit viel Engagement und Ideenreichtum trotz oft widriger Umstände erfolgreich an der Verbesserung des Essensangebots und der Ernährungsbildung, bei der die Mahlzeitenbegleitung ein zentraler Bestandteil ist, arbeiten.
1 Unter Nahrung wird allgemein alles gefasst, was essbar ist (»nährt«) und aufgenommen wird. Mit Lebens- oder Nahrungsmittel werden die einzelnen Elemente der Nahrung bezeichnet, wobei im Folgenden vorrangig die Bezeichnung Lebensmittel genutzt wird. Essen ist eher die Bezeichnung für das jeweils zu Essende. Speisen sind zubereitete Lebensmittel und Gerichte eine spezifische Zusammenstellung von Speisen.
2 In diesem Buch werden alle Einrichtungen für Kinder zwischen Geburt und Schulbeginn als Kindertageseinrichtung (KiTa; s. auch Gute-KiTa-Gesetz, BMFSFJ, 2019a) bezeichnet, eingeschlossen ist also auch die Krippe für Kinder unter drei Jahren. Wird die Bezeichnung Kinderkrippe verwendet, bezieht sich dies nur auf Kinder unter drei Jahren.
3 Zur Bedeutung von Mahlzeiten als Institutionen Kap. 3.4.2.
4 Diese Studie wurde von der Bertelsmann Stiftung gefördert.
5 Zur Methodik und den Unterschieden vgl. DGE (2016, S. 106 ff.).
6 KiTas, die die Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für eine ausgewogene Ernährung erfüllen, können entsprechend zertifiziert werden (zur Entwicklung vgl. DGE, 2016, S. 103 ff.).
7 Die Daten beziehen sich auf Kinder in KiTas zuzüglich der Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege, die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder eine Ganztagsschule besuchen. ABL= Alte Bundesländer, NBL = Neue Bundesländer.
8 Zu den rechtlichen Vorgaben und den Empfehlungen Kap. 6 u. 7.
9 Während es in Ostdeutschland zum Alltag gehört, dass fast alle KiTa-Kinder (99 %) ihr Mittagessen in der KiTa essen, sind es in Westdeutschland 76 % der unter 3-jährigen KiTa-Kinder und gerade einmal 64,4 % der 3- bis unter 7-Jährigen. Sehr unterschiedlich ist auch die Verteilung innerhalb der alten Bundesländer: So essen beispielsweise in Baden-Württemberg nur 39,9 % über drei Jahren in der KiTa zu Mittag, in Hamburg dagegen 98,2 % (NQZ, 2020a).
10 Diese haben z. B. Bedeutung für die Überprüfung des Anteils regionaler und/oder biologisch erzeugter Produkte.
11 In Fortbildungen und Konferenzen berichteten KiTa-Mitarbeiterinnen und -Leitungen regelmäßig, dass ihre Kritik an dem Essensangebot von den Verantwortlichen der Träger nicht an- bzw. ernstgenommen wurde. Die Ursachen sind unterschiedlich und reichen von leeren Kassen der Kommunen über Vorstellungen dazu, dass Ernährung und Gesundheitsförderung Aufgabe der Familien sind, bis hin zu Unwissenheit und Ignoranz gegenüber der Bedeutung der KiTa für die Entwicklung der Kinder – und ist meist eine Mischung mehrerer Gründe.
12 Nach den Ergebnissen der Studie der Bertelsmann-Stiftung von 2019 (Bock-Famulla et al., 2020) sind bundesdeutsche KiTas immer noch nicht ausreichend und vor allem nicht mit ausreichend qualifiziertem Personal ausgestattet.
13 Stand Juni 2020. Die Nutzung durch die Länder sind einzusehen unter BMFSFJ (2020).
14 Die Bundesländer regeln die Beitragszahlung der Eltern zur Kindertagesbetreuung unterschiedlich (Deutscher Bildungsserver, 2020c). Seit dem 1. August 2019 ist aber zumindest für Eltern, die einen Kinderzuschlag, Leistungen nach dem SGB II oder Wohngeld beziehen, bundeseinheitlich geregelt, dass sie generell keine KiTa-Gebühren mehr zahlen müssen.
15 Vgl. Interview mit der Ökonomin Katharina Spieß von A. Hagelüken (Süddeutsche Zeitung vom 08.10.2015, S. 21; s. dazu auch bereits zehn Jahre zuvor Kluge, 2005).
16 Gezeichnet ist diese von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI), der Deutschen Akademie für Kinder und Jugendmedizin (DAKJ) sowie dem Berufsverband der Kinder und Jugendärzte (bvkj) (DGKH et al., 2020; Hommel, 2020a, 2020b).
17 Zum Zeitpunkt der Überarbeitung gibt es noch keine verlässlichen Daten für die Auswirkungen auf die gesundheitliche Entwicklung der Kinder, sondern nur Vermutungen aufgrund der Berichte von Tafeln, Notdiensten, Nottelefonen etc.
18 Ernährungs- bzw. Essstile beziehen sich auf Individuen und Gruppen. Eine Lebensweise bezieht sich in diesem Fall auf die gegebenen Rahmenbedingungen und »allgemeines« Handeln und Verhalten einer Bevölkerung; damit sind hier auch Mobilität, Zeitstrukturen, Marktentwicklung etc. gemeint.
19 Da Sozialisation und Enkulturation unterschiedliche Perspektiven auf den gleichen Prozess kennzeichnen und sich diese auch weitgehend überschneiden, wird im Folgenden auch der Begriff soziokulturell genutzt.
20 Über solche Angebote zieht leider auch Werbung in den KiTa-Alltag ein, ohne dass dies ausreichend erkannt und verhindert wird. Aufgrund der Werbung werden weniger empfehlenswerte Angebote – auch mangels Alternativen – genutzt (Falck, 2015).
21 Informationen zu allen Autorinnen finden sich am Ende des Buches.
22 Eine deutsche Fassung der UN-Behindertenrechtskonvention ist auf der Website des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (2020) einzusehen. Auf dieser Website finden sich auch weitere wichtige rechtliche Grundlagen.
23 Phylogenetisch bezieht sich auf die Entwicklung der Spezies Mensch, ontogenetisch auf die Entwicklung der einzelnen Menschen.
24 Einige der in der ersten Auflage in Anhängen ergänzten Informationen wurden in das Kapitel eingearbeitet bzw. in Form von Literaturhinweisen ergänzt. Der aktuelle Anhang dient als Exkurs in zentrale fachliche Grundlagen.
25 Vgl. dazu die Nachrangigkeit der öffentlichen Jugendhilfe vor der freien Jugendhilfe gemäß § 4 SGB VIII.