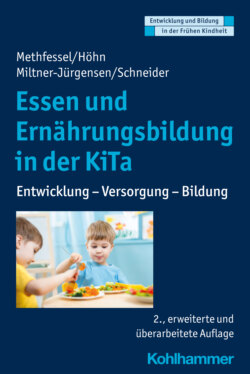Читать книгу Essen und Ernährungsbildung in der KiTa - Kariane Höhn - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.4 Vom Kind zur KiTa –der Aufbau des Buches
ОглавлениеIn dieser zweiten Auflage wurden Daten aktualisiert sowie neue Erkenntnisse und Literatur aufgenommen. Die grundlegenden Orientierungen und Aussagen haben sich nicht verändert.
Das Buch gliedert sich in sieben Kapitel. In Kapitel 2 werden zunächst die physischen und psychischen Voraussetzungen für die Ernährung zusammenfassend dargestellt. Erst eine Kenntnis der Grundlagen der Entwicklung von Verdauung und Stoffwechsel sowie der sensorischen und motorischen Voraussetzungen für das Erlernen des selbstständigen Essens ermöglicht einen responsiven Umgang mit dem Kind.
Für die Bedeutung der Interaktionen für das Essenlernen (u. a. durch Nachahmung) sowie für den Umgang mit Gefühlen ist zudem die emotionale Entwicklung grundlegend. Aus dem Zusammenhang von Essen und Emotionen ergeben sich auch Voraussetzungen und Orientierungen für den Umgang mit den kindlichen Bedürfnissen, die wiederum Auswirkungen auf die Entwicklung des Essverhaltens haben. Im letzten Abschnitt werden zentrale Begriffe und theoretische Grundlagen zu Bedürfnissen und Motiven definiert. Hier wird auch deutlich, dass Essen alle Grundbedürfnisse berührt und einen Beitrag zu deren Befriedigung bieten kann – was aber nicht bedeutet, alle Bedürfnisse mit Essen befriedigen zu können bzw. zu sollen. Daraus ergeben sich wichtige Antworten oder Hinweise bezüglich folgender Fragen: Welche Bedeutung hat Essen für die emotionale Entwicklung bzw. welche Beziehungen bestehen zwischen Emotionen und Essen? Welche Bedeutung hat die Beachtung der kindlichen Emotionen für das Essverhalten? Welchen Stellenwert sollte Essen beim Umgang mit den Grundbedürfnissen haben?
In Kapitel 3 steht die Frage »Wie lernen Kinder essen?« im Vordergrund. Diese Frage wird auf Basis folgender Erkenntnisse beantwortet:
• Kinder müssen als »instinktlose Omnivoren« essen lernen.
• Geschmack und Geschmacksentwicklung sind erlernt und seit der Schwangerschaft zentrale Einflussfaktoren auf die Essentwicklung.
• Ein Verständnis für die einzelnen phylo- und ontogenetischen Einflüsse23 kann verhindern, dass die Abwehrreaktionen der Kinder falsch interpretiert werden, und es gibt Hilfen für ihre Heranführung an Lebensmittel und Speisen.
Grundlagen der Funktionen des Essens und der Esskultur erweitern erstens den Blick: Das Alltagsverständnis ist meist zu begrenzt und durch die Selbstverständlichkeit der eigenen Gewohnheiten werden »subjektive Normalitätsverständnisse« entwickelt (Schlegel-Matthies et al., i. Vorb.) Zweitens ermöglichen sie einen Einblick in die grundlegende Bedeutung von Esskulturen für die individuell empfundene psycho-soziale Sicherheit und kulturelle Identität. Daraus können drittens Grundmuster für eine fundierte Auseinandersetzung mit anderen Kulturen und soziokulturellen Unterschieden gewonnen werden, die für den Umgang mit der zunehmenden kulturellen Vielfalt in der KiTa genutzt werden können. Viertens sind diese Kenntnisse notwendig, um die kulturelle Dimension aktueller Fragen zum Umgang mit Kinderernährung und damit verbundenen Körperbildern, Hypes, Ängsten, Moden etc. zu verstehen. Fünftens sind auch ethische Ziele wie Nachhaltigkeit und Gesundheit soziokulturell bedingte Entscheidungen. Sechstens sind sowohl Esskulturen als auch Fähigkeiten und Fertigkeiten, um sich selbstständig, eigenverantwortlich und »selbstbestimmt« ernähren zu können, Teil des Kulturwissens und mit kulturellen Werten und Wertungen verbunden. Sie werden auch über Ernährungsbildung vermittelt. Dazu wird in Kapitel 3 der theoretische Rahmen vorgestellt, in den Kapiteln 5 und 7 folgen Orientierungen und Hinweise für die Umsetzung in der KiTa.
In Kapitel 4 »Ernährung, Gesundheit und soziale Lage« wird das Verständnis von Gesundheit diskutiert, werden Ergebnisse zur gesundheitlichen Situation von Kindern vorgestellt, und es wird thematisiert, wie die soziale Lage Ernährung und Gesundheit beeinflusst. Gesundheitsförderung steht derzeit im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und individuellem Handeln und Verhalten. Analysieren zu lernen, dass und wie sich dies im wissenschaftlichen Diskurs und den alltagsbezogenen Diskussionen der Fachkräfte widerspiegelt, ist eine wichtige Kompetenz für pädagogische Fachkräfte. Der Wandel der Definitionen von Gesundheit – und damit verbundenen Rechten und Pflichten – spiegelt diese Aufgaben und Anforderungen beispielhaft. Diese als einen Ausdruck gesellschaftlicher Wertung und politischer Orientierung zu erkennen, ist Voraussetzung für ein konstruktiv kritisches Herangehen.
Gesundheitsförderung in der KiTa gelingt mit förderlichen Bedingungen und der Stärkung des Individuums. Dabei finden die Förderung der Resilienz und die salutogenetische Orientierung als pädagogisch-didaktische »Leitlinie« derzeit in den Diskussionen besondere Beachtung.
Kinderernährung ist ein etablierter Teil der epidemiologischen Forschung. Der Zugang zu einer gesundheitsförderlichen Ernährung ist erkennbar abhängig von der sozialen Lage. In vielen Studien zu Ernährung und Gesundheit wird einerseits die Bedeutung des Bildungsstands und der sozialen Lage für die Qualität der Versorgung hervorgehoben. Andererseits steht in vielen Diskussionen zur Ernährung weniger die Verhältnisprävention als die Verhaltenssteuerung im Mittelpunkt. In dem Zusammenhang ergeben sich zwei Problembereiche, die hier vertieft angesprochen werden, weil sie auch die KiTa besonders betreffen: Zum einen der Umgang mit Übergewicht und Adipositas und die damit verbundene Diskriminierung adipöser Kinder, zum zweiten die unreflektierte (Minder-)Bewertung des Ernährungsverhaltens von Menschen in sozial benachteiligten Lagen. Diese Minderbewertung kann auch Kinder und Eltern aus anderen Kulturen betreffen. Deren Essverhalten wird schnell abgewertet, was Kinder und Eltern in Konflikte bringen kann. Stattdessen ist ein respektvoller Umgang mit soziokultureller Diversität gefordert, für den auch Verständnis für die Hintergründe notwendig und hilfreich ist. Pädagogische Fachkräfte sollten also einerseits die Ursachen verstehen und zweitens nicht diskriminierend mit soziokultureller Diversität umgehen.
In Kapitel 5 werden Antworten auf die Frage »Was sollen Kinder essen?« gegeben. Hier sind die zentralen Empfehlungen für das erste und zweite Lebensjahr sowie die in den nächsten Jahren folgenden (für alle gleichen) Orientierungen zusammengestellt. Die Betrachtung der Ernährung von Geburt an ermöglicht, für die KiTa die Entwicklung des Essens einordnen sowie Entwicklungen und Eigenarten der Kinder besser nachvollziehen zu können. Um im Dschungel von Empfehlungen, Ratgebern und Werbung den Überblick zu behalten, wird auch vorgestellt, welche Empfehlungen im deutschsprachigen Raum als wissenschaftlich legitimiert gelten und worauf im Umgang mit den Produkten der Lebensmittelindustrie zu achten ist.
In diesem Kapitel sind vor allem die allgemeinen Empfehlungen zusammengefasst und durch Hinweise auf zentrale Links ergänzt. Zur Vielfalt der möglichen gesundheitsbezogenen Anforderungen an die KiTa werden nur allgemeine Hinweise zu Allergien und Unverträglichkeiten sowie zu aktuellen Ernährungskonzepten gegeben. Der Umgang mit einzelnen Krankheiten und diätetischen Anforderungen würde ein eigenes Buch verlangen.24 Wie diese Empfehlungen in der KiTa umgesetzt werden, wird in Kapitel 7 angesprochen bzw. muss für die jeweilige KiTa unter Beachtung ihres sozialen Umfeldes entschieden werden.
In Kapitel 6 werden die rechtlichen Voraussetzungen und Vorgaben, bezogen auf den Bildungsauftrag, zusammengefasst. Beispielhaft werden Aspekte der Qualitätsentwicklung rund um die Ausgestaltung der Mahlzeiten und Ernährungsbildung aufgezeigt.
Diese Themen erhalten in der Ausbildung wie auch überraschenderweise im Betrieb der KiTa meist wenig Aufmerksamkeit. In verschiedenen, die Kinder- und Jugendhilfe betreffenden Rechtsgrundlagen sind Aussagen zum Recht auf ein gesundes Aufwachsen und eine gesunde Ernährung beschrieben. Diese können auch Argumentationshilfen in den Auseinandersetzungen um eine entwicklungsangemessene und gesundheitsförderliche Ernährung bieten.
In Kapitel 7 werden die relevanten Handlungsfelder einer KiTa mit dem Fokus auf den Mahlzeiten und einer Ernährungsbildung beschrieben. Konkret geht es um die Begleitung des Kindes bei der Einnahme der Mahlzeit, die Kooperation mit den Eltern, die Zusammenarbeit im pädagogischen Team sowie mit dem Träger und das Aufgabenspektrum der Leitung. Die Anforderungen an die Professionalität des pädagogischen Personals werden beschrieben. Die folgenden wichtigen Praxisfragen werden unter Einbezug von Beispielen aus der Praxis beantwortet:
1. Wie können Mahlzeiten als wiederkehrende Handlungen im Alltag für Kinder mit unterschiedlichem Entwicklungsstand, unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten und kulturellen Hintergründen konkret gestaltet werden? Beschrieben wird, wie die Essentwicklung eines Kindes konkret durch pädagogische Arbeit und organisatorische Tätigkeiten unterstützt werden kann ( Kap. 7.2).
2. Was lernen Kinder bei einer Mahlzeit, und wie kann eine Ernährungsbildung durch begleitende Angebote wie Erkundungen, Impulse, »kleine Sachen« unterstützt werden? Dazu werden die Bildungs- und Entwicklungsthemen vorgestellt. Wie können die Bildungsinhalte den Eltern vermittelt werden? Beispiele für eine Ernährungsbildung, die auch auf Elternabenden präsentiert werden können, werden beschrieben.
3. Welche Gelingensbedingungen gibt es in Bezug auf
• Raumorganisation und Ausstattung mit Möbeln und Geschirr ( Kap. 7.7)?
• die zeitliche Organisation im Tagesablauf ( Kap. 7.4)?
• die Arrangements für entwicklungsgerechte Tischgemeinschaft? Welche Relevanz haben Rhythmen und Rituale bei der Gestaltung der Ess-Situationen? Was muss bei der Alltagsorganisation bedacht werden, damit Mahlzeiten zu angemessenen Bildungsorten werden? Dazu werden z. B. sog. Scripts vorgestellt.
• Bei der Darstellung wird dabei zwischen Kindern im Krippenalter (unter 3 Jahre) und im Kindergartenalter (über 3 Jahre) unterschieden. Beispiele unterstützen den Transfer in die eigene Praxis vor Ort.
4. Wie gelingt es, in Kooperation mit den Eltern sog. Essbrücken zu bauen und das Kind beim Kennenlernen der Speisen und der Esskultur in der KiTa individuell so zu begleiten, dass es gerne in der KiTa isst? Am Beispiel eines Interviewleitfadens wird vorgestellt, wie in der Zeit des Ankommens und des Sich-Eingewöhnens die Versorgung zwischen KiTa und Familie erörtert werden kann ( Kap 7.6).
Ein Perspektivwechsel hin zum Entdecken der Relevanz der Alltagshandlung Essen als einer pädagogischen Aufgabe soll in diesem Kapitel aufgezeigt werden, denn immer noch trifft man in der Praxis auf das Prinzip »schnell, schnell essen und dann richtig pädagogisch arbeiten«. Die Anforderungen, die sich aus einem solchen Perspektivwechsel an das Professionsverständnis und die Fachlichkeit pädagogischer Fachkräfte ergeben, werden dargestellt ( Kap. 7.5).
Der Träger muss die Relevanz von Mahlzeiten und Ernährung erkennen und entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, damit das pädagogische Team, die hauswirtschaftlichen Kräfte und die Leitung der KiTa den Auftrag von Betreuung, Versorgung, Bildung und Erziehung umsetzen können. Das Subsidiaritätsprinzip25 befördert eine höchst unterschiedliche Trägerlandschaft. Vor diesem Hintergrund werden die wesentlichen trägerübergreifenden Aufgaben für die Organisation von Mahlzeiten und eine Ernährungsbildung beschrieben ( Kap. 7.8).
Das als Beispiel dargestellte Inhaltsverzeichnis einer Verpflegungskonzeption ( Kap. 7.9) kann für Träger, KiTa-Leitung und das KiTa-Personal eine konkrete Hilfe bei der Erstellung einer eigenen Verpflegungskonzeption bieten.
Im letzten Abschnitt werden verschiedene Verpflegungssysteme vorgestellt, damit die Vor- und Nachteile dieser Systeme für eine KiTa bewertet werden können, wozu die Kriterien der DGE zugrunde liegen ( Kap. 7.10). Ergänzt sind Hinweise zu Hygieneanforderungen.
Alle Kapitel sollen möglichst auch für sich alleine verständlich sein, weshalb viele Verweise dazu dienen, Bezüge zu Themen herzustellen, die erst an anderer Stelle ausgeführt werden. Dafür wurden auch Redundanzen in Kauf genommen.
Wir hätten gerne noch viele illustrierende Beispiele aufgenommen, die begrenzte Seitenzahl ließ dies nicht zu. Wir hoffen hier auf das Beobachtungs- und Erinnerungsvermögen der Leserinnen und Leser.