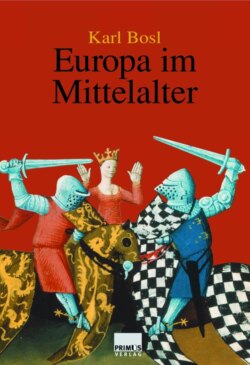Читать книгу Europa im Mittelalter - Karl Bosl - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Glaube, Staatskirche und das Werden des Papsttums
ОглавлениеChristentum und Kirche überdauerten als Geist und universale Institution den Übergang, wurden Born einer neuen Kultur und gaben einer neuen Gesellschaft ein neues Ethos und eine neue Sittlichkeit mit übernatürlicher Sanktion. Die Kirche führte die Barbaren aus Mythos, Wunder, Furcht und Scheu zu gehobeneren Leit- und Menschenbildern; sie bändigte und humanisierte die Naturgewalt und Urleidenschaft der Völker aus dem Norden und Osten. Ihr universales Reich des Glaubens band alle Menschen, nachdem der Zauber Griechenlands und die Macht Roms erloschen waren. Die Kirche war seit Konstantin Ergebnis, Werkzeug und Träger der Macht geworden; trotzdem befriedigte sie damals den geistigen Hunger der von Armut gequälten und im Daseinskampf zermürbten Menschen, kam ihrer Lebens- und Todesangst mit Trost und Mysterium entgegen. Sie war eine mächtige Institution unzähliger Gemeinden mit festen kleinen und großen Vorstehern, an deren Spitze die Patriarchen von Konstantinopel, Antiochien, Jerusalem, Alexandrien und Rom standen.
Patriarch oder Kaiser beriefen die Bischöfe zu Synoden und Konzilien. Ansehen und Macht der Kirche ruhten in der Überzeugung der Gläubigen, die um so stärker war, je mehr es ihr gelang, ihre Ideale mit der realen Welt abzustimmen und mit dem »Staat« zusammenzuleben.
Ein Ausgleich zwischen staatlicher und kirchlicher Macht gelang in Wahrheit nur, wenn eine der beiden sich unterordnete; im Osten tat das die Kirche, im Westen kämpfte sie um Selbständigkeit und dann um Vorherrschaft. Der Bund zwischen Staat und Kirche war von einem Wandel der christlichen Ethik begleitet. Einmal wandte sich die gewaltlose und friedenbringende Kirche an den »weltlichen Arm«, um ihre Mission zu erfüllen; als sie reich geworden war, brauchte sie den Staat zum Schutze ihres Vermögens. Die Kirche wahrte ihren Reichtum über den Zusammenbruch des Staates hinaus, da sich die Barbaren aus religiöser Scheu selten daran vergriffen; das Wort erwies sich letztlich stärker als das Schwert.
Die siegreiche Kirche wurde intolerant wie der absolute Staat. Häresien galten nicht nur als religiöse Gefahr, man erblickte in ihnen auch Anzeichen revolutionärer Haltung gegen die Reichsgewalt (Monophysiten Syriens und Ägyptens, Donatisten Afrikas). Die Staatsreligion bekämpfte den Nationalismus, die Ketzerei verteidigte ihn, die Kirche erstrebte Einheit und Zentralisierung, die Ketzerei Unabhängigkeit und Freiheit.
Von Goten in Kleinasien gefangene Römer vermittelten den Germanen die Lehre des Arius, die ihre Herzen gewann. Der Arianismus wurde Staatsreligion in den germanischen Reichen auf dem Balkan, in Gallien, Spanien, Nordafrika und Italien. Die von Wulfila († 393) besorgte Übersetzung der griechischen Bibel in das Gotische stellt das erste literarische Werk in germanischer Sprache dar.
Der Gegensatz zwischen Arianismus und Orthodoxie beherrschte auch die Politik des 5. und 6. Jahrhunderts. Der Arianismus verlor seine Wirkung und seine Geltung erst, nachdem seine Hauptbastionen fielen, das Westgotenreich in Gallien vor dem Franken Chlodwig († 511) kapitulierte, Nordafrika und das ostgotische Italien von dem oströmischen Reichsfeldherren Belisar erobert wurden und der Westgotenkönig Reccared in Spanien 589 zum Katholizismus übertrat.
Der Manichäismus hatte viele, auch todesbereite Anhänger in Ost und West im 4. Jahrhundert, die seine Lehre vom Bösen und unverdienten Leid, vom Dualismus zwischen Gut und Böse ansprach. Bei Bogomilen und Albigensern lebte er im Hochmittelalter wieder auf. Der afrikanische Donatismus war im 7. Jahrhundert noch lebendig und verhinderte einen Widerstand gegen die arabische Invasion.
Die folgenschwerste Häresie war der Monophysitismus des Eutyches, eines Klostervorstehers aus der Nähe von Konstantinopel, der in Christus nur eine göttliche Natur annahm. Das zweite Konzil von Ephesos (449), von Papst Leo I. darum als »Räubersynode« gebrandmarkt, billigte diese Lehre, das Konzil von Chalcedon (451) verwarf sie und kehrte zum Dogma von der Doppelnatur Christi zurück. Das Chalcedonense sprach dem Bischof von Konstantinopel die gleiche Autorität wie dem von Rom zu und löste damit einen langen Kampf zwischen beiden Sitzen aus.
Der Monophysitismus wurde zur Nationalreligion des christlichen Ägyptens und Abessiniens und herrschte im 6. Jahrhundert auch in Westsyrien und Armenien vor; der Nestorianismus mit seinem Zweifel an der Gottesmutter eroberte sich Mesopotamien und Ostsyrien. Dies hatte aber eine wichtige politische Folge: halb Ägypten und der Nahe Osten begrüßten die Araber im 7. Jahrhundert als Befreier vom religiösen, politischen und finanziellen Joch der byzantinischen Hauptstadt.
Erst mit Leo I. (440 – 461) gewannen die Bischöfe von Rom wieder Macht und Würde. Er bestimmte bei seinen Auseinandersetzungen mit Bischof Hilarius von Poitiers Kaiser Valentin III. zu dem epochalen Dekret, das die Machtbefugnisse des römischen Bischofs über alle Kirchen kraft kaiserlicher Autorität bestätigte. Doch konnte der Westkaiser dies nur für das Westreich aussprechen, dessen Bischöfe sich im allgemeinen beugten; doch die Ostbischöfe versagten sich. Sprach- und Verkehrsschwierigkeiten vergrößerten die Kluft zwischen Ost- und Westkirche; die Patriarchen von Konstantinopel, Antiochien, Jerusalem und Alexandrien beanspruchten die gleichen Befugnisse, wie sie der römische Bischof besaß. Die Westbischöfe erlangten in den Notzeiten des Übergangs immer größere Herrschaftsrechte, bis zum 7. Jahrhundert ließen sie sich auch vom Kaiser bestätigen. Doch war Ostrom so weit entfernt, daß sich die römischen Päpste eine Vorherrschaft sichern konnten, die ihr mutiges politisches Auftreten und Wirken in der Zeit der Invasionen bedeutend verstärkte. Die Bekehrung der Germanen im Westen aber gab ihnen eine umfassende Autorität. Die christlichen Könige und der christliche Adel machten ihnen zudem reiche Schenkungen. Prächtige Basilikalkirchen zierten um 400 die alte Hauptstadt, in der sich eine hochfeine christliche Gesellschaft ausbildete; nur eine Minderheit nahm es mit einem Leben nach den Evangelien ernst. Die Päpste errichteten Klöster nach dem Vorbild der Mönchsväter des Ostens (Antonius, Schenute, Pachomius) und regten auch die reiche und fromme Laienwelt zu Stiftungen und asketischem Leben an.