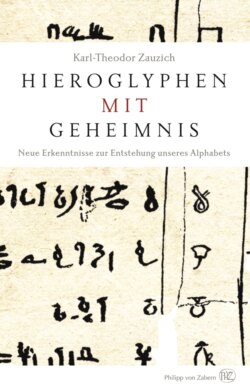Читать книгу Hieroglyphen mit Geheimnis - Karl-Theodor Zauzich - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3. DIE PROTOSINAITISCHE THEORIE
Diejenige Theorie über die Herkunft der phönizischen Schrift, die zur Zeit am häufigsten in der Literatur vertreten wird, ist die „protosinaitische“ Theorie, die man geradezu als „Standardtheorie“ bezeichnen kann, denn sie erscheint in allen Lexika und den meisten Büchern, die sich mit dem Thema beschäftigen, jetzt auch auf sehr vielen Seiten im Internet. Die Theorie hat aber einige eklatante Schwächen, die von ihren Anhängern meistens diskret verschwiegen werden, hier aber genannt werden müssen.
3.1 Darstellung der Theorie
Als der englische Ägyptologe Alan Gardiner sich anschickte, die hieroglyphischen Inschriften vom Sinai zu publizieren, wurde er auch mit einer Gruppe von Inschriften in einer rätselhaften, unentzifferten Schrift konfrontiert, die man jetzt meistens „protosinaitisch“ nennt. Gardiner bemerkte dabei, daß sich eine Gruppe von vier Zeichen in mehreren Texten wiederholt.
Da diese vier Zeichen auch auf einer Sphinxfigur stehen, die auf einer Seite die hieroglyphische Inschrift „Geliebt von Hathor, der Herrin des Türkis“ trägt, versuchte Gardiner, in der protosinaitischen Inschrift eine Entsprechung zu einem der ägyptischen Wörter zu finden. Dieser Versuch drängte sich geradezu auf, weil es sich um den einzigen Fall handelt, in dem auf einem Objekt ägyptische Hieroglyphen neben bzw. über protosinaitischen Schriftzeichen stehen. Gardiner ging dabei von der Annahme aus, daß die protosinaitischen Zeichen von Semiten angebracht worden seien und entzifferte die vier Zeichen als B-c-L-T „Herrin“. Die phonetischen Werte wollte Gardiner aus den Anfangsbuchstaben jener semitischen Wörter ableiten, die anscheinend mit den Zeichen gemeint sind:
| = Haus | = Beth | |
| = Auge | = cAjin | |
| = Strick | = Lamed | |
| = Zeichen | = Taw. |
Dieser Vorschlag Gardiners, dessen hypothetischen Charakter der große Gelehrte deutlich betont hatte, wurde von der Fachwelt begeistert aufgenommen, schien doch in der protosinaitischen Schrift endlich die bislang fehlende Verbindung (missing link) zwischen den Hieroglyphen und der phönizischen Schrift gefunden zu sein. Einen entschiedenen, aber besonnenen Anhänger fand die Hypothese Gardiners in dem deutschen Ägyptologen Kurt Sethe. Leider waren zahlreiche andere Wissenschaftler weniger vorsichtig und publizierten die abenteuerlichsten „Entzifferungen“ und „Übersetzungen“ der protosinaitischen Inschriften. Zu erwähnen sind hier die Namen Robert Eisler, Romain F. Butin, Hubert Grimme, Joseph Leibovitch und auch William Foxwell Albright.35 Einige Arbeiten der genannten Autoren haben durchaus wissenschaftliche Verdienste, doch lassen sie überwiegend die Vorsicht vermissen, die Gardiner im Schlußsatz seines grundlegenden Aufsatzes von 1916 so formuliert hat: „Further speculation as to details is hardly likeley to prove fruitful in the lack of more decisive evidence.“ (Weitere Spekulation über Details wird sich schwerlich als nützlich erweisen, solange Zeugnisse von größerer Klarheit fehlen.)
3.2 Die Schwächen der protosinaitischen Theorie
3.2.1 Auch wenn noch so oft das Gegenteil behauptet wird, ist die protosinaitische Schrift bis heute nicht wirklich entziffert. Selbst Gardiner hat immer nur seine Identifizierung von vier Konsonanten als für einigermaßen gesichert gehalten. Alle weiter gehenden Entzifferungsvorschläge von Gelehrten wie Grimme, Leibovitch, auch Albright und neuerdings Colless sind ganz und gar ungesichert und sehr wahrscheinlich weitgehend, wenn nicht total irrig. Besonnene Stimmen warnen zwar immer wieder, doch kommen diese in den mehr populärwissenschaftlichen Büchern und in den Lexika kaum zu Wort. Ich zitiere nur einen Satz aus dem Buch „Geschichte der Schrift“ von Johannes Friedrich, das immer noch eines der besten zum Thema ist: „Auch der etwaige Anteil der Sinai-Schrift an der Entwicklung der Buchstabenschrift, wenn auch nicht als deren Vorstufe und Bindeglied zur ägyptischen Schrift, so doch als eine ältere Seitenverwandte, läßt sich bei der Unsicherheit ihrer Entzifferung und Lesung gar nicht bestimmen.“36 Noch schärfer hat Hans Bauer seinen Widerspruch eingelegt: „Die zweite Alternative gilt für die Sinaischrift. Man kann von ihr … keinen einzigen Buchstaben mit Sicherheit lesen. Auch die als Ba‘lat gedeutete Gruppe kann … etwas ganz anderes besagen.“37 Und noch deutlicher formuliert der gleiche Gelehrte: „Man wird sich in einer späteren Zeit über die Leichtgläubigkeit wundern, mit der sich ernste Gelehrte von dem Trugbild der Sinaischrift als Urbild unserer Schrift haben gefangen nehmen lassen.“38
Man braucht übrigens nur einmal die „Entzifferungen“ für ein und dieselbe Inschrift anzusehen, um zu erkennen, daß hier unendlich viel phantasiert und auch unredlich veröffentlicht worden ist. Als Beispiel gebe ich die Vorschläge zur Sinai-Inschrift 349.
Butin (1928): „(1) M-š, (2) Oberhaupt der Stelenerrichter, (3) hat diesen Libationsaltar errichtet, (4) Stehe auf, jetzt, o Baalt … (5) der Bruder des Prinzen (deines Dieners) … (6) M-š … (7) -š …“39
Grimme (1929): „(1) Ich (bin) Hatšepšu-mš (2) Oberer der (Edel-) Steinarbeiter (3) Oberaufseher der Wiese(?) der Mana (?) auf Sinai (?)“. (4) [Ich seufzte:?] Es ist vergeblich! Gebt mir (neues) Leben! (5) [Und] du berührtest mich … (6) und ich bin gerettet von (7) meinen Sünden.“40
Albright (1969): „(1) Du o Opferer, (2) Ober-Bergarbeiter, ein Opfer, (3) bereite es vor Baalt, (4) im Namen von Ahena. O Opferer, ein (5) Opfer eines wilden Schafes. Im Namen seines Sohnes, (6) [Elya]tu’ (?), gi[b, o Opfer]er, (7) ein wildes Schaf für [Baalt(?)]“ 41
van den Branden (1979): „(1) Ich bin Tšc (2) Chef der Bildhauer. Ein Opfer eines (3) Kuchens von ’Il… (4) für die Freundschaft der Brüder und für … (5) der Schwestern … (6) die Expedition … (7) ich gemacht habe …“.42
Colless (1990): „(1) (Das ist?) die Ausrüstung (2) des Chefs der Präfekten Mš. (3) Der Apparat für die Arbeit (4) … Brüder (5) zehn Gefangene (6) Männer aus A[rwad] (7) …“.43
Ich glaube, hier erübrigt sich jede weitere Kommentierung. Man kann nur mit Grimme seufzen: „Es ist vergeblich!“
Das Interesse an dieser merkwürdigen Schrift ist vor wenigen Jahren dadurch neu entfacht worden, daß die amerikanischen Ägyptologen John und Deborah Darnell 1999 an ganz unerwarteter Stelle, nämlich im Wadi el-Hôl (westlich von Luxor), eine zuvor unbekannte Inschrift entdeckt haben, die ganz ähnliche Zeichen wie die protosinaitische Schrift aufweist. Diese Inschrift besteht aus einer waagerechten Zeile mit 16 Zeichen und einer senkrechten Zeile mit 12 Zeichen und kann als der längste und am besten erhaltene Zeuge dieser Schrift gelten. Man hätte erwarten können, daß der neue Text die vermutete Entzifferung der protosinaitischen Schrift bestätigt. Das ist nicht der Fall, denn eine überzeugende Deutung ist bisher nicht gelungen.44 Die Zweifel an der Entzifferung werden durch den neuen Text jedenfalls nicht verringert, ja wenn man streng urteilt, könnte man ihn sogar für einen Beweis gegen die Entzifferung der Schrift halten.
3.2.2 Der Ansatz zur Erklärung der protosinaitischen Schriftzeichen ist in sich ziemlich kompliziert. Der vermutlich semitische Schrifterfinder soll eine ägyptische Hieroglyphe ausgewählt haben und diese nicht ägyptisch, sondern in seiner Muttersprache benannt und von diesem Namen den ersten Buchstaben als Lautwert für das Zeichen festgesetzt haben. Eine ägyptische Hieroglyphe für ein Haus bekommt also den Wert „B“, weil Haus in semitischen Sprachen „Beth“ heißt, so wie der Buchstabenname Beth. Ein Rinderkopf muß dann natürlich ein Aleph sein, weil hebräisch Äläph „Rind“ heißt, usw.
Ich will nicht bestreiten, daß man eine Schrift auf diese Weise „erfinden“ kann. Sehr viel näher liegt aber, was im Altertum oft belegt ist, daß man bei der Übernahme von Zeichenformen aus einer fremden Schrift zugleich auch deren Lautwerte übernimmt, so wie es die Griechen ja auch mit der phönizischen Schrift oder ihrem Vorläufer gemacht haben. Sonst hätten die Griechen z.B. aus dem Beth ein o machen müssen, weil oikos, ein griechisches Wort für „Haus“, mit o beginnt. Aber aus Ajin wäre dann auch ein o geworden, weil „Auge“ ophthalmos heißt. Auf diese Weise hätten sie nie und nimmer eine für ihre Sprache brauchbare Sammlung von Schriftzeichen bekommen, eben kein „Alpha-bet“, sondern ein „Bous-oikos“ oder etwas ähnlich Unsinniges.
Noch etwas ist zu bedenken, was die Vertreter der Standardtheorie verschweigen: Die Ägypter hatten schon im 3. Jahrtausend vor der Aufgabe gestanden, fremde Namen und Wörter mit Hieroglyphen so zu schreiben, daß auch deren Vokalisation wenigstens näherungsweise erkennbar wurde. Dafür wählten sie bestimmte Zeichen und Zeichengruppen in der sogenannten „Gruppenschrift“ oder „syllabischen Schrift“ aus. Dem „Erfinder“ der protosinaitischen Schrift stand also eine feste Auswahl von Zeichen zur Verfügung, mit denen semitische Namen und Wörter geschrieben werden konnten und die dem semitischen Lautsystem entsprachen. Hätte er bei der Übernahme bestimmter Zeichen deren Lautwert geändert, wäre das ganze gut ausgedachte System in sich zusammengebrochen und es hätten womöglich für manche Laute gar keine Zeichen zur Verfügung gestanden!
3.2.3 Die graphische Verbindung zwischen Hieroglyphen und protosinaitischen Zeichen einerseits und zwischen den protosinaitischen und den phönizischen Zeichen andrerseits ist in vielen Fällen überhaupt nicht nachvollziehbar. Das phönizische Zeichen Beth sieht nun wirklich nicht wie ein Haus aus, und niemand würde einen Mund wie das phönizische Pe zeichnen. Es ist eben andersherum: Die Buchstabennamen sind ägyptische Wörter, die nur zufällig in einigen Fällen wie semitische Wörter klingen, wie beth „Haus“ und pe „Mund“. Andere Buchstabennamen wie Daleth und Nun lassen aber keine direkte Deutung aus semitischen Sprachen zu. Die gelehrten Anhänger der Standardtheorie haben in diesen Fällen zu mancherlei Hilfskonstruktionen gegriffen, deren Phantasie alle Anerkennung verdient.45
3.2.4 Die Standardtheorie behauptet, daß die uns in hebräischer (und griechischer) Form überlieferten Buchstabennamen semitische Wörter sind, deren Anfangsbuchstaben den Lautwert der Zeichen bestimmt hätten. Diese Behauptung klingt bei manchen Buchstabennamen überzeugend, wie z.B. bei Beth = „Haus“ oder Jod = „Hand“, auch wenn man teilweise eine Abweichung der Vokalisierung akzeptieren muß. Schwerer wiegt der Einwand, daß nur etwa die Hälfte der Buchstabennamen auf diese Weise erklärbar ist. Manche hebräische Buchstabennamen lassen sich gar nicht mit einem semitischen Wort in Verbindung bringen, bei anderen ist die vorgeschlagene Verbindung problematisch. So soll etwa der Buchstabenname Waw auf ein hebräisch überliefertes Wort Waw = Nagel (oder Haken) zurückgehen. Aber es gibt gar kein allgemeingültiges hebräisches Wort Waw mit der Bedeutung „Haken“. Alle Stellen im Alten Testament, wo dieses Wort vorkommt, beziehen sich ausschließlich auf einen Haken oder etwas ähnliches, an dem der Vorhang der Stiftshütte aufgehängt wurde. Der Haken heißt also wahrscheinlich nur deshalb Waw, weil er wie der Buchstabe Waw aussah – so wie wir von einem T-Träger oder einer S-Kurve sprechen.
3.2.5 Gar keine Erklärung weiß die Standardtheorie für die Abweichung der griechischen Buchstabennamen von den semitischen. Warum heißt Reš auf griechisch Rho, warum Zajin auf griechisch Zeta usw., vgl. hierzu Kapitel 4.4.
Aus all diesen Einwänden ergibt sich der Schluß, daß die „Standardtheorie“ über die Herkunft des Alphabets alles andere als gesichert ist. Es besteht daher jede Berechtigung, einen anderen Weg zu suchen.