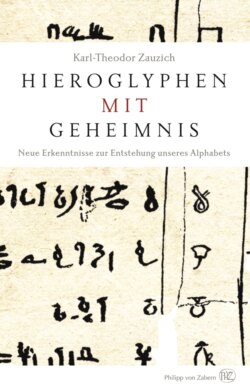Читать книгу Hieroglyphen mit Geheimnis - Karl-Theodor Zauzich - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4. DIE HIERATISCHE THEORIE
Die an sich sehr naheliegende Idee, daß die „lineare“ phönizische Schrift von der ägyptischen hieratischen Schrift abgeleitet ist, die im Vergleich zur Hieroglyphenschrift ebenfalls eher linear erscheint, weil sie die ursprünglichen Bildzeichen kaum noch erkennen läßt, wurde von dem französischen Ägyptologen Emmanuel de Rougé bereits im Jahre 1859 geäußert.46
4.1 Darstellung der Theorie
Nach der Theorie von de Rougé sind die phönizischen Schriftzeichen unmittelbar aus Zeichen der hieratischen Schrift in Form und Lautung abgeleitet. Dieser Theorie haben sich einige andere Gelehrte angeschlossen, so besonders Heinrich Brugsch,47 Pierre Montet,48 Alexis Mallon,49 Wolfgang Helck50 sowie der Verfasser dieses Buches in mehreren Aufsätzen.51 Seit man weiß, daß auf manchen hebräischen Ostraka und Gewichten die Zahlzeichen in ägyptisch-hieratischer Schrift geschrieben sind,52 hätte man eigentlich auf die hieratische Theorie zurückkommen müssen. Daß trotzdem die protosinaitische Theorie bis jetzt ihre vorherrschende Stellung behalten konnte, liegt nicht nur an dem bekannten Beharrungsvermögen von Lehrmeinungen,53 sondern auch an einer klar erkennbaren Schwäche der hieratischen Theorie.
4.2 Die Schwäche der hieratischen Theorie
Der Schwachpunkt besteht in dem außerordentlich großen Zeichenvorrat der hieratischen Schrift, der es erlaubt, viele äußerliche Ähnlichkeiten zwischen bestimmten hieratischen und phönizischen Schriftzeichen zu sehen. Zwar stimmen alle Anhänger der Theorie bei ein paar Zeichen überein, bei anderen Zeichen gibt es jedoch mehrere konkurrierende Vorschläge, so daß hier der Eindruck der Willkür entsteht, vgl. Anhang 1. Auch haben die Vertreter dieser Theorie manchmal die graphischen Möglichkeiten überschätzt. Eine so eindeutig festgelegte geometrische Form wie ein Kreis, also wie das phönizische Ajin und das griechische Omikron, kann kaum ein anderes Vorbild haben als eben wieder einen Kreis. Merkwürdigerweise hat bisher noch niemand gesehen, daß daher nur ein einziges ägyptisches Wort den phönizischen Buchstaben produziert haben kann, nämlich eines, das „Ring“ bedeutet und mit einem Ajin beginnt. Dieses Wort heißt cw mit einer Nebenform cw cw, wie später ausführlich zu erörtern ist.54
Um nun den Vorrat der hieratischen Zeichen, die als Vorbilder für phönizische Schriftzeichen gedient haben könnten, einzuengen, sind zwei neue Gesichtspunkte vorgeschlagen worden, einer von dem früheren Hamburger Ordinarius für Ägyptologie Wolfgang Helck (1914–1993), der andere vom Autor dieses Buches.
Helck55 meinte, daß nur solche Zeichen ausgewählt worden seien, die in der ägyptischen Schrift üblicherweise bei der Wiedergabe fremder Wörter und Namen wie Silbenzeichen (in der sogenannten syllabischen Schrift) verwendet wurden. Ich halte diesen Ansatz für richtig und stimme mit mehreren konkreten Vorschlägen Helcks überein; bei anderen habe ich aber Gegenvorschläge.
4.3 Die Theorie des Verfassers
Meine eigene Theorie, die ich erstmals 1973 kurz skizziert56 und in mehreren Aufsätzen weiter ausgebaut habe, hat den großen Vorzug, geradezu verblüffend einfach zu sein. Ich behaupte nämlich, daß die überlieferten semitischen und griechischen Buchstabennamen nichts anderes sind als die ägyptischen Namen der gewählten Hieroglyphen. Natürlich haben das andere vor mir auch schon gedacht, jedenfalls bei einigen Zeichen wie Rho und My. Systematisch auf das ganze Alphabet hat diesen Ansatz meines Wissens nur der Schriftpädagoge Wilhelm Weidmüller angewandt.57 Da ihm aber gründliche ägyptologische Kenntnisse fehlten, hat er sich in vielen Fällen geirrt. Außerdem hat er seine Beiträge außerhalb der bekannten Fachzeitschriften veröffentlicht, so daß sie weitgehend unbemerkt geblieben sind.58
Der Autor dieses Buches geht davon aus, daß der „Schrifterfinder“ eine Vorlage wie den Sign-Papyrus59 benutzt hat. Aus dessen erster Spalte hat er sich vorwiegend Zeichen der Struktur Konsonant + Vokal + schwacher Konsonant ausgesucht, also Zeichen, wie sie vornehmlich in der eben erwähnten Silbenschrift verwendet wurden. Aus der zweiten Kolumne hat er die hieratische Schreibung als graphische Form seines Buchstabens übernommen, und die dritte Spalte hat ihm den Namen für das Zeichen geliefert, den er transkribiert oder auch ganz oder teilweise ins Semitische übersetzt hat.
Nun ist zwar der Sign-Papyrus erst im 1. Jh. n. Chr. geschrieben worden, aber man darf ohne Bedenken annehmen, daß es ähnliche Zusammenstellungen schon im 2. Jahrtausend v. Chr. gegeben hat und daß der Sign-Papyrus auf einer wesentlich älteren Vorlage beruht, die uns nicht erhalten ist.60 Die Tradierung von religiösen, literarischen und wissenschaftlichen Texten über viele Jahrhunderte, ja über Jahrtausende hinweg, war in Ägypten die Regel, für die wir ständig neue Beweise finden.
4.4 Unterschiede der hebräischen und griechischen Buchstabennamen
Die Namen der Buchstaben sind uns in hebräischer Form aus dem Alten Testament überliefert, weil der Psalm 119 nach dem Alphabet gegliedert ist und jeweils acht Verse mit den Buchstabenamen von Alpha bis Taw beginnen läßt.61 Die griechische Übersetzung der Septuaginta überliefert ziemlich genau die hebräische Form der Buchstabennamen (alph, bêth, gimel, delth, ê, ouaou usw.). Ähnlich genau gibt auch die lateinische Übersetzung der Bibel durch Hieronymus (347–420) die hebräischen Namen wieder (aleph, beth, gimel, daleth, he, vau usw.). Die uns bekannten griechischen Namen der Buchstaben, wie sie in jedem Lehrbuch der griechischen Sprache stehen, sind bei verschiedenen antiken Autoren notiert.62
Die folgende Liste stellt die hebräischen und die griechischen Buchstabennamen nebeneinander, um deren Unterschiede deutlich zu machen.
a) Der auffallendste Unterschied ist der, daß die griechischen Namen in vielen Fällen mit einem a enden, das in den hebräischen Namen fehlt. Es ist zur Zeit nicht geklärt, woher dieses Alpha kommt, ob es auf ein semitisches Vorbild zurückgeht oder auf einer innergriechischen Entwicklung beruht. Da jedoch griechische Wörter nur mit einem Vokal oder einem der Konsonanten Ny, Chi, Rho und Sigma enden können, ist es recht wahrscheinlich, daß die Anfügung einer Endung -a auf den Erfordernissen der griechischen Sprache beruht. Bei den Buchstaben Gamma, Kappa, Qoppa und anscheinend auch Sigma wird zur Wahrung des geschlossenen63 Charakters der vorhergehenden Silbe deren Schlußkonsonant vor der Endung -a verdoppelt.
b) In mehreren Fällen zeigen die griechischen Buchstaben griechische Zusätze (mikron = klein, mega = groß, psilon = „beraubt“), die später diskutiert werden.
c) Die interessantesten Unterschiede in den Buchstabennamen sind diejenigen, für die keine Erklärung auf der Hand liegt, nämlich Gimel/Gamma, Zajin/Zeta, Mem/My, Nun/Ny, Samekh/Chi und Reš/Rho. Hinsichtlich dieser Unterschiede ist die bisherige Theorie zur Herkunft des Alphabets mehr oder weniger ratlos,64 während die Theorie des Verfassers für alle Fälle begründete Vorschläge machen kann.
Zu der Vokalisation der hebräischen Buchstabennamen ist zu sagen, daß sie eigentlich ein Anachronismus ist, ein Verstoß gegen die Geschichte. Die Pünktchen und Striche unter, in oder über den Buchstaben, die die Vokale bezeichnen, wurden erst von jüdischen Schriftgelehrten, den Masoreten, nach 500 nach Chr. eingeführt. Die nordwestsemitischen Linearschriften (Phönizisch, Hebräisch, Aramäisch u.a.) hatten, im Gegensatz zur Keilschrift und der griechischen Schrift, keine Möglichkeit, Vokale darzustellen. (Abgesehen von den sogenannten Plene-Schreibungen [„Voll“-Schreibungen], in denen bestimmte Konsonanten bestimmte Vokale als matres lectionis [„Lesungs-Mütter“] andeuten.)