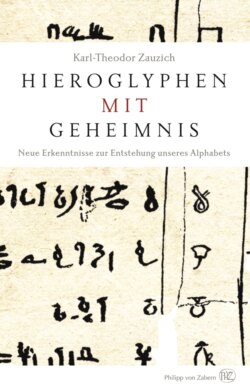Читать книгу Hieroglyphen mit Geheimnis - Karl-Theodor Zauzich - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Die hieroglyphische Schrift
ОглавлениеSolche Schriftzeichen haben alle Leser schon gesehen, sei es in einem Museum, in Ägypten selbst oder auf einem Obelisken in Rom, Paris, New York oder München. Die Schrift hat einen hohen ästhetischen Reiz (vgl. Tafel 1) und ist relativ leicht erlernbar, weil fast jedes Zeichen ein Objekt aus der realen belebten oder unbelebten Natur darstellt – wozu für den Ägypter natürlich auch die Götter gehörten. Abstrakt geometrische Zeichen oder gar die Zeichen der Keilschrift lassen sich ungleich schwerer erlernen und merken als die Bilder der Hieroglyphenschrift, sie sind mnemotechnisch (erinnerungsmäßig) ungleich ungünstiger als sie. Wenn Ihnen jemand sagt, daß einen Mund bedeutet und Wasser, so werden Sie das vermutlich niemals mehr vergessen. Aber die gleichbedeutenden Zeichen und der Keilschrift werden Sie sich kaum so leicht einprägen.
Die Hieroglyphenschrift, die von rechts nach links oder umgekehrt geschrieben werden kann, auch in senkrechten Kolumnen, verfügt über reichlich 20 Zeichen, die jeweils einem einzigen Konsonanten = Buchstaben entsprechen, sowie über eine große Anzahl von Zeichen, die die Kombination von zwei oder drei Konsonanten bedeuten, ferner über zahlreiche Wortzeichen (Ideogramme). Dies sei an einem Beispiel verdeutlicht. (Die Schriftrichtung erkennt man leicht an den Zeichen, die einen Menschen oder ein Tier darstellen: Sie schauen immer dem lesenden Auge entgegen, wenden ihm niemals „unhöflich“ den Rücken zu.)8
Der Name des Königs Ramses III. lautet in Originalschrift und in Umschrift (Umsetzung in lateinische Schrift mit Sonderzeichen):
Außer den erwähnten Zeichen mit phonetischem Wert gibt es noch die Determinative, die am Ende eines Wortes stehen und dessen Zugehörigkeit zu einem bestimmten Objektkreis markieren, z.B. Menschen, Tiere, Pflanzen, Gebäude usw. Diese Zeichen sind Lesehilfen, die selbst aber nicht gelesen werden. Auch die sogenannte Kartusche, die oben den Namen des Königs umschließt, ist eine Art Determinativ und weist darauf hin, daß ein königlicher Name vorliegt. Ein einzelner Strich (Determinativstrich) zeigt an, daß die jeweilige Hieroglyphe genau das bedeutet, was sie als Bild darstellt. So ist nur der Buchstabe r, dagegen das ägyptische Wort r für „Mund“.
Wichtig in unserem Zusammenhang ist, daß die Hieroglyphenschrift nur Konsonanten schreibt. Es gibt zwar ein paar Konsonanten, die Vokalen nahestehen, etwa das W(aw) und das J(od). Aber unter den vielen hundert Hieroglyphen gibt es keine einzige, die einen Vokal bezeichnet. (Ägyptologen sprechen nur einige Konsonanten wie Vokale aus, z.B. das W als U, oder fügen ein E zwischen zwei Konsonanten, um die Wörter aussprechen zu können.)
Wenn die Vokale nicht geschrieben werden, müssen viele verschiedene Wörter in der Schrift vollkommen gleich aussehen. Um diese zu unterscheiden, muß irgendein graphisches Mittel gefunden werden. In der ägyptischen Schrift erfüllen die Determinative diese Aufgabe. So gibt es z.B. viele Wörter mit den Konsonanten wn (hier wn-n geschrieben), die nur durch das Determinativ unterscheidbar sind:
| mit Determinativ der Tür | „öffnen“ | |
| mit Determinativ der laufenden Beine | „eilen“ | |
| mit Determinativ „schlechter Vogel“ | „Fehler“ | |
| mit Determinativ der Haarlocke | „kahl werden“ | |
| mit Determinativ einer Stadt mit Straßen | „StadtHermupolis“ | |
| mit Determinativ der strahlenden Sonne | „Licht“ |
Würde man statt eines Determinativs nur einen Strich, den sogenannten Determinativstrich, schreiben, also , so erhielte man ein Wort für „Hase“; leider ist dieses bisher in keinem ägyptischem Text nachzuweisen.
Übrigens verfügt auch die deutsche Schrift über ein graphisches Mittel zur Unterscheidung gleich klingender Wörter, nämlich die Großschreibung. Es wäre töricht – wie manche es wünschen –, auf diese enorme Lesehilfe zu verzichten, die uns auf den ersten Blick mitteilt, daß „sage“ eine Verbform ist, „Sage“ aber ein Substantiv.
Zwei Konsonanten müssen eigens erwähnt werden, weil sie in der lateinischen Schrift nicht vorkommen, nämlich das Aleph und das Ajin. Aleph entspricht etwa dem harten Stimmansatz, den wir vor Vokalen am Wortanfang sprechen. Es ist der knackende Laut, den man beim Singen zu vermeiden sucht. Chorleiter, die ihren Sängern den harten Stimmansatz austreiben wollen, sagen gern: „Denken sie sich ein H vor den Vokal.“ Mein Hebräisch-Lehrer erklärte das Aleph als den lautlichen Unterschied zwischen einer „Ameise“ und einer „am Eise“. Ameise – am ’Eise.
Ein noch wesentlich härterer Stimmansatz ist das Ajin, das in der deutschen Hochsprache nicht vorkommt. Beide Konsonanten können im Ägyptischen wie in den semitischen Sprachen an jeder Stelle im Wort stehen, also nicht nur am Anfang. In der Umschrift wird Aleph in diesem Buch mit zwei nach links geöffneten Halbkreisen () bezeichnet, Ajin dagegen mit einem nach rechts geöffneten Halbkreis (c).
Die Vokallosigkeit der ägyptischen Schrift überrascht Sie vielleicht. Für die Ägypter selbst war sie kein Problem, da sie ja wußten, welche Vokale in das Konsonantengerüst hineingehörten. Auch wir verstehen ja abgekürzte Inserate problemlos:
… Komf. Apptms b. 4 Pers. 35.- od. komf. Fer.-Whg. b. 8 Pers. 45.-, Zim. m. Frst.15.-,Ztrhzg …
Interessant an solchen Abkürzungen ist, daß sie sich überwiegend auf das Konsonantengerüst verlassen: Whg = Wohnung, Ztrhzg = Zentralheizung. (Achten Sie einmal unter diesem Aspekt auf die Abkürzungen, die die Deutsche Bahn auf ihren Personen- und Güterwagen anbringt!)
Wenn die Ägypter aber Wörter aus fremden Sprachen schreiben mußten, deren Vokale nur die Sprachkundigen kannten, bedienten sie sich besonderer Gruppierungen von Zeichen in einer Art Silbenschrift, der sogenannten syllabischen Schrift.
Wenn in diesem Buch auf eine bestimmte Hieroglyphe Bezug genommen wird, so wird in Klammern hinzugefügt, wo diese in der Zeichenliste der ägyptischen Grammatik von Alan H. Gardiner steht. Diese Zeichenliste ist bequem im Internet zugänglich:
<http://de.wikipedia.org/wiki/Gardiner-Liste>.9
Hier noch eine Zusammenstellung der Sonderzeichen in den Umschriften, die Ihnen vermutlich nicht bekannt sind:
| = | Aleph (schwacher Stimmansatz) | |
| ḥ | = | etwa wie ch in „ach“ |
| ḫ | = | etwa wie ch in „ich“ |
| ṭ | = | emphatisches (besonders betontes) t |
| c | = | Ajin (starker Stimmansatz) |
| Ṣ | = | emphatisches s |
| Š | = | wie deutsches sch |
| ḏ | = | wie j in „journal“ |
| = | Hinweis auf einen unbetonten Vokal, dessen Qualität unbekannt ist. |