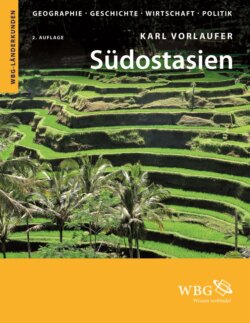Читать книгу Südostasien - Karl Vorlaufer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Entkolonialisierung, Kriege und Neuorganisation nach 1945
ОглавлениеIm Zweiten Weltkrieg konnte Japan fast das gesamte SOA besetzen. Nach der Niederlage Japans widersetzten sich viele Völker SOAs einer Rückkehr der alten Kolonialmächte, die jedoch auf ihre Besitzungen beharrten: Die Folge war eine Kette von Kriegen über mehr als 30 Jahre.
Indonesien
Schon 1945 deklarierte Indonesien seine Unabhängigkeit, die die Niederlande erst 1949 – nach langen Kämpfen – anerkannten. Doch insbesondere die überwiegend christlichen und zahlreich in der Kolonialarmee kämpfenden Südmolukker der Inseln Ceram, Ambon und Buru widersetzten sich der Integration in ein unabhängiges Indonesien und riefen die Republik S-Molukken aus, die 1950 von Indonesien militärisch besiegt und besetzt wurde (Abb. 6). Damit setzten erstmals große Flüchtlingsbewegungen ein, die SOA bis heute weithin prägen. Die Niederlande akzeptierten die Aufnahme von 125.000 ehemaligen Kolonialsoldaten und ihren Angehörigen. Ihre Nachkommen stellen heute eine eigenständige Minorität im ehemaligen Mutterland, die noch in den 1970er-Jahren durch Terrorakte die Unabhängigkeit der S-Molukken erreichen wollten. Auf Ambon gibt es bis heute eine starke separatistische Bewegung, die sich mit religiösen Gegensätzen verquickt und bis in die Gegenwart zu blutigen Auseinandersetzungen und großen innerstaatlichen Fluchtbewegungen führt. Zudem gefährdet(e) der Separatismus in Aceh auf Sumatra (von 1957 bis 2007) und in Papua die Einheit Indonesiens. In den ersten Jahren nach Erlangung der Unabhängigkeit strebte das Land den Aufbau einer parlamentarischen Demokratie an, die jedoch durch den ersten Staatspräsidenten Sukarno 1957 von einer „gelenkten Demokratie“ mit autoritären Zügen abgelöst wurde, u.a. mit dem Ziel, die Einheit des Landes zu sichern. Sukarno wollte so die drei wesentlichen, die Existenz des Staates gefährdenden Kräfte – die Armee, den radikalen Islam und den wachsenden Einfluss des Kommunismus – befrieden oder neutralisieren. Diese autoritäre Politik wurde von Sukarnos Nachfolger, Suharto (1967 – 1998) unter dem Schlagwort „Neue Ordnung“ intensiviert. Erst 1999 wurde das extrem korrupte Suharto-Regime infolge der asiatischen Finanzkrise 1997/98 abgelöst und die parlamentarische Demokratie wiederbelebt. Als eine der ersten Maßnahmen der Reform-Politik (Reformasi) wurde die 1976 widerrechtlich besetzte und als Provinz dem Staat eingegliederte portugiesische Kolonie Osttimor nach blutigen Kämpfen in die Unabhängigkeit entlassen. Unter Suharto wurde aus Furcht vor dem Einfluss der VR China eine harte antikommunistische Politik verfolgt. Die mehrere Millionen ethnischen Chinesen Indonesiens wurden in einer hysterisch aufgeladenen öffentlichen Stimmung als „Fünfte Kolonne“ Chinas stigmatisiert. Dies gipfelte in blutigen Progromen gegen die schon von jeher mit Argwohn betrachtete Minorität. Mehrere Millionen Chinesen sollen den Pogromen zum Opfer gefallen sein. Zahlreiche antichinesische Gesetze wurden erlassen (u.a. ein Verbot chinesischsprachiger Schulen, der Zwang zur Übernahme indonesisch klingender Namen); die mitgliederstarke Kommunistische Partei wurde verboten. Der von Suharto unterstützte Kampf islamischer Gruppen gegen die „gottlosen“ Kommunisten begünstigte den Aufstieg eines radikalen Islamismus. Die Mehrheit der indonesischen Muslime ist zwar einer gemäßigten Form des Islam verbunden, die radikale Variante gefährdet jedoch den Staat und war u.a. für Terroranschläge gegen Touristen mit mehr als 200 Toten in Bali 2002 verantwortlich.
| Abb. 6 | Südostasien nach 1945
Unter Suharto wurde die letzte niederländische Kolonie, das westliche Neuguinea, nach fragwürdigem Referendum als Irian Jaya dem Staat 1969 eingegliedert – die Papua-Völker streben bis heute die Unabhängigkeit an.
Wirtschaftlich verfolgte Suharto eine kapitalistische Politik, durch die über viele Jahre ein rasantes Wirtschaftswachstum erreicht wurde, mit der aber eine Verschärfung sozialer Disparitäten und eine exzessive Ausbeutung natürlicher Ressourcen (Wälder) verbunden war – und ist.
Vietnam, Laos und Kambodscha
Von größter, auch weltpolitischer Bedeutung war die Entkolonialisierung Vietnams, das die Franzosen 1945 wieder in Besitz nehmen wollten. In Nordvietnam wurde die national-kommunistische Vietminh zur dominanten Kraft des Unabhängigkeitskampfes. Nach verlustreichen Kämpfen musste sich Frankreich 1954 aus Vietnam zurückziehen. Mit Unterstützung Chinas etablierte sich das kommunistische Nordvietnam unter Führung Ho Chi Minhs;im S entstand – gestützt durch die USA – ein westlich orientiertes Südvietnam. Nach dem Genfer Friedensabkommen verlief die Grenze parallel zum 18. nördlichen Breitengrad; nach den vorgesehenen Wahlen sollte das Land wiedervereinigt werden. Südvietnam und die USA verhinderten diese Wahlen aus Furcht vor einer kommunistischen Machtübernahme auch im S. 1965 entschloss sich die US-Regierung zur Entsendung von Truppen zur Unterstützung des gefährdeten westlich orientierten Regimes. Militärische Verbände der Nationalen Front zur Befreiung Südvietnams (Akronym: Vietcong) sickerten zunehmend – unterstützt durch den N – u.a. über den auch durch Laos verlaufenden sog. Ho-Chi-Minh-Pfad in den S. Trotz eines starken militärischen Engagements der USA (und ihrer Verbündeten Australien, Neuseeland, Südkorea und Thailand) siegte der Vietcong. 1976 wurden der N und S als „Sozialistische Republik Vietnam“ wiedervereinigt.
Der Vietnamkrieg hatte auch in Laos und Kambodscha verheerende Wirkungen. Um den Nachschub für den Vietcong über diese Länder zu unterbinden, nahmen die USA massive Flächenbombardements vor – noch heute sind die östlichen Grenzregionen von Laos infolge des Bombenkrieges nur eingeschränkt nutzbar.
Der Ost-West-Konflikt griff zudem direkt auf Laos über: 1962 – 1975 tobte hier ein Bürgerkrieg zwischen der schließlich siegreichen, von Vietnam unterstützten kommunistischen Pathet Lao und der von den USA auch militärisch unterstützten Regierung des Königs (Duiker 1996). Die Volksrepublik Laos wurde zu einem Satellitenstaat Vietnams, das sich auch in dieser Hinsicht am „Großen Bruder“ Sowjetunion orientierte.
In Kambodscha kamen im großen Jahr des Umbruchs in Indochina, 1975, die von China unterstützten „Roten Khmer“ unter Pol Pot an die Macht, dessen Regime eine Art „Urkommunismus“ mit größter Brutalität durchsetzen wollte: Der Buddhismus wurde verfolgt, Städte sollten aufgelöst und Kambodscha ein Bauernland ohne soziale Schichtung werden. Zudem wurde die Millionenstadt Phnom Penh durch Aussiedlungen zu einer „Geistersiedlung“, ein bis zwei Millionen Menschen wurden liquidiert oder verloren infolge der bald einsetzenden Hungerkatastrophe ihr Leben.
Nachdem Pol-Pot-Truppen die vietnamesische Grenze mehrmals verletzt und sogar eine Insel Vietnams besetzt hatten, entschloss sich Hanoi 1979 zur Invasion des Nachbarlandes und hielt bis 1990 große Teile besetzt. Die Roten Khmer wurden aus Phnom Penh und den Kernregionen des Landes vertrieben, konnten sich aber in Peripherieräumen noch bis 1998 behaupten. Zur Unterstützung der Roten Khmer begann China 1979 einen im Westen kaum beachteten blutigen Grenzkrieg im N Vietnams, das von der Sowjetunion unterstützt wurde: Der uralte Konflikt zwischen Chinesen und Vietnamesen wurde nochmals virulent.
1993 fanden in Kambodscha unter UN-Aufsicht Wahlen statt; die (konstitutionelle) Monarchie wurde wiederhergestellt.
Im Zuge des Guerillakrieges der Roten Khmer gegen die Vietnamesen wurden weite Landesteile vermint – bis heute sind diese Räume nur bedingt nutzbar, die Zahl der Minenopfer ist hoch. Der Vietnamesisch-Kambodschanische Krieg kann als Fortsetzung des ca. 1000-jährigen Kampfes der Khmer und der Viet um die Vorherrschaft im südlichen Hinterindien gedeutet werden. Noch gegenwärtig erfolgt eine umfangreiche, von den Khmer mit Argwohn betrachtete spontane Landnahme vietnamesischer Siedler im östlichen Kambodscha. Der „heiße“ Krieg zwischen Khmer und Viet spiegelte auch den in den 1970er-Jahren tiefen Riss im kommunistischen Block zwischen der Sowjetunion (Vietnam) und China (Kambodscha) wider. Indochina war in der zweiten Hälfte des 20. Jh. das Schlachtfeld verschiedener ideologischer und politischer Blöcke.
| Abb. 7 | Das Ho-Chi-Minh-Mausoleum in Hanoi
Infolge wachsender wirtschaftlicher Probleme und im Zuge der Perestroika beim Verbündeten Sowjetunion unter M. Gorbatschow entschloss sich Vietnam 1986 zu einer Änderung der Wirtschaftspolitik. Unter dem Begriff Doi Moi („Erneuerung“) setzte eine radikale Reformpolitik ein: marktwirtschaftliche Prinzipien anstelle der Planwirtschaft, Öffnung des Landes für ausländische Investoren, Privatisierung der Wirtschaft, Öffnung für den Tourismus.
Im vietnamesischen Satellitenstaat Laos war nach dem Sieg der Kommunisten nach dem Vorbild der Sowjetunion und Vietnams eine Kollektivierung der Landwirtschaft durchgeführt worden, die jedoch zu massiven Versorgungsproblemen geführt hatte und daher auch infolge des Ausbleibens sowjetischer Hilfslieferungen nach dem Zerfall des „Bruderlandes“ in den 1990er-Jahren rückgängig gemacht wurde. Wie in China und Vietnam herrscht heute in Laos ein „Fassaden-Kommunismus“: Die Partei bestimmt die Politik, die Wirtschaft wird vom Markt geprägt (Stuart-Fox 1997).
Malaysia
Wesentlich weniger turbulent als im östlichen Hinterindien, aber nicht ohne Krisen, verlief die Entwicklung im westlichen Hinterindien. Die Sultanate (West-)Malaysias und die Straits Settlements (vgl. Abb. 5) ohne Singapur erhielten 1946 als Malaiische Union eine eingeschränkte,1948/57 als Bundesstaat Malaya die volle Unabhängigkeit. 1963 wurde unter Einschluss Singapurs, Sarawaks und Britisch-Nordborneos (jetzt Sabah) Malaysia etabliert.
Die Innenpolitik Malaysias ist seit Langem vom Gegensatz zwischen ethnischen Chinesen und heimischen Malaien gekennzeichnet, der 1964 in blutigen Aufständen eskalierte und 1965 das mehrheitlich von Chinesen bewohnte Singapur zum Austritt aus dem Bundesstaat veranlasste. Von 1967 bis 1989 führte die Kommunistische Partei einen den Staat zeitweise gefährdenden Guerillakrieg, weshalb Malaysia schon von 1948 bis 1969 unter Kriegsrecht stand. Zur Niederschlagung des Aufstandes durch Briten und Australier wurden viele Tausend Menschen in Emergency-Dörfer umgesiedelt, um sie besser beschützen zu können, aber auch um den Kommunisten die ländliche Basis zu entziehen. Seit den 1970er-Jahren verfolgt Malaysia einen streng marktwirtschaftlichen Kurs als Grundlage eines fast beispiellosen Wirtschaftsaufstiegs.
Thailand
Auch im NO Thailands führten Kommunisten über viele Jahre einen letztlich erfolglosen Guerillakrieg. Nachdem 1932 die absolute in eine konstitutionelle Monarchie umgewandelt worden war, wurde Thailand bis 1973 von Militärs regiert. Die „Demokratische Revolution“ 1973 leitete zwar eine demokratische Periode ein, die jedoch mehrmals von Militärregierungen unterbrochen wurde (1976,1991 – 1992, 2006). Das rasante Wirtschaftswachstum in dem kapitalistisch ausgerichteten Thailand wurde durch die instabile innenpolitische Lage nicht nachhaltig gebremst – erst die große asiatische Finanzkrise 1997/98 hat zu einem kurzen wirtschaftlichen Einbruch geführt. Stabilisierender Faktor in der politisch unruhigen „Demokratie“-Phase war und ist die unangetastete Autorität des thailändischen Königs.
| Abb. 8 | Die Exporte der ASEAN-Staaten in ASEAN-Länder und in Länder außerhalb der ASEAN 1996 und 2010
Burma
Scheinbar noch weniger turbulent verlief die Entwicklung Burmas nach der Unabhängigkeit 1948. Nach einer demokratischen Phase putschte sich 1962 eine Militärjunta an die Macht, die bis heute diktatorisch regiert. Ein spezifisches „sozialistisches“ Programm trieb den 1989 in Myanmar umbenannten Ein-Parteien-Staat in die außenpolitische Isolation und den wirtschaftlichen Niedergang. Größere Aufstände 1988 und 2007 wurden niedergeschlagen; seit Langem führt das Militär einen radikalen Kampf gegen separatistische Bewegungen ethnischer Minoritäten (s. Kap. „Die Bevölkerung Die ethnolinguistische Vielfalt/Ethnische Vielfalt und Bürgerkrieg: Das Beispiel Burma“, S. 57). 2010 setzte eine allmähliche Demokratisierung ein, die im November 2010 zur Aufhebung des 15jährigen Hausarrestes der Oppositionsführerin und Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi führte. Im April 2012 erfolgte eine Nachwahl, in der die Politikerin einen Parlamentssitz errang.
Philippinen
Die von den USA 1946 in die Unabhängigkeit entlassenen Philippinen (Teilautonomie seit 1935) waren insbesondere unter dem autoritären und korrupten Regime (1965 – 1986) von F. Marcos ein treuer Verbündeter der USA. Der Archipel wurde zu einem „US-Flugzeugträger“ mit großen Militärbasen. Gleichwohl wurde die „Friedhofsruhe“ auch hier durch eine kommunistische Guerilla und den bis heute virulenten Separatismus der islamischen Bevölkerung auf Mindanao und den Suluinseln stets gefährdet. Nach dem gewaltsamen Sturz des Marcos-Regimes beruhigte sich die innenpolitische Lage merklich; das Land ist heute eine relativ stabile Präsidialdemokratie.