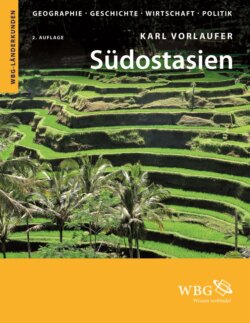Читать книгу Südostasien - Karl Vorlaufer - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Flora, Fauna, Biodiversität
ОглавлениеDank des tropischen Klimas hat SOA einen großen Artenreichtum. Daher wurden von der Conservation International (CI) in SOA vier „Hotspots“ identifiziert, deren große und in der Welt einmalige Biodiversität gefährdet, aber besonders schützenswert ist (Tab. 3 und 4, Abb. 28). Der WWF hat weltweit 232 terrestrische und aquatische „Ökoregionen“ von globaler ökologischer Bedeutung und Einzigartigkeit ausgewiesen, von denen 34 in SOA liegen.
| Tab. II | Marine und Terrestrische Schutzgebiete finden Sie auf der Produktseite unter www.wbgwissenverbindet.de.
Der WWF ordnet SOA zwei großen biogeographischen Zonen zu. Neuguinea und damit die indonesischen Papua-Provinzen fallen in die Australasiatische, das sonstige SOA in die Indo-Malaiische Zone. Die CI gliedert mit dem „Hotspot“ Wallacea einen Raum aus, der durch die Wallace-Linie vom sonstigen SOA getrennt ist und eine spezifische Flora und Fauna aufweist. Wallacea umfasst zwar mit den Kleinen Sundainseln einen größeren Raum als die Australasiatische Zone des WWF. Beide Gliederungen berücksichtigen jedoch, dass durch SOA eine ausgeprägte biogeographische Grenze verläuft, beiderseits derer sich eine jeweils spezifische Artenzusammensetzung herausgebildet hat.
Der Engländer Alfred Wallace hatte auf seinen Reisen Mitte des 19. Jh. beobachtet, dass zwischen Bali und Borneo im W einerseits und Lombok und Sulawesi im O andererseits eine sehr unterschiedliche Fauna verbreitet ist. Im O wies die Fauna eine große Ähnlichkeit mit jener Australiens, im W mit jener des sonstigen SOA auf. Die Wallace-Linie verläuft in Indonesien weitgehend am Ostrand des nur bis zu 200 tiefen Sundaschelfs, östlich des Schelfs liegen Tiefseemeere. Wallace nahm an, dass die Inseln des Sundaschelfs vormals zum asiatischen Festland, die östlich gelegenen Inseln zum Pazifisch-Australischen Kontinent gehörten und sich deshalb jeweils eine spezifische Fauna entwickelt und erhalten hat. Neuere Forschungen haben ergeben, dass in Sulawesi und auf den Kleinen Sundainseln viele der auch auf den westlichen Inseln verbreiteten Arten anzutreffen sind (Whitten et al. 2002). Der deutsche Zoogeograph Max Weber (1852 – 1937) hat eine zweite biogeographische Grenze dort gezogen (vgl. Abb. 28), wo die Arten sich zu je 50 % aus dem asiatischen und australischen Raum zusammensetzen. Die Lydekker-Linie folgt demgegenüber dem Westrand des Sahulschelfs – hier ist die sich westlich anschließende Tiefsee eine Barriere für die Ausbreitung auch der Flora. Der südostasiatische Raum östlich der Weber-Linie, d.h. ein Übergangsraum zwischen der asiatischen und australischen biogeographischen Zone, wird als Wallacea bezeichnet; sie wurde von der CI als eigener „Hotspot“ ausgewiesen. Sulawesi nimmt eine Zwischenposition ein. In den unteren Höhenstufen weist die Insel eine größere floristische Affinität zu Neuguinea, ab ca. 1000 m eine größere Ähnlichkeit mit Borneo auf.
| Abb. 28 | Die Ökoregionen des WWF und die „Hotspots“ der Conservation International in Südostasien
Die „Hotspots“ werden als Habitate definiert, die eine große Vielfalt auch an endemischen, sonst nirgendwo vorkommenden Arten aufweisen, hoch gefährdet sind und mindestens bereits 70 % ihres Bestandes verloren haben. Diese Kriterien deuten zwei Aspekte und Probleme an:
◼ SOA ist einmal hinsichtlich seiner terrestrischen und aquatischen Flora und Fauna weltweit die Region mit der größten Vielfalt endemischer Arten (vgl. Tab. 4),
◼ zum anderen sind die Lebensräume fast aller Arten extrem bedroht: Hoher Bevölkerungsdruck, eine in den meisten Ländern boomende Wirtschaft mit dramatisch steigenden Landansprüchen und insbesondere der legale und illegale Holzeinschlag mit seinen katastrophalen Auswirkungen auf Waldvernichtung und -degradation und damit auch auf das (Welt-)Klima sind die wichtigsten Zerstörungskräfte der Lebensräume vieler Arten.
Die Wälder SOAs – Verbreitung, ökologische Bedeutung, Nutzung
Monsun- und immergrüne Regenwälder
Im Unterschied zum immergrünen Regenwald ist der im Lee der Monsune gelegene trockene Monsunwald viel artenärmer; er weist einen lichten Bestand und niedrigeren Wuchs der Bäume (selten über 15 m hoch) sowie einen schütteren Grasbewuchs auf. Im trockenen Monsunwald dominieren Dipterocarpaceen mit jedoch viel weniger Arten als im immerfeuchten Regenwald. Flächenhaft tretendaneben noch Bambuswälder auf, die Baumaterial für den Binnenmarkt liefern.
| Tab. III | Die Wälder nesiens finden Sie auf der Produktseite unter www.wbg-wissenverbindet.de.
| Abb. 29 | Waldformationen und Agrarnutzung in sunasien. Das Beispiel Thailand (um 1980)
An den regenreicheren Luvseiten stockt der feuchte Monsunwald mit einer etwas anderen Flora. Während des Sommermonsuns erscheint er fast ebenso üppig wie der immergrüne Regenwald. Die hier bis zu 30 m hohen Bäume sind fast alle laubabwerfende Arten, während der Unterwuchs (hoher Anteil von Bambus) immergrün ist. Wirtschaftlich am wichtigsten ist der Teakbaum (Tectona grandis), der schon seit Jahrhunderten eingeschlagen wird. In den 1960er- und 1970er- Jahren war der Einschlag in Thailand so massiv, dass die Bestände weitgehend vernichtet waren und die Regierung ein Einschlagverbot erließ. In nur einer Dekade, von 1972 bis 1982 hatte die Waldfläche Thailands um knapp 30 % abgenommen, der Rückgang betrug in den trockenen und feuchten Monsunwäldern der NOund der Zentralregion sogar 55,8 % bzw. 48,9 %. Der immer noch große Teakbedarf Thailands für den Binnen- und Exportmarkt wird z.T. durch illegale Lieferungen aus Burma und Laos, zunehmend auch aus heimischen „Plantagen“ gedeckt.
Brandrodungsfeldbau, legaler und illegaler Holzeinschlag, Feuerholzentnahme, Holzkohlenproduktion und Waldweidewirtschaft haben die Monsunwälder stark degradiert. Abbildung 29 veranschaulicht beispielhaft für Monsunasien und für die nördlichen immerfeuchten Tropen die Verbreitung der Wälder sowie der agrarischen Nutzung in Thailand. Hier löst oberhalb von ca. 700 m Kiefernwald die laubabwerfenden Monsunwälder ab; in diesen Bergnadelwäldern kommen auch verschiedene Eichen- und Kastanienarten vor. Ganz Thailand steht zwar unter dem Regime des Monsuns (Abb. 29) und somit tritt neben der Regen- auch eine Trockenzeit auf, gleichwohl ist auch der immergrüne Regenwald in weiten Landesteilen, und zwar infolge höherer Niederschläge vornehmlich an den Luvseiten der Bergländer verbreitet: auf der Malakkahalbinsel (und sich bis nach Malaysia erstreckend), in Nordthailand, an der Westflanke des Khorat-Plateaus und im südöstlichen Grenzraum zu Kambodscha. In diesen immergrünen Regenwäldern wurden einige der größten, frühesten und für den (v.a. Binnen-)Tourismus attraktiven Nationalparks ausgewiesen, wie z.B. 1962 der Khao Yai N. P. (2168 km²).
Sowohl in Monsun- als auch in immergrünen Regenwäldern liegen oft ausgedehnte, wohl anthropogen bedingte Grasländer, z.B. in Thailand die sog. Cogonal-, in Indonesien die Imperata-Savannen. Eine zu oft und kurzfristig wiederholte Brandrodung kann eine Zurückdrängung von Gehölzen zugunsten von Gräsern bewirken. In SOA und namentlich in Indonesien ist die häufigste Grasart Imperata cyclindrica (indonesisch: Alang Alang), die sich durch unterirdische, feuerresistente Rhizome ausbreitet. Überzieht dieses Gras wie ein Teppich die Rodungsinseln, ist eine natürliche Wiederbewaldung kaum noch möglich. Wegen der mühseligen Bearbeitung und der geringen Futterqualität werden diese Grasflächen traditionell für Ackerbau und Weidezwecke kaum genutzt (Scholz 1998). Auch um den Druck zunehmender Brandrodung auf die Wälder zu verringern und die Agrarproduktion auszuweiten, werden diese Grasflächen über Tiefpflügen und nachfolgenden Bewuchs mit schnellwachsenden Leguminosen agrarisch nutzbar.
Waldformationen in den inneren Tropen: Beispiel Sumatra
Sumatra ist ein typisches Beispiel für die Vielfalt und Verbreitungsmuster der Waldformationen in den inneren Tropen (Abb. 30 und 31). Ausgehend von der Ostküste kann generalisierend eine Abfolge folgender Formationen identifiziert werden: Mangroven-, Brackwassersumpf-, Süßwassersumpf-, Torfmoor-, immer- oder halbimmergrüne Tiefland- und Bergwälder sowie Pinienwälder. Eisenholz- und Heidewälder ordnen sich dieser Abfolge nur bedingt ein, sie bedeck(t)en aber im südlichen bzw. nördlichen Sumatra (Aceh) relativ große Flächen.
Mangrovenwälder
Mangrovenwälder sind die typische Vegetation riesiger Küstenabschnitte aller Länder. Auch sie unterliegen einer starken Entwaldung und Degradation. Sie bilden das produktivste Ökosystem der Erde und haben wichtige ökologische Funktionen. Mangroven behaupten sich in dem Gezeitenbereich zwischen Meer und Land, zwischen Salz- und Süßwasser. Ihre Wurzeln können sich in dem schlammigen Boden verankern und so dem Wechsel von Ebbe und Flut widerstehen. Sie verfügen mit Luftwurzeln über einzigartige Atmungsorgane und können hohe Salzkonzentrationen abbauen. Ihr amphibischer Lebensraum ermöglicht eine große Artenvielfalt. Mangrovenwälder sind die Laichplätze und „Kinderstuben“ für zahlreiche Meeresfischarten; für Muscheln, Garnelen, Krabben, Reptilien und Amphibien sind sie der Lebensraum. In Thailand, Vietnam, Malaysia, Burma (v.a. im Irawadi-Delta) und den Philippinen sowie auf vielen Inseln Indonesiens wurden die Mangroven über weite Küstenabschnitte stark reduziert oder sogar gänzlich beseitigt. Hauptursache hierfür ist die v.a. seit den 1980er-Jahren exzessive Anlage von Brackwasserbecken für die Garnelenund Krabbenzucht (Abb. 32). Exzessiv ausgebeutet wurden und werden Mangroven zur Gewinnung von widerstandsfähigem, fäulnisresistentem Bauholz und von Holzkohle.
In Thailand z.B. wurden ca. 90 % des Mangrovenholzes in Holzkohle umgewandelt, und die Mangrovenwälder Sumatras dienten schon in der Kolonialzeit den Städten Westmalaysias und Singapur der Versorgung mit Holzkohle (Scholz 1998). Auch durch Einpolderungsmaßnahmen zur Gewinnung von Reisanbauflächen oder von Neuland für Siedlungen und Industrien (etwa in Thailand, Singapur, an der Ostküste Westmalaysia) wurden Mangroven beseitigt. In mehr und mehr Ländern wird der ökologische und ökonomische Wert der Mangroven erkannt; weithin stehen sie jetzt, so in Thailand, unter Schutz. Kritischer ist die Lage der Mangrovenwälder in Teilen Indonesiens: Auf Borneo z.B. wurden 1980 ca. 95 % des Bestandes für die Holzindustrie zum Einschlag freigegeben, aber weniger als 1 % in Reservaten geschützt. Auf Bali waren die Mangroven der Südküste fast vollständig beseitigt; hier erfolgt jetzt, wie auch an anderen Küsten SOAs, eine mühsame Aufforstung. Auch die Entwaldung weiter Küstenabschnitte und die damit verbundene große Bodenerosion belastet die Mangroven, die die ins Meer gespülten Sedimentmassen oft nicht mehr tolerieren können (Beispiel Siberut, Abb. 33).
Durch den Tsunami vom 26.12.2004 wurde die Bedeutung intakter Mangroven für den Küstenschutz belegt – dort, wo sie noch vorhanden waren, konnte die Wucht der Flutwelle gebremst werden. Der Zyklon Nargis mit nachfolgender Flutwelle vom Mai 2008 mit ca. 100.000 Toten und ca. 1,5 Mio. Obdachlosen war auch deshalb so verheerend, weil im Irawadi-Delta in Myanmar insbesondere in den letzten Jahren riesige Mangrovenwälder beseitigt wurden. Neben dem hohen ökologischen Wert kommt diesen Wäldern ein großer direkter ökonomischer Wert zu. Bei nachhaltiger Nutzung können Mangroven auch für nachfolgende Generationen hervorragendes Bauholz und Holzkohle liefern, aus ihnen können u.a. Gerbsäure für die Lederindustrie, Kleber, Haaröl, Duftstoffe, Tee-Ersatz und Speiseöl gewonnen werden.
| Abb. 30 | Die natürliche (ursprüngliche) Vegetation Sumatras
| Abb. 31 | Die Landnutzung und -bedeckung auf Sumatra (1999)
| Abb. 32 | Die Nutzung von Mangrovenwäldern für die Garnelenzucht. Beispiel: Don Sak, Thailand
Sumpf- und Torfmoorwälder
Insbesondere auf Sumatra und Borneo (sowie in Papua auf der Insel Neuguinea) liegen mit ausgedehnten Sumpf- und Torfmoorwäldern weitere hoch gefährdete Ökosysteme. Sumpfwälder stocken vornehmlich in den niedrig gelegenen, vom Brackwasser oder Flüssen mit Süßwasser überschwemmten Küstenebenen und Flussauen. Im Innern Borneos bedecken sie in der Makankan-Seenplatte und dem Danau-Sentarum-Feuchtgebiet riesige Areale. Torfmoore liegen nicht in Überschwemmungsebenen, sondern sie werden fast nur vom Regen gespeist und sind daher relativ nährstoffarm. Die hier stockenden Wälder sind deshalb nicht so artenreich wie die anderen Waldformationen. Gleichwohl sind sieder Lebensraum seltener, oft endemischer Pflanzen und markanter Tierarten wie der Orang-Utans und der Nasenaffen. Kommerzielle Interessen bedrohen auch dieses Ökosystem. In Torfmoorwäldern wächst so u.a. Ramin, ein helles Holz, das für Billardstöcke, Möbel und Werkzeughandgriffe begehrt ist und daher stark eingeschlagen wurde. 2001 erließ Indonesien ein Moratorium gegen den Einschlag und Export von Ramin – illegal wird dieses Holz jedoch weiter gefällt und über Sarawak und Sabah exportiert, da Malaysia kein Moratorium erlassen hat. In der Provinz Riau auf Sumatra erfolgt eine großflächige Vernichtung dieser Wälder (und der Moorböden) durch Zellstofffabriken mit katastrophalen globalen Auswirkungen (Freisetzung riesiger CO2-Emissionen; s. Kap. „Der Naturraum: Ressourcen, Risiken, Naturkatastrophen/Flora, Fauna, Biodiversität/Waldvernichtung: Ausmaß und Probleme“, S. 33/S. 39).
| Abb. 33 | Die Auswirkungen des Einschlags und des Schifftransports von Holz auf Korallen und Mangroven. Die vor Sumatra gelegene Insel Siberut als Beispiel
Tieflandregenwald
Tieflandregenwald bedeckt die weitaus größte Fläche und wird am stärksten ausgebeutet. Er wächst mit seiner für ihn typischen Vegetation bis zu einer Höhe von 500 bis 750 m. Er übertrifft an Dichte, Höhe und Biomasse alle anderen Vegetationsformen der Erde, obwohl er auf nährstoffarmen Böden steht. Fast der gesamte Nährstoffhaushalt des Waldes basiert auf seiner eigenen Phytomasse. Totmaterial wird mithilfe von Mykorrhizen schnell wieder der Pflanze zugeführt. Ein mehrschichtiges, überwiegend 30 – 40 m, mit Einzelbäumen bis zu 80 m hohes Kronendach, eine spärliche Krautschicht und die Flachwurzeligkeit sind typisch. Der enorme Artenreichtum dieser Waldformation verdeutlicht sich eindrucksvoll in Borneo. Hier wurden über 15.000 verschiedene Blütenpflanzen, über 3000 Baumarten, davon 287Arten von Flügelfruchtgewächsen (Dipterocarpaceen) erfasst, von denen 155 in Borneo endemisch sind, d.h. nur hier vorkommen (zum Vergleich: In Deutschland gibt es nur 66 Baumarten, davon nur sechs endemische; WWF 2005). Ähnlich artenreich ist die Flora auf anderen westlichen Inseln Indonesiens, wie Sumatra. Im O des Archipels geht diese Artenvielfalt zurück; auf Sulawesi kommen nur noch vier Dipterocarpaceen-Arten vor (Whitemore 1995, MacKinnon et al. 1997). Auch in Westmalaysia sind zahlreiche dieser Arten vertreten.
Dipterocarpaceen-Bäume liefern hervorragendes Edel- und Nutzholz und sind daher für die internationale Holzwirtschaft sehr attraktiv, so u.a. das in Europa begehrte Meranti-Holz (Shorea ieprosula) u.a. für Fensterrahmen.
Bergwald
Dem Tieflandregenwald schließt sich in 1000 – 1700 m Höhe der Bergwald an, bei dem in Abhängigkeit von thermischen und hygrischen Höhenstufen drei Formationen unterschieden werden: der untere Bergwald (je nach Exposition, Relief usw. in 1200 – 2100 m), der Höhenwald (ca. 2100 – 3000 m), der Subalpine Wald (über 3000 m) und schließlich über 4000 m die Alpine Zone. Bedingt v.a. durch den Massenerhebungseffekt verschieben sich die einzelnen Höhenstufen der Vegetation mit zunehmender Höhe des Berges nach oben (Abb. 34). Charakteristische Pflanzen des unteren Bergwalds sind z.B. auf Sumatra Eichen- und Lorbeerarten, des oberen Bergwalds Nadelbäume und Ericaceen. In der subalpinen Stufe weisen die Gewächse des oberen Bergwaldes nur noch Zwergwuchs auf (Whitten et al. 2000).
Waldvernichtung: Ausmaß und Probleme
Die Waldvernichtung in SOA ist eine der großen ökologischen Katastrophen mit globalen Auswirkungen. Die Abbildungen 20 und 21 verdeutlichen den starken Rückgang der Waldfläche durch agrarische Nutzungen beispielhaft für Sumatra, aber auch – so um den Tobasee – durch die Ausdehnung von Alang-Alang-Flächen. Massive Entwaldungen betreffen bis auf Vietnam und die Philippinen alle ASEAN-Staaten. Besonders starke Entwaldungen weisen für die Jahre 2000 – 2010 lndonesien, Myanmar und Kambodscha auf. Gleichwohl ist die Abnahme der Entwaldung in ha pro Jahr in lndonesien und Myanmar zurückgegangen im Vergleich zu den Jahren 1990 – 2000. ln Kambodscha hat sich die Entwaldung von 2000 bis 2010 gegenüber dem vorausgegangenen Jahrzehnt bis 2010 um 145 OOO ha verringert. Die Philippinen erlebten für beide Jahrzehnte eine Zunahme des Waldbestandes von 55.000 ha, Vietnam eine Zunahme von 236.000 ha bzw. 207.000 ha. ln Vietnam konnte zwar der Waldbestand durch massive Aufforstungen beträchtlich ausgeweitet werden, aber hier wurde der ökologisch wertvolle Primärwald deutlich reduziert. Vietnam ist heute das Land mit dem geringsten Anteil an Primärwald. (1 % der Waldfläche, vgl. lndonesien 50 %, Thailand 35 %.) (vgl.Tab.5)
| Abb. 34 | Die Höhenstu fen der Vegetation ausgewählter Berge Südostasiens
Die Entwaldung wird durch zahlreiche natürliche und sozioökonomische Faktoren bestimmt. Die im Vergleich mit anderen tropischen Regionen rasante Abholzung der Wälder SOAs wird durch die im Tiefland weit verbreiteten Dipterocarpaceen-Wälder erleichtert, die im Vergleich mit den Tieflandwäldern Afrikas und Südamerikas eine relative Homogenität aufweisen: Auf den Philippinen z.B. entfallen zwischen 60 – 90 % aller Bäume auf sechs Dipterocarpaceen-Arten, die alle wertvolle Nutzhölzer liefern (Kummer 1991). Die hohe Besatzdichte ermöglicht pro Hektar einen hohen Einschlag und so höhere Profite als in den Wäldern Afrikas, wo die Zahl wertvoller Bäume pro Hektar viel geringer ist. Auch deshalb kamen von 1950 bis 1985 etwa 70 %, um 1985 sogar 83 % der auf dem Weltmarkt angebotenen tropischen Hölzer aus SOA. Auch heute ist diese Region der bedeutendste Lieferant von Tropenholz.
| Abb. 35 | Die Entwicklung der Waldbedeckung auf Borneo 1950 – 2005
Entwaldung in Indonesien
Der rasante Prozess kann in seinen Ursachen und Auswirkungen eindrucksvoll am Beispiel Borneo belegt werden (Abb. 35). Die Entwaldung setzt i. d. R. entlang von Verkehrslinien, wie Straßen, aber auch an Flüssen ein, über die die Besiedlung und Ausbeutung der Waldressourcen erfolgt. Auf Borneo bedeckte der Wald um 1950 über 90 % der Inselfläche, Mitte der 1980er-Jahre ca. 75 %, 2005 nur noch knapp 50 %. Von 1985 bis 2005 wurden jährlich etwa 850.000 ha gerodet. Von 2000 bis 2002 gingen pro Jahr ca. 1,3 Mio. ha verloren – dies entspricht 148 ha pro Stunde und 2,5 ha pro Minute! Ähnlich rasant verläuft die Entwaldung in der Provinz Riau auf Sumatra (Uryu et al. 2008) In Indonesien insgesamt ging der Waldbestand von 1950 bis 2000 von 162 auf 80 Mio. ha zurück; der jährliche Rückgang hat sich von ca. 1 Mio. ha in den 1980er-Jahren seit 1996 auf 2 Mio. ha verdoppelt (FWI/GFW 2002, WWF 2005). Auch die Einrichtung von Schutzgebieten ist keine Gewähr für eine Sicherung des Bestandes. So wurden zwar 7 % der Fläche z.B. Borneos als Nationalparks ausgewiesen, jedoch auch hier ist der illegale Holzeinschlag v.a. durch Firmen massiv, die angrenzende Konzessionsgebiete legal ausbeuten dürfen.
Die größte Gefahr ist die Rodung der Wälder für Ölpalmplantagen und Industrieforste. Im malaysischen Teil Borneos, in Sarawak und Sabah, ist diese Umwandlung dramatisch. Auf Borneo vollzieht sich gegenwärtig ein Entwaldungsprozess, dem auf Sumatra und dem festländischen Malaysia bereits riesige Flächen zum Opfer gefallen sind: Hier prägen Ölpalmplantagen in Monokultur weithin die Landschaft. Auf Borneo nahmen die Plantagenflächen von 1998 bis 2003 jährlich um 8 % zu; im indonesischen Teil (Kalimantan) bedeckten sie 2003 bereits ca. 1 Mio. ha. Die gegenwärtig auf Borneo rasante Entwaldung setzte auf Sumatra bereits mit der Entstehung des Plantagengürtels um Medan in holländischer Zeit ein. Schon bis 1996 war ein beträchtlicher Teil der ursprünglichen Waldbedeckung vernichtet und seitdem ist die Entwaldung weiter fortgeschritten, insbesondere durch die auch hier rasante Ausdehnung der Ölpalmplantagen, von Industrieforsten der Zellstoffindustrie sowie durch die staatliche (Transmigrasi) und spontane kleinbetriebliche Agrarkolonisation.
Die Entwaldung Indonesiens wird von einem korrupten politischen System getragen; große Teile der politischen und militärischen Kaste bereichern sich über die Ausbeutung und Vernichtung der natürlichen Ressourcen. Der vormalige Präsident Suharto (1967 – 1998) hat sich, seinen Verwandten und politischen Gefährten riesige Konzessionsgebiete zum Holzeinschlag ohne Verpflichtung zu einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung zugestanden. Circa 16 Mio. ha wurden auf diesem Wege für eine Umwandlung des Primärwaldes in Pflanzungen für schnell wachsende Bäume (Industriekulturen für Papieroder Sperrholzfabriken) und Agrarplantagen (v.a. Ölpalmen) ausgewiesen. Dem illegalen, aber nur selten bestraften Einschlag fielen zudem etwa 10 Mio. ha zum Opfer (FWI/GFW 2002). 75 % der den Konzessionären mit der Auflage einer Wiederaufforstung überlassenen Waldflächen wurden nicht wieder bepflanzt und liegen brach. In den 1980er-Jahren waren ca. 50 % der gesamten Waldfläche Indonesiens an Konzessionäre mit den Recht des „legalen“ Einschlags vergeben (Tab. 6), um 1990 wurden so pro Jahr ca. 700.000 ha Wald vernichtet (Repetto 1990). Im Vergleich zur Waldvernichtung durch Großunternehmen sind die Verluste durch Kleinbauern mit etwa 20 % gering. Gleichwohl: Durch das Transmigrations-Programm wurden große Flächen gerodet. In den letzten Jahren hat sich die illegale Ansiedlung von „Pionierbauern“ entlang der von den Holzkonzessionären geschlagenen Waldschneisen beschleunigt. Die dem Forstministerium offiziell als Wald unterstehenden Flächen sind zu einem großen Teil in der Realität waldlos (Abb. 36, Tab. 7) – auf Sumatra übertreffen sie sogar die noch bewaldeten Areale, und sie umfassen auch gesetzlich geschützte Wälder; große Waldflächen sind zudem als Umwidmungsareale legalisiert.
Etwa 47 Mio. Menschen, d.h. fast jeder fünfte Indonesier, lebten 2003 auf offiziell als Wald ausgewiesenen, aber faktisch waldlosen Flächen. Die verbliebenen Wälder werden zudem stetig degradiert, lichter und – durch die Entnahme wertvoller Hölzer – zunehmend artenärmer. So ging z.B. die Bestockungsdichte pro Hektar bereits von 1990 bis 2000 jährlich um 3,33 m3, von 2000 bis 2005 um 4,61 m3 zurück.
Eigner der Großplantagen setzen oft Waldbrände zur Rodung der Wälder ein. Hierdurch werden auch Flächen vernichtet, die legal nicht mit Plantagen belegt werden dürfen. Begünstigt durch El-Niño-Dürren wurden 1994 5 Mio. ha und 1997/98 ca. 4,6 Mio. ha abgebrannt. Der dadurch entstandene Rauch bedeckte große Teile SOAs; die Luftverschmutzung führte zu großen gesundheitlichen Belastungen; weltweit stiegen die CO2 -Emissionen und trugen zum Treibhauseffekt und globalen Klimawandel bei.
Obwohl die Brandrodung großer Flächen seit Jahren in allen Ländern verboten ist, werden in den Wäldern SOAs in der Trockenzeit immer noch große und zahlreiche Brände gelegt, die weite Landesteile mit Smog überziehen.
Entwaldung in Laos, Kambodscha, Myanmar und Thailand
In Laos, Kambodscha und Myanmar erfolgt der illegale Holzeinschlag und -handel im hohen Maße durch Unternehmen aus Thailand, v.a. nachdem das Königreich seit 1989 erfolgreich den Schutz der eigenen Wälder eingeleitet hat. Die Wälder Myanmars werden aber vornehmlich illegal von Firmen aus China ausgebeutet, insbesondere nachdem die Volksrepublik den Einschlag in ihrer an Myanmar, Laos und Vietnam grenzenden Provinz Yünnan 1998 verboten und Importzölle für Holz aufgehoben hatte.
Die Provinz Riau (Indonesien) – Waldvernichtung und globale Auswirkung
In dieser an der Malakkastraße auf Sumatra gelegenen Provinz vollzog sich seit 1982 eine rasante Rodung von Tiefland- und insbesondere seit 2000 auch der ökologisch besonders wertvollen Moor- und Sumpfwälder (Uryu 2008). Von 1982 bis 2007 sank die Waldbedeckung von 78 % auf nur noch 27 % der Landfläche: Zwischen 2005 und 2006 z.B. wurden im Durchschnitt pro Jahr 286 146 ha entwaldet, d.h. täglich ca. 784 ha und stündlich 33 ha (ca. 65 Fußballfelder!). Erst 2006/07 konnte der Einschlag infolge stärkerer Kontrollen der Legalität der Rodung durch die expansive Zellstoffindustrie etwas gedrosselt werden. Von den Primärwaldflächen 1982 waren 2007 27 % mit Ölpalmplantagen, 24 % mit Industrieforsten der Zellulosefabriken belegt; 17 % waren Öldland, da die entwaldeten Flächen entgegen gesetzlicher Bestimmungen von den Rodungskonzessionären nicht wieder aufgeforstet wurden. Der Rest entfiel auf Siedlungen, Straßen und Betriebsflächen von Kleinbauern, die sich z.T. entlang der Rodungsschneisen irregulär angesiedelt haben.
Eine ökologische Katastrophe ist die zunehmende Trockenlegung und Rodung der vormals riesigen Moor- und Sumpfwälder (ca. 4 Mio. ha). Die Zellulosefabriken erschließen die Moore und Sümpfe durch ein dichtes Netz von Kanälen, die der Trockenlegung und dem Holztransport dienen. Die bis zu 10 m mächtigen Moorböden werden degradiert und verlieren ihre Speicherfähigkeit für CO2. In Riau arbeiten zwei der weltgrößten Zellulosefabriken mit einem riesigen Holzbedarf. Die trockengelegten Flächen werden zwar z.T. mit schnell wachsenden Akazienforsten besetzt, die aber die Zersetzung der Moorböden und damit den Verlust ihrer CO2-Speicherfähigkeit nicht aufhalten können. Die fast stets angelegten riesigen Wald-/Moorbrände beschleunigen diese Entwicklung und insbesondere den dramatischen Anstieg der CO2-Emissionen. Von 1997 bis 2007 wurden ca. 72.000 Brände erfasst; 31 % der Provinzfläche auf Sumatra wurden mindestens einmal, 12 % mehrmals abgebrannt. Nach der Zersetzung der Moorböden und dem häufigen Abbrennen der Wälder zugunsten von Industrieforsten entweichen große CO2-Emissionen – Riau hatte von 1982 bis 2007 im Durchschnitt p. a. höhere CO2-Emissionen als Deutschland. Die Emissionen Riaus der Jahre 1990 – 2007 übertrafen die jährlichen Werte der EU! Die Auswirkungen auf den Klimawandel sind katastrophal: Das Kyoto-Protokoll über die globale CO2-Reduzierung wird nur durch diese eine Provinz zur irrealen Vision.
Neben dem steilen Anstieg der CO2-Emissionen ist die Zerstörung des Lebensraumes vieler hochgefährdeter Arten alarmierend. Von 1982 bis 2007 ging die Zahl der Sumatra-Elefanten um 84 % auf nur noch 210 zurück, die der Sumatra-Tiger sank von 640 auf nur noch 192 Tiere. Infolge der Zerstückelung des noch verbliebenen Waldes werden die Lebensräume der dann oft isolierten Tierpopulationen zudem weiter reduziert: Viele Tiere werden illegal erlegt, z.B. um Ölpalmverlsute durch Elefanten oder das Reißen von Nutztieren durch Tiger zu verhindern. Das Überleben von Sumatra-Tiger und Sumatra-Elefant wird immer unwahrscheinlicher.
Auch in Laos, Myanmar und Kambodscha vollzieht sich mit atemberaubenden Tempo die Entwaldung riesiger Flächen, während in Thailand und den Philippinen diese Zerstörung ihren Höhenpunkt überschritten hat. In Thailand sank die Waldbedeckung von ca. 70 % (1930) auf unter 20 % (2005). Die Waldvernichtung erreichte in den 1960er-Jahren ihren Höhepunkt (Hirsch 1987): Schon 1968 wurde Thailand zum Nettoimporteur von Nutzholz aufgrund nicht mehr ausreichender eigener nutzbarer Wälder zur Deckung des Bedarfs.
| Abb. 36 | Die offiziell als Wald deklarierten Flächen unterschiedlicher Nutzung und deren tatsächliche Waldbedeckung in Indonesien 2005
Thailand wies bis etwa 1980 die rasanteste Entwaldung unter allen Ländern SOAs auf und dies, obwohl hier nicht der Nutzholzeinschlag der wichtigste Faktor war und ist: Das hohe Bevölkerungswachstum insbesondere bei den in den bewaldeten Bergländern siedelnden Hilltribes hat hier zu einem erhöhten Bedarf an Agrarflächen geführt, die vornehmlichüber den Schwendbau gewonnen wurden. Zudem hat die zunehmende Integration der Peripherie in den nationalen Wirtschaftsraum die Waldvernichtung gefördert. Der forcierte Bau von Straßen (auch aus militärischen Gründen zur Sicherung der staatlichen Integrität namentlich in den waldreichen Grenzregionen) hat den Bergvölkern den Absatz von Agrarprodukten ermöglicht. Der marktorientierte Anbau von u.a. Mais, Zuckerrohr, Cassava oder Kenaf, in Gunstlagen von Reis, verlangte große gerodete Waldflächen. Der steigende Kerosin-Preis verstärkte zudem den Verbrauch von Feuerholz. Wie in allen Ländern SOAs war auch in Thailand die Korruption ein wichtiger Faktor der Waldvernichtung. Korrupte Militärs und Politiker sind eng in die internationale „Holzmafia“ eingebunden, sie erlaub(t)en den illegalen Einschlag selbst in Naturschutzgebieten. Um 1980 kamen ca. 55 % des auf dem Markt angebotenen Nutzholzes aus illegalem Einschlag (Myer 1984). Der natürliche Teakwald ging in Thailand von 1954 bis 2000 von 2,4 Mio. auf nur noch 150.000 ha zurück und dies, obwohl seit 1989 ein striktes Einschlagverbot besteht und auch weitgehend beachtet wird. Auch in Laos, Myanmar und Kambodscha wird die Entwaldung durch Korruption ermöglicht. Namentlich Händler aus Thailand beziehen illegal geschlagenes Holz aus Nachbarländern. Unabhängigkeitsbewegungen ethnischer Minderheiten in Myanmar, wie die Karen, sollen ihren Kampf gegen die Zentralregierung so finanzieren.
Eine besonders starke Abnahme verzeichneten die mit Teak besetzten Monsunwälder in Thailand und Myanmar, da die Teakwälder hervorragendes Nutzholz u.a. für die Möbelindustrie liefern. Nachdem Thailand 1989 ein Einschlagverbot erlassen hat, wurden mehr und mehr Teak-„Plantagen“ angelegt (bis 2006: 836.000 ha). Heute liefert dieser forstwirtschaftliche Sektor bereits einen großen Teil tropischer Nutzhölzer, dessen Ausbau aber durch das Fehlen guten Saatgutes erschwert wird. Deshalb konzentrieren sich die Bemühungen aller Forstverwaltungen auf die Anlage von Teakpflanzungen zur Erzeugung hochwertigen Saatguts. Myanmar und Thailand kommt hierbei eine Schlüsselstellung zu, weil hier die ursprüngliche Heimat des Teakbaumes ist und hier daher eine große genetische Vielfalt besteht. In Myanmar wurden um 2005 ca. 1000 ha, in Thailand ca. 650 ha nur für die Saatgutproduktion genutzt. In Myanmar ist der Teakanbau eng in das bereits im 19. Jh. von den Briten eingeführte bäuerliche Agroforst-Sytem Taungya eingebunden. Demnach können Bauern die staatlichen Aufforstungsflächen so lange agrarisch nutzen, wie die Teakbäume noch klein sind – mit der Auflage, dass die Setzlinge von ihnen gepflegt werden.
Entwaldung auf den Philippinen
Auch die Philippinen verzeichneten in den letzten Jahrzehnten riesige Waldverluste. Hier bedeckt die rechtlich als Wald klassifizierte und dem Staat unterstehende Fläche mit 14,766 Mio. ha (davon 10,228 Mio. ha Naturschutzgebiete; 3,273 Mio. ha forstwirtschaftlich nutzbar) 53 % des Landes, faktisch betrug die mit Wald bestandene Fläche jedoch um 2000 mit 5,4 Mio. ha aber nur 18 %. Schon von 1950 bis 1985 wurde die Waldfläche um gut 50 % reduziert. Der Druck auf die noch verbliebenen Waldreste ist jedoch infolge der starken Bevölkerungszunahme und massiver Zuwanderung aus den übervölkerten Tiefländern in die waldreicheren, lange weithin siedlungsarmen Räume (Bergländer, Mindanao) weiter groß. Obwohl auch die Philippinen versuchen, über ein Bündel von Maßnahmen die Entwaldung zu drosseln, wurden zu Beginn des 3. Jahrtausends Jahr für Jahr noch ca. 89.000 ha entwaldet; die Entwaldungsrate betrug jährlich 1,4 % des Waldbestandes (Vergleich: Thailand 0,7 %, Indonesien 1,2 %, Malaysia 1,2 %, Kambodscha 1,7 %). Demgegenüber wurden z.B. 2001 nur 24 847 ha wieder aufgeforstet. Die wirtschaftliche Bedeutung der Forst-/Holzwirtschaft hat so drastisch abgenommen (1975: 1,85 %, 2001: 0,09 % des BIP) (ITTO 2004).
Auswirkungen der Entwaldung auf die Umwelt
Mit den Waldverlusten wurden die Lebensräume vieler Tierarten vernichtet. Borneo ist ein bedrückendes Beispiel. Die Fauna dieser Insel weist eine große Vielfalt oft einzigartiger Arten auf. Von den (bisher bekannten) 214 Säugetierarten sind 44 endemisch: Orang-Utans, Gibbons, Nebelparder, Borneo-Zwergelefanten, Borneo-Nashörner, Malaien-Bären und Nashornvögel sind vom Aussterben bedroht.
Die während des Pleistozäns von Südchina bis nach Java vorkommenden Orang-Utans gibt es heute nur noch mit zwei Arten in relativ kleinen Verbreitungsgebieten. 2004 wurde die Zahl dieser Primaten noch auf ca. 55.000 Köpfe geschätzt, die in zahlreichen Subpopulationen, davon ca. 13.000 in Sabah mit der Unterart Morio, verstreut leben (WWF 2005). Die Zahl der Orang-Utans auf Sumatra (ca. 7500) ist viel geringer. Borneo-Orang-Utans leben bevorzugt in Tiefland-, Süßwassersumpf- und Torfmoorwäldern und damit vornehmlich in Höhen bis zu ca. 500 m. Diese Wälder sind jedoch durch Entwaldung, Degradation, Trockenlegung und Abtorfung der Sümpfe und Moore besonders gefährdet. Von 1992 bis 2002 wurde der Lebensraum dieser Menschenaffen auf Borneo um ca. 40 % reduziert. Interessanterweise können sich die Morio-Primaten in Sabah den eingeschränkteren Lebensbedingungen besser anpassen: Circa 60 % aller Orang-Utans leben hier außerhalb von Schutzgebieten in von der Holzindustrie genutzten Wäldern.
| Abb. 37 | Die massive Entwaldung großer Teile Südostasiens erfolgt auch durch kleinbäuerliche Rodungen, wie hier im Zentralen Bergland von Vietnam.
Eine heute noch größere Verbreitung, nämlich auf dem gesamten Festland SOAs sowie auf Sumatra und Borneo, weist zwar noch der Malaien-Bär auf, der jedoch infolge der Reduzierung seines Lebensraumes auch auf der IUNC-Liste bedrohter Arten steht. Gefährdet sind auch die in Mangroven- und Sumpfwäldern lebenden Nasenaffen, da auch ihr Lebensraum einem hohen Vernichtungsdruck unterliegt.
Als unmittelbar vom Aussterben bedroht werden auf der Roten Liste des IUNC die in Indonesien nur noch in Restpopulationen lebenden Tiger und Nashörner geführt. Von den bis 1930 noch existenten drei Tigerarten (Java-, Bali-, Sumatra-Tiger) dürfte auch die letzte überlebende Spezies, der Sumatra-Tiger, bald ausgerottet sein – bisher haben noch etwa 400 – 500 Tiere in den fünf, jedoch durch illegalen Holzeinschlag gefährdeten Nationalparks Sumatras überlebt. Noch dramatischer sind die Überlebenschancen des am höchsten gefährdeten großen Säugetieres der Erde, des Java-Nashorns, von dem bis 1995 nur noch ca. 55 Exemplare im Ujung Kulon N. P. überlebt hatten. Ähnlich gefährdet sind das Sumatra-Nashorn sowie u.a. der Java-Gibbon (FWI/GFW 2002).
Die Entwaldungsproblematik wird dadurch verschärft, dass die verbliebenen Waldflächen zunehmend durch Verkehrs- und Siedlungsbänder zerschnitten werden und so die verbliebenen Habitate keine ausreichende Größe für genetisch gesunde Populationen mehr haben. So ist z.B. der letzte noch verbliebene größere Lebensraum für Sumatra-Elefanten und -Tiger in der Tesso-Nilo-Landschaft durch stete Verkleinerung und Zerstückelung gefährdet. Hier liegt zwar mit ca. 188.000 ha der größte verbliebene Tieflandwald der Insel (2003), doch die um 1985 noch ca. 0,5 Mio. ha große Waldfläche steht weiter unter dem Druck exzessiver Ausbeutung. Die hier gelegenen zwei weltgrößten Papierund Zellstofffabriken haben einen riesigen Holzbedarf (Glastra 2003). 2005 wurde auf Druck nationaler und internationaler Naturschutzorganisationen (v.a. WWF) ein Teil (42.000 ha) des Waldes zum Nationalpark und Refugium für Elefanten und Tiger erklärt und 2008 auf 86.000 ha erweitert. Zudem wurden in den Park 113.000 ha als vorgelagerte Schutzzone integriert. Eine nachhaltige Sicherung des Waldes ist damit jedoch – wie Erfahrungen mit anderen Schutzgebieten zeigen – noch nicht gewährleistet.
Tierarten sind aber nicht nur durch die Entwaldung gefährdet. Hinzu kommen die Fleisch- und Trophäenwilderei, der illegale Handel mit Tieren oder Tierteilen (z.B. mit Tigerfett, -penissen, -hoden für die Volksmedizin) sowie die Ineffizienz und Korruption der Schutzgebietsverwaltungen.
Mit der Waldvernichtung geht die Zerstörung vieler Ressourcen einher, die seit jeher genutzt werden. In Indonesien z.B. sollen etwa 30 Mio. Menschen Einkommen aus der Nutzung von Wald-Ressourcen erzielen. Hervorzuheben ist der Einschlag von Rattan, einer in Symbiose mit Bäumen lebenden Schlingpflanze. Indonesien dominiert den Welthandel mit dieser von der Möbelindustrie verarbeiteten Pflanze. Wilder, oft von Bauern im Zuerwerb geschlagener, zunehmend aber auch auf „Plantagen“ kultivierter Rattan aus Indonesien deckt etwa 90 % des Weltbedarfs. Harze und Honig sind weitere Waldprodukte, über die in SOA mehrere Millionen Menschen ihr Einkommen aus der Landwirtschaft aufbessern. Viele Regenwaldpflanzen dienen zudem traditionell medizinischen Zwecken und werden zunehmend von der Pharmaindustrie verwendet.
Der monetär kaum zu quantifizierende Nutzen der Wälder für die Umwelt wird immer offensichtlicher. Die tropischen Wälder binden aufgrund ihrer riesigen Biomasse große Kohlenstoffmengen, die jedoch im Zuge der Entwaldung freigesetzt werden und so den globalen Klimawandel beschleunigen. In Indonesien z.B. sank die CO2-Bindung in den Wäldern und Gehölzen von ca. 17,1 Mrd. t (1990) auf ca. 6,7 Mrd. t (2005) (FAO; Assessment 2005).
Korallenriffe und Seegraswiesen
Ein in den Tropen generell und besonders in SOA weit verbreitetes Ökosystem bilden Korallenriffe. Die weltweit artenreichsten Riffe liegen bei den Südphilippinen sowie in Ostindonesien. Sulawesi z.B. ist fast vollständig von Saum- und Barriereriffen sowie Atollen umgeben (Whitten et al. 2002). Die von Polypen aufgebauten Riffe nehmen vom Meerwasser Calciumkarbonat auf und erhöhen durch Kalkabscheidungen den Sockel, auf dem sie sitzen. Das Wachstum des Sockels beträgt höchstens bis zu 1 cm/Jahr. Korallen können nur in Salzwasser mit einer ganzjährigen Mindesttemperatur von 20° C gedeihen. Die Riffe sind Lebensraum für eine artenreiche Fauna. Namentlich die vielen bunten Fische sind eine Attraktion für schnorchelnde und tauchende Touristen. Intakte Korallenriffe sind daher eine wichtige touristische Ressource, so z.B. auf Bali, wo auch Schiffswracks mit Korallen besetzt sind und touristisch vermarktet werden. Den Riffen kommt zudem eine wichtige Funktion für den Küstenschutz zu: An ihnen werden die Wellen gebrochen und verlieren so ihre verheerende Wucht.
Korallenriffe zählen zu den hochgefährdeten Ökosystemen. Gründe für ihre beträchtliche Schädigung sind:
◼ die Entwaldung: Auf vom Wald entblößten Arealen ist die Erosion groß; riesige Mengen an Sedimenten werden ins Meer gespült und belasten hier die Korallen. Insbesondere Riffe in der Nähe von Flussmündungen und von Holzverladepiers vieler Buchten sterben hierdurch oft ab (Abb. 33).
◼ erosionsfördernde Landnutzungen (Straßenbau, Siedlungen usw.).
◼ Kalkabbau: Vielerorts wurde bis weit ins 20. Jh. noch Kalk für die Bauwirtschaft durch den Abbau der Riffe gewonnen.
◼ die Einleitung ungeklärter Abwässer aus Städten, der Industrie oder Hotels vieler Tourismusorte: Eine massive Gefährdung sind u.a. die an weiten Küstenabschnitten in riesigen Mengen im Meer entsorgten Plastiktüten, die sich in den Korallen verfangen und diese absterben lassen.
◼ die vor einigen Jahrzehnten noch weit verbreitete Dynamitfischerei: Sie wird an abgelegenen Küsten immer noch illegal betrieben und führt oft zu einer Vernichtung von Riffen.
◼ Tourismus, v.a. durch das Ankern von Ausflugsbooten auf Riffen oder das Herausbrechen von Korallenstücken als Souvenirs: Infolge einer weithin beachteten Verhaltensänderung sowohl der Touristen als auch der Bootsführer konnten diese negativen Auswirkungen des Tourismus reduziert werden.
Im Rahmen des in fast allen Ländern verfolgten integrierten Küstenschutzes kommt der Sicherung der Riffe eine große Bedeutung zu: Der Tsunami vom 26.12.2004 hat belegt, dass Küsten mit intakten Riffen weniger stark von der Flutwelle betroffen wurden.
Ein wichtiges Element sowohl für den Küstenschutz als auch für die Generierung von Einkommen sind die an vielen Küsten verbreiteten „Seegraswiesen“, die ihren Lebensraum zwischen Land und Korallenriff, in Lagunen und Strandseen haben. Seegraswiesen erreichen eine hohe Biomasse, die selbst jene der Tieflandwälder übertrifft. Epiphytische Algen sind die wesentliche Komponente dieser „Wiesen“. Die geernteten Algen werden von der Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie verarbeitet.