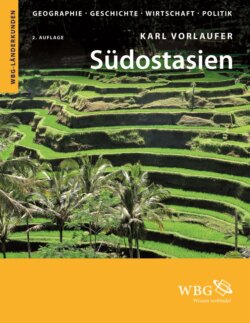Читать книгу Südostasien - Karl Vorlaufer - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Geologie, Relief und Böden
ОглавлениеKurzabriss der Erdgeschichte und Tektonik
Das großräumige Relief SOAs wird durch einen girlandenartigen Verlauf langer, erdgeschichtlich junger Kettengebirge geprägt, die sich von Myanmar in einem riesigen Bogen über die Halbinsel Malakka, die Sundainseln, Celebes (Sulawesi) und Borneo bis zu den Philippinen erstrecken (Abb. 15). Diesem Gebirgsbogen steht ein alter stabiler Landkern gegenüber, gegen den im Zuge der Plattentektonik die Gebirge gepresst und aufgefaltet wurden. Dieses „Indo-Sinische Massiv“ (Uhlig 1975) nimmt u.a. das östliche Thailand, den S von Vietnam und Laos sowie fast das gesamte Kambodscha ein. Im O Thailands liegen weite, leicht gewellte Plateaus, wie das Khorat-Plateau, die auf Sedimentgesteinen (v.a. Sandsteinen, Schiefern) entstanden. Im Zuge der jüngeren Gebirgsbildung wurden Teile des alten Sockels als Schollen v.a. in küstennahen Räumen herausgehoben. In Kambodscha trennen diese Schollen den zentralen, flacheren Lebensraum der Khmer vom Meer. Der größere, südliche Teil des alten Landsockels liegt heute unter dem Meeresspiegel und bildet den Sundaschelf. Insbesondere Borneo sowie die von alluvialen Aufschüttungen bedeckten Tiefebenen O-Sumatras und N-Javas sowie die Kalkplateaus von Madura sitzen diesem Schelf auf. Diese relativ flachen Meere zwischen den Inseln waren für die Wanderung von Menschen, Tieren und Pflanzen geeignet. Erst dort, wo der Sockel durch Tiefseebecken wie die Sulu-, Celebes-, Flores- oder Bandasee unterbrochen wird, liegen die biogeographisch wichtigen Wallace- und Weber-Linien, die jeweils spezifische Lebensräume der Flora und Fauna voneinander trennen (Stone 1994). Die Molukken, Sulawesi, die Kleinen Sundainseln und die Philippinen liegen nicht auf dem Sundaschelf. Der südwestliche Teil Neuguineas und damit die indonesische Papua-Provinz sitzen dem Sahulschelf auf, der zum Kontinentalsockel Australiens zählt.
| Abb. 15 | Tektonik und Vulkanismus in Südostasien
Die Gebirgsketten entstanden in verschiedenen Gebirgsbildungsphasen. Bereits im Paläozoikum, im Erdaltertum, wurden die Gebirge im nördlichen Myanmar, in Nordthailand und Laos aufgefaltet. Dort dominieren weite, von steilwandigen Tälern zerlegte Hochländer, wie v.a. das Shan-Hochland in Myanmar. Hier befinden sich die überwiegend im Tagebau seit Jahrtausenden abgebauten Korund-Lagerstätten (Rubine, Saphire). Diese Schmucksteine finden sich v.a. in alluvialem Kalkstein oder in Dolomitmarmor, der einem Gneis-, Granit- oder Glimmerschiefersockel aufliegt (www.mineralienatlas.de).
Im Mesozoikum (Erdmittelalter), in der jüngeren Kreidezeit (vor ca. 100 – 140 Mio. Jahren) wurde einmal die Zentralkordillere aufgefaltet, die durch Thailand, die Halbinsel Malakka bis zu den indonesischen Inseln Bangka und Belitung und dann in einem ostwärts gerichteten Bogen nach Borneo verläuft. In Laos und Vietnam entstand die erdgeschichtlich etwas ältere Annamkordillere (Donner 1989), die die östliche Begrenzung des thailändischen Khorat-Plateaus bildet. Insbesondere die Zentralkordillere ist bzw. war von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Sie besteht z.T. aus Graniten, dem Muttergestein der längsten Zinn-Lagerstätten-Zone der Erde, die sich von Südchina, Myanmar, Thailand über Malaysia bis zu den Inseln Bangka und Belitung erstreckt (s. Kap. „Bergbau und Energiewirtschaft“, S. 168).
| Abb. 16 | Die Halongbucht in Nordvietnam beeindruckt mit ihren Hunderten von Kegelkarsteilanden und ist als Weltnaturerbe von großer touristischer Attraktivität. Im Vordergrund eine „Touristendschunke“.
In Teilen der mesozoischen Ketten, in denen Kalksedimente abgelagert wurden, entwickelten sich unter dem tropischen Klima die eindrucksvollen (Voll-) Formen des Kegel- und Turmkarstes. Die heute für den Tourismus wichtigen Turm- und Kegelkarstgebiete liegen v.a. in Nordvietnam mit der Halongbucht (Abb. 16) sowie in Südthailand mit der Phangnga- Bucht und der Provinz Krabi (u.a. die Phi-Phi-Inseln, Abb. 14). In Halong und Phangnga ist das Meer zwischen den Kegeln und Türmen eingedrungen und hat so Schwärme von kleinen, oft phantastisch geformten Inseln geschaffen. Karsthöhlen sind hier für den Tourismus relevante Elemente (Vorlaufer 2005b). In den Karsthohlformen werden vielerorts Erze (Zinn, Gold, Brauneisen, Ilmenit) auf sekundären Lagerstätten gefunden. Die Kalk- und Gipsvorkommen dieser Gebirgsketten liefern für die Bauwirtschaft wichtige Rohstoffe, deren Abbau – etwa durch Zementwerke – die Karstkegel und -türme gefährdet: Landnutzungskonflikte zwischen den Zement-/Gipswerken einerseits und dem Naturschutz sowie dem Tourismus andererseits sind u.a. in Halong und in der südthailändischen Provinz Krabi typisch.
Die jüngste Gebirgsfaltung setzte im Tertiär ein und erstreckt sich bis in die erdgeschichtliche Gegenwart, ins Quartär. Die die Grenze Myanmars zu Indien bildenden Arankan- und Patkaigebirge erreichen Höhen von mehr als 2000 m. Der tertiär-quartäre Faltenbogen steht im Zusammenhang mit der Auffaltung des Himalaya und verläuft über die Sundainseln bis nach Neuguinea mit Abzweigungen im O über N-Borneo bzw. Sulawesi zu den Philippinen (und weiter bis Taiwan). Mit dieser Auffaltung entstanden die höchsten Berge SOAs: der vergletscherte Hkakabo Razi (5887 m) im äußersten NW Myanmars und am östlichen Rand SOAs der eine kleine Vergletscherung aufweisende Puncak Jaya (5030 m) im Maokebegebirge in der Provinz Papua. Der heute knapp unterhalb der klimatischen Schneegrenze und nahe dem Äquator gelegene, in der Eiszeit vergletscherte Kinabalu (4101 m) in Sabah (Malaysia) wird für den Tourismus vermarktet.
Durch die Abtragung dieser Gebirge entstanden riesige Sedimentationsbecken mit großen Erdöl- und Erdgaslagerstätten, die sich in einem großen Bogen von der Zentralsenke Myanmars über O-Sumatra, Java bis nach Borneo und in einer Abzweigung über Timor bis nach Neuguinea erstrecken. Diese Lagerstätten sind Grundlage einer bedeutenden Erdölund Erdgasförderung.
Wichtige Flusssysteme
Wichtige morphologische Großlandschaften und von überragender Bedeutung für die agrarische Nutzung und Besiedlung und damit für die kulturelle und staatliche Entwicklung sind die durch die großen Ströme und ihre Nebenflüsse entstandenen Schwemmland- und Aufschüttungsebenen. Das Schwemmland nimmt im festländischen SOA und v.a. auf Sumatra, Borneo und in Papua riesige Flächen ein. Die großen Stromebenen und Talbecken waren und sind die naturräumlich vorgezeichneten Kernräume der ersten territorialen Herrschaftsgebiete und ihrer heutigen Nachfolgerstaaten: Burma am Irawady, Thailand am Chao Phraya (Menam), Kambodscha, Laos und Chochinchina (= Südvietnam) am Mekong und Tonking (= Nordvietnam) am Roten Fluss.
Während die aus gröberem Sedimentmaterial bestehenden und höher gelegenen Aufschüttungsflächen i. d. R. nicht überflutet werden und daher Standorte der Regenfeldkulturen und Bewässerung sind, stehen die größeren Schwemmlandebenen im Rhythmus der monsunalen Niederschläge vier bis sechs Monate bis zu einem Meter unter Wasser und erhalten so stetig neue nährstoffreiche Sedimente. Diese Schwemmlandebenen liegen in riesigen tektonischen Geosynklinalen, die mit den Sedimenten der Ströme aufgefüllt werden. Zwischen den westlichen Randgebirgen Myanmars und der Zentralkordillere liegen die Täler des Irawadi (Länge ca. 2200 km) und des in Tibet entspringenden Salween (ca. 2500 km), zwischen der Zentral- und der Annamkordillere der Chao Phraya und östlich der Annamkordillere der mächtige in China entspringende, die Länder Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam durchfließende oder als Grenzfluss berührende Mekong (4500 km). Auch der kürzere, „nur“ 800 km lange Rote Fluss (Song Hong) hat eine riesige, dicht besiedelte Schwemmlandebene, die Reisschüssel Nordvietnams, gebildet, an dessen Ufer sich aufgrund des hohen agrarischen Potenzials und einer günstigen Verkehrslage schon vor mehr als 1000 Jahren Hanoi entfalten konnte.
Das durch den Chao Phraya und seine Tributäre aufgeschüttete 60 200 km² große Zentrale Tiefland Thailands ist das Kernland des Königreichs, das wichtigste Reisanbaugebiet: Hier liegt die Megastadt Bangkok, hier lebt die Mehrheit der Thais und hier liegt mit der alten Königsstadt Ayutthaya eine Keimzelle des modernen Thailand. Auch die Quellflüsse des Chao Phraya haben große und fruchtbare Schwemmlandebenen aufgeschüttet, die daher ebenfalls seit Langem bevorzugte Siedlungsräume sind: Am Ping entstand in einem großen intramontanen Becken u.a. schon 1292 die Thai-Stadt Chiang Mai, am Yom 1238 in einer Schwemmlandebene die vormalige Hauptstadt Sukhothai (vgl. Abb. 3).
Durch die zwischen- und nacheiszeitliche Transgression erfolgte eine Reliefierung des durch den Chao Phraya aufgeschütteten Tieflands in ein System von mehreren Flussterrassen mit bis zu 5 m hohen Böschungen. Diese Böschungen und die durch das geringe Gefälle entstandenen Dammufer bieten die einzigen Möglichkeiten für Siedlungen in den jährlich für Monate überfluteten Ebenen. Die starke Sedimentation hat auch die Bildung des Deltas ermöglicht, das sich mit 5 – 7 m p. a. ins Meer vorschiebt. Langfristig könnte dadurch die Hafenfunktion Bangkoks beeinträchtigt werden. Die vormaligen Seehäfen Ayutthaya und Logburi verloren schon vor Jahrhunderten durch die Deltabildung ihre Hafen- und Ayutthaya auch seine Hauptstadtfunktion an Bangkok. Noch mächtiger sind die Deltas des Mekong und des Irawadi. Während die Talbecken Altsiedelland sind, konnten große Areale der Deltas dank des Einsatzes moderner Technik erst in neuerer Zeit melioriert und landwirtschaftlich genutzt und besiedelt werden.
In Myanmar ist das über 16.000 km² große Irawadi- Delta wirtschaftlicher Kernraum des Landes. Hier liegt die größte Stadt Myanmars, Yangon (bis 2005 Hauptstadt; bis 1989: Rangun – beide Schreibweisen werden parallel gebraucht); hier lebt auf der Grundlage intensiven Reisanbaus die Mehrheit der Bevölkerung. Der südliche, küstennahe Teil weist noch große Mangrovenwälder auf.
Größtes Delta SOAs ist mit ca. 70.000 km² das Mekong-Delta in Vietnam, das weithin erst in französischer Kolonialzeit melioriert und aufgesiedelt wurde. Hier entstand aber schon im 1. Jh. das mächtige Reich Funan (vgl. Abb. 2).
Auch das dicht besiedelte Delta des Roten Flusses ist Altsiedelland, obwohl es während der Regenzeit durch die von den Bergen kommenden Wassermassen oft von Überflutungen heimgesucht wird, da dann das Meerwasser z.B. durch Taifune in das Delta gepresst wird. Demgegenüber speichert der nur auf den letzten 200 km seines Laufes durch Vietnam fließende Mekong einen Teil seiner während des Monsuns riesigen Wassermassen im Tonle-Sap- See in Kambodscha, der als natürliches Speicherbecken wirkt und große Überflutungsschäden im Delta verhindert.
Tonle Sap und Mekong – eine hydrogeographische Einheit
Eine für den Wasserhaushalt Kambodschas und Südvietnams wichtige Funktion kommt dem Tonle Sap (= Großer See) zu. Mit Beginn der Regenzeit wird der normalerweise ca. 100 km lange, ca. 2000 – 3000 km² große und nur 1–2 m tiefe See zu einem riesigen Gewässer von bis zu 12.000 km² (Vergleich: Bodensee 536 km²) und mit einer Tiefe bis zu 10 m, da der SW-Monsun das Meerwasser im Mündungsbereich des Mekong zu einer Barriere auftürmt. Das in der Regenzeit voluminösere Mekong-Wasser wird so gestaut und bildet die großen Überflutungsbereiche mit dem Tonle Sap als Zentrum. Eine dann reiche Fischfauna ist Lebensgrundlage vieler Fischer. Die auf den überfluteten Feldern und in den Wäldern abgelagerten Sedimente des Mekong und seiner Nebenflüsse sind Basis für die große Fruchtbarkeit dieser Überflutungsräume. Mit der zunehmenden Zahl von Staudämmen am Ober- und Mittellauf sowie den Nebenflüssen des Mekong und der dadurch reduzierten Abflussmenge werden die saisonalen Überflutungen in Kambodscha mit ihren land- und fischereiwirtschaftlich positiven Effekten eingeschränkt und so die Existenzgrundlagen vieler Fischer und Bauern gefährdet. Die in der Greater Mekong Subregion zusammenarbeitenden Regierungen versuchen, eine Balance zwischen den Interessen der Flutkontrolle, Wasserkraftwerke, Schifffahrt, Fischerei und Landwirtschaft zu erreichen.
Dank des Wasserreichtums der großen Ströme und ihrer Tributäre besitzt Hinterindien ein großes hydroenergetisches Potenzial. Namentlich an den gefällestarken Oberläufen der Nebenflüsse wurden zahlreiche Stauseen zur Energiegewinnung, Trinkwasserversorgung, Wasserregulierung und für die Bewässerungswirtschaft angelegt. Insbesondere in Laos entstanden mehrere große Stauseen an Nebenflüssen, die von der Annamkordillere dem Mekong zufließen. Auch in Thailand wurden u.a. auf dem Khorat-Plateau an den rechten Nebenflüssen des Mekong u.a. die Stauseen Ubon Ratana, Lam Pao oder Lam Noi angelegt. An den Quellflüssen des Chao Phraya gibt es weitere: Am Nan liegt der Sirikit-Stausee und am Ping der Bhumipol-Damm. In Myanmar bietet der Salween ein hohes hydroenergetischen Potenzial. Zahlreiche Wasserkraftwerke und Staudämme wurden bereits erbaut, befinden sich im Aufbau oder werden geplant (s.Kap.„Bergbau und Energiewirtschaft“, S. 168).
| Abb. 17 | Der Vulkan Mayon auf Südluzon
Selbst in Kambodscha, das aufgrund seines insgesamt niedrigen Reliefs nur ein verhältnismäßig geringes hydroenergetisches Potenzial aufweist, befinden sich u.a. an Mekong-Nebenflüssen mehrere Kraftwerke im Bau (Stand: 2008).
Vulkanismus: Verbreitung, Risiken, Potenziale
Im Zuge der durch die Plattenbewegung ausgelösten jüngeren Faltung entstanden Seegräben großer Tiefe (Philippinengraben –10 545 m; Javagraben –7450 m) sowie die größte und aktivste Vulkankette der Erde (vgl. Abb. 15; Francis 1984, Simkin et al. 1994). Sie ist das Resultat der Subduktion der Indisch-Australischen Platte im W und der Pazifischen Platte im O unter die Eurasische (Chinesische) Platte. Die Kette verläuft von den nicht mehr tätigen Vulkanen Mittelburmas über Sumatra, Java, die Kleinen Sundainseln und die Molukken bis auf die Philippinen (Stone 1994). Dieser „Feuerbogen“ umfasst über 200 Vulkane, von denen 93 in den letzten 150 Jahren aktiv waren. Die Philippinen haben 22, Indonesien hat 71 aktive Vulkane. Die höchsten Vulkankegel sind ausschließlich Stratovulkane, so z.B. der Kerinci (3805 m) auf Sumatra, der Rinjani (3726 m) auf Lombok und der Semeru (3676 m) auf Java. Der Agung (3142 m) auf Bali nimmt in der hinduistischen Kultur der Balinesen als Sitz der Götter eine herausragende Stellung ein; er speist zudem mit seinen zahlreichen, nach S fließenden Flüssen und Bächen das Bewässerungssystem der Insel, auf dem die Reisbauernkultur Balis basiert. Durch den bisher letzten Ausbruch des Vulkans 1963 wurden große, bis heute weithin vegetationslose Flächen O-Balis mit Lava bedeckt.
Historische Vulkanausbrüche
Vulkanausbrüche sind für die dicht besiedelten Inseln eine extreme Gefahr. Der wohl bekannteste Vulkanausbruch erfolgte 1883 auf der kleinen Insel Krakatau zwischen Sumatra und Java. Riesige Rauch- und Aschewolken wurden bis zu 80 km hochund große Lavablöcke ins Meer geschleudert. Unter dem riesigen Druck des Auswurfmaterials wurde die Insel in eine unterirdische, durch die Eruption entstandene Hohlkammer gepresst – die hierdurch ausgelöste Explosion wurde von weiteren riesigen Ascheund Lavaauswürfen begleitet. Hierdurch entstand eine verheerende Flutwelle, ein Tsunami, durch den auf Java und Sumatra etwa 40.000 Menschen getötet wurden und der siebenmal um den Globus raste, bevor er erlahmte. Weite Teile der Erde verdunkelten sich durch die gigantischen Ascheeruptionen; der Staub verteilte sich auf der gesamten Nordhalbkugel, wodurch die Sonneneinstrahlung erheblich reduziert wurde. Von ursprünglich drei Vulkanen der Insel blieb nur der Rakata-Vulkan übrig; es entstand ein unterseeischer 270 m tiefer und 7 km langer Krater. Seit 1923 erfolgten weitere Vulkanausbrüche, durch die 3 km nördlich der alten Insel Krakatau die neue Vulkaninsel Anak Krakatau entstand. Durch die zahlreichen nachfolgenden Lavaströme (u.a. ein größerer Ausbruch 1953) wurde der Vulkan stetig erhöht; es ist ein typischer Schildvulkan, der sich inzwischen ca. 400 m aus dem Meer erhebt. Indonesien hat den Raum um den Krakatau zum Nationalpark erklärt, der 1991 von der UNESCO zum Welterbe ernannt wurde.
Ein noch gewaltigerer Vulkanausbruch erfolgte 1815 auf der Insel Sumbawa: Der Tambora eruptierte die zehnfache Menge des Krakatau, ca. 90.000 Menschen wurden getötet; der Ascheauswurf löste selbst in Europa infolge eines Kälteeinbruchs eine Hungersnot aus.
Der größte quartäre Vulkanausbruch liegt ca. 75.000 Jahre zurück, ist jedoch noch heute von großer landschafts- und wirtschaftsprägender Bedeutung. Der Toba in N-Sumatra schleuderte mit etwa 2000 km³ die hundertfache Menge an Eruptionsmaterial wie der Krakatau aus, das etwa 20.000 km² bedeckt. Es entstand eine Caldera mit einer Breite von ca. 30 km und einer Länge von 100 km (www.wovo.org) und mit dem Toba-See nach dem Tonle Sap das zweitgrößte Binnengewässer SOAs. Die im See gelegene Insel Samosir wurde mit ca. 600 m mächtigen Tuffablagerungen bedeckt. Heute ist der See eine wichtige Attraktion für den Tourismus, und aus den vulkanischen Aschen sind fruchtbare Böden (Andosole) entstanden, die eine intensive Landwirtschaft und eine dichte Besiedlung um den See und auf Samosir ermöglichen, wenngleich sich hier auch ausgedehnte, für die Landwirtschaft wenig geeignete Gras-(Alang-Alang-)Flächen befinden.
Von ebenfalls großer (v.a. binnen-)touristischer Bedeutung und als Erholungsgebiet für die Bevölkerung Manilas ist der 70 km südlich der Hauptstadt gelegene Taalsee (127 km²), der in einer riesigen Caldera liegt (Oppenheimer 1991). Der durch mehrere Lavaausflüsse entstandene Schildvulkan Taal bildet eine Insel; der wassergefüllte Krater des Vulkans hat einen Durchmesser von 1,3 km. Um den See liegt eine der aktivsten Vulkanzonen der Erde. Seit 1572 wurden 33 Eruptionen registriert. Jüngere kleine Ausbrüche erfolgten 1977 und 1999; massivere Auswirkungen hatten die Eruptionen von 1965 und 1911, als jeweils mehrere Dörfer zerstört und mehrere Tausend Menschen getötet wurden. Der nur 311 m hohe Vulkan kann von Touristen leicht bestiegen werden und wird häufig besucht. Vulkanologen befürchten weitere Ausbrüche, die eine dicht besiedelte Region verwüsten könnten: Fünf Städte liegen am See in der Caldera, 10 Städte auf dem Calderarand, zwei große Kraftwerke sind nur 15 bzw. 17 km entfernt. Wie an allen hochaktiven Vulkanen unterhält der Staat auch am Taal Observatorien und seismische Stationen, die die Bevölkerung rechtzeitig vor einem Ausbruch warnen sollen.
Heutige Vulkanausbrüche
Philippinen
Der 2462 m hohe Stratovulkan Mayon auf S-Luzon besticht durch seine symmetrische Kegelform (Abb. 17) und ist der aktivste Vulkan der Philippinen (Friedrich 1994; Schmincke 2000). Seit 1616 sind 47 Eruptionen nachgewiesen, die letzte erfolgte 1993; 60.000 Menschen mussten evakuiert werden. Die bis heute größte Eruption erfolgte 1814, als mehrere Orte von den Lava- und Ascheauswürfen völlig zerstört wurden: Der heute nur noch aus den erkalteten Lavaströmen herausragende Kirchturm des Ortes Cagsawa ist Sinnbild für die Zerstörungskraft des Vulkans und heute eine touristische Attraktion. Im Umland des Mayon ist der Ort Tiwi für seine vulkanisch bedingten (vormals) heißen Quellen berühmt, die einem bescheidenen Kurtourismus dien(t)en. Heute ist Tiwi Standort geothermischer Kraftwerke, die hier die vulkanisch bedingte hohe Erdwärme nutzen, aber nach ihrer Inbetriebnahme den unterirdischen Wasserdruck so stark reduzierten, dass die heißen Quellen weitgehend versiegten. Ein ebenfalls bescheidener „Kurbetrieb“ basiert auf heißen Sodaquellen des ca. 40 km südlich des Mayon gelegenen Vulkankomplexes des 1560 m hohen Bulusan. Ein gleichnamiger Kratersee ist Ziel insbesondere von Binnentouristen.
Der verheerendste Ausbruch der jüngeren Geschichte der Philippinen erfolgte 1991 durch den Pinatubo (1445 m; Seitz 2000). Dieser als inaktiv angesehene Vulkan wurde nach 611-jähriger Ruhe wieder aktiv und verwüstete weite Landstriche. Fast 1000 Menschen verloren ihr Leben, ca. 2 Mio. waren insgesamt von dem Ausbruch betroffen. Neben Lavaströmen, pyroklastischen Auswürfen, Blockströmen, bis zu 800 Grad heißen Glutwolken, Aschen und Gasen richten v.a. Lahars, eine Mischung aus Aschen, Erde und Regenwasser, große Schäden an. Sie können mit einer Geschwindigkeit von 40 – 60 km/h in 60 km tiefer gelegene, dicht besiedelte Räume rasen. An den Osthängen wurden Tausende von Häusern unter einer meterhohen Laharschicht begraben, ca. 80.000 Menschen flüchteten. Lahars bieten risikobereiten Menschen auch Einkommen. Das Laharmaterial wird ausgesiebt, an die Bauwirtschaft verkauft und zur Herstellung von Hohlblocksteinen verwendet. Am Pinatubo werden zudem Bimssteine für die Textilindustrie gesammelt (Produktion von stonewashed Jeans). Lahars können noch viele Jahre nach der Eruption – etwa nach starken Niederschlägen – unvorhersehbar entstehen (Abb. 18).
| Abb. 18 | Gipfelcaldera, Ablagerung pyroklastischer Ströme, Aschenfallablagerung und Lahar-Ablagerungen der Mt.-Pinatubo-Eruption (12. – 15.6.1991)
Der Ausbruch des Pinatubo
Der Pinatubo-Ausbruch hatte auch große globale Auswirkungen auf das Klima. Über 15 Mio. t Schwefeldioxyd wurden in die Stratosphäre, d.h. in Höhen von 10 – 50 km, geschleudert. In Reaktion mit Wasser entstand hier eine mächtige Aerosolen-Schicht, die zehn- bis hundertmal mächtiger als normal war. Da die Stratosphäre im Unterschied zur Atmosphäre keine Regenwolken aufweist, die die Partikel mit dem Regenfall auswaschen, verbleiben die Aerosole hier viele Jahre, bis schließlich chemische Reaktionen und die atmosphärische Zirkulation eine Reduzierung der Aerosole bewirken. In den zwei Jahren nach dem Ausbruch verbreiteten starke Winde in der Stratosphäre die Aerosole entlang eines breiten Gürtels um den Äquator rund um den Globus. Da Aerosole die Durchlässigkeit des Sonnenlichtes auf die Erde mindern, erfolgte für zwei Jahre eine Abkühlung des durchschnittlichen globalen Klimas um ca. 0,6° C.
Indonesien
Ähnliche Katastrophen löste in den 1990er-Jahren mehrmals der nur ca. 30 km nördlich der 0,5-Mio.-Stadt Yogyakarta auf Java gelegene Merapi (2911 m) aus (Hidajat 2002). Merapi bedeutet generell „Feuerberg“; mit diesem Namen werden in Indonesien mehrere Vulkane belegt, so u.a. in Sumatra. Auch der Merapi Javas, einer der gefährlichsten Vulkane der Erde, ist für seine häufig hoch in den Himmel aufsteigenden Glut- und Rauchwolken bekannt und aufgrund der bis zu 800° C heißen vulkanischen Gaswolken, Asche-, Stein- und Staublawinen gefürchtet, die sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 km/h 15 km talwärts bewegen und die an seinen Hängen siedelnden ca. 70.000 Menschen gefährden. Es wurden zwar einige der besonders häufig von den Lava- und Schlammströmen bedrohten Hangteile für eine Besiedlung gesperrt (Abb. 19), jedoch verführt die hohe Fruchtbarkeit der Böden in Verbindung mit ergiebigen (auch Steigungs-)Niederschlägen die Bevölkerung zur Nutzung auch gefährdeter Areale. In diesen Hangzonen wurden daher „Bunker“ aus Beton errichtet, in die sich die Bevölkerung im Falle eines Ausbruchs vor dem Eruptionsmaterial flüchten kann. Bemühungen des Staates, Menschen aus hoch gefährdeten Bereichen auf andere Inseln umzusiedeln, sind gescheitert: Die Menschen möchten ihre Heimat aufgrund hier hoher Ressourcen nicht verlassen. Neben den günstigen Bedingungen für die Agrarproduktion sind Arbeitsmöglichkeiten in einer wachsenden Freizeit- und Tourismuswirtschaft wichtige Gründe für dieses Verhalten. Die Bevölkerung unterschätzt die Gefahren zudem auch deshalb, weil die Regierung Investoren der Tourismuswirtschaft erlaubt hat, auch in den Sperrzonen Hotels und Freizeitanlagen, wie z.B. einen Golfplatz, anzulegen. Auf den Tuffen des Merapi basiert eine seit Jahrhunderten bedeutende Steinmetz-Wirtschaft, die – obwohl vornehmlich von Muslimen betrieben – v.a. Buddha-Statuen herstellt: Die nahe gelegene buddhistische Tempelanlage Borobudur aus dem 7./8. Jh., seit 1991 Weltkulturerbe der UNESCO und eines der attraktivsten Ziele des Kulturtourismus in SOA, wurde aus Merapi-Vulkaniten errichtet. Borobudur ist aber ebenso wie die in Nähe der Stadt Yogyakarta gelegene, auch als Kulturerbe der UNESCO ausgewiesene hinduistische Tempelanlage Prambanan aus dem 9. Jh. durch Merapi-Ausbrüche (und Erdbeben) bedroht. Die Stadt Yogyakarta ist überwiegend auf Ablagerungen (vornehmlich aus Lahars und pyroklastischen Flüssen) des Vulkans erbaut. Die Gefahr eines Merapi-Ausbruches hängt wie ein Damoklesschwert über der Stadt.
| Abb. 19 | Die Gefahrenzone sowie pyroklastische und Ascheablagerungen am Merapi (Zentraljava)
Eine auch agrargeographisch besondere Stellung nimmt das ca. 30 km nördlich von Yogyakarta und 2565 m hoch gelegene Dieng-Plateau ein, das aus einem großen Vulkankomplex mit zahlreichen Ausbruchszentren, Calderen, Aschekegeln, Lavaströmen, heißen Quellen, Geysiren usw. besteht. Das Plateau ist infolge großer Fruchtbarkeit der Böden und hoher Niederschläge seit Jahrhunderten dicht besiedelt. Aufgrund des gemäßigten Höhenklimas werden hier im intensiven Gartenbau Gemüsearten der höheren Breiten erzeugt, die im gesamten östlichen und zentralen Java vermarktet werden: Karotten, Weiß-, Blumen- und Rotkohl, Radieschen, Lauch, Zwiebeln oder Kartoffeln sind wichtige Erzeugnisse. Die noch vorhandenen Ruinen der ältesten Hindu-Tempel Javas aus dem 8. Jh. sind Zeugnisse eines Altsiedellandes; in den letzten Jahren errichtete geothermische Kraftwerke symbolisieren die Moderne. Das Plateau wird bis in die Gegenwart durch vulkanische Aktivitäten gefährdet. 1979 kam es z.B. zum Ausbruch von CO2-Fumarolen, 149 Menschen erlitten tödliche Vergiftungen; ca. 15.000 Personen mussten evakuiert werden.
Den zerstörerischen Kräften der Vulkane stehen auch – wie die bisherigen Beispiele bereits angedeutet haben – vulkanisch bedingte wirtschaftliche Ressourcen gegenüber. Insbesondere die Landwirtschaft basiert in weiten Teilen SOAs auf den nährstoffreichen Böden vulkanischen Ursprungs. Große Teile Javas, Sumatras, Balis und vieler Inseln der Philippinen verdanken den Vulkanen fruchtbare Böden und damit eine hohe Tragfähigkeit. Viele Inseln weisen eine in anderen Teilen der Tropen kaum erreichte hohe agrarische Bevölkerungsdichte auf. Im Unterschied dazu sind die meisten tropischen Verwitterungsböden wegen der schnellen Erschöpfung der Nährstoffe sehr viel ungünstiger.
Bali – Vulkanismus und Tourismus
Auf der Nachbarinsel, im „touristischen Tropenparadies“ Bali hat der „heilige Berg“ Agung noch 1963 große Verwüstungen angerichtet. Riesige Lava- und Schlammmassen wälzten sich zum S, O und N bis ans Meer und vernichteten die gesamte Vegetation, zahlreiche Dörfer und durch begleitende und nachfolgende Erdbeben (1976) auch Kulturgüter wie die vom letzten Raja (König) von Amlapura/Karagasem errichtete (inzwischen wieder aufgebaute) Wasseranlage Tirtaganga. Über 2000 Menschen wurden getötet. An der dicht besiedelten Südabdachung des Vulkans wurden große Nassreisflächen vernichtet, die bis heute noch nicht wieder genutzt werden können. Noch 2005 wies das gesamte O-Bali nur einen spärlichen Wiederbewuchs auf, obwohl große Aufforstungen vorgenommen wurden (Abb. 102). Das für Touristen auch landschaftlich attraktive Bali wurde wesentlich durch den Vulkanismus geprägt. Nur ca.15 km von der Nordküste entfernt verläuft auf einer O-W-Achse eine Kette von Vulkanen vom Agung im O über u.a. den Abang (2152 m, erloschen), Batur (1717 m, aktiv), Catur (2096 m, erloschen), Lesung (1860 m, erloschen) und den Batukaru (2275 m, erloschen). In geologischer Vergangenheit wurden bei zwei Riesenvulkanen die Kegelspitzen weggesprengt: Es entstanden zwei gigantische Calderen im Batur- und Buyan-Bratan-Massiv mit Durchmessern von jeweils 12 km. Vier Seen liegen in den Einbruchskesseln. In der Batur-Caldera wächst durch weitere vulkanische Aktivitäten der Tochtervulkan Batur, der im 20. Jh. mehrmals ausgebrochen ist: Mehrere Siedlungen mussten aus der Caldera an deren Rand verlegt werden, vom dem aus sich spektakuläre Aussichten in den Einbruchskessel, den Krater des Batur und über den Batursee bieten. Die Calderarand-Orte Penelokan und Kintamani konnten sich deshalb zu Tourismuszentren für Tagesbesucher aus den Badeorten der Südküste entwickeln. Heiße Quellen in der Caldera werden für einen (noch bescheidenen) Bäder- und Kurtourismus genutzt. Innerhalb weniger Jahre hat sich jedoch um den Bratansee ein Zentrum des Massentourismus entfaltet: Hunderte von Souvenirläden, zahlreiche Restaurants, Hotels, eine Golfanlage sowie Ausflugs- und Tretboote auf dem See verdeutlichen – wie in keinem anderen Teil SOAs – die exzessive Vermarktung einer vulkanischen Landschaft.
Erdbeben
Mit dem Zusammenstoß der Indisch-Australischen mit der Eurasischen Platte sind häufige Erdbeben verbunden, die daher im vulkanischen „Feuergürtel“ gehäuft auftreten.
Eine hohe Verwundbarkeit durch Beben weisen die Philippinen auf, da sie zwischen zwei Subduktionszonen und tiefen Meeresgräben liegen. Zudem verläuft hier eine ca. 1200 km lange Hauptstörungslinie mit bis zu knapp 3000 m hohen Faltengebirgen. Durch diese Tektonik werden stetig See- und Erdbeben ausgelöst. Auf dem Archipel werden pro Tag fünf bis sechs leichte Beben registriert; Mindanao, Samar und Leyte verzeichnen pro Jahr ca. 16 wahrnehmbare Beben (Fuchs 2002). Hochgefährdet ist die Megastadt Manila; sie wurde in den letzten 400 Jahren von sechs schweren Beben (Stärken 6 – 7) heimgesucht. 1990 verwüstete ein Beben der Stärke 7,8 die Region um den Höhenkurort Baguio (ca. 250.000 EW).
1976 z.B. erschütterte ein Beben der Stärke 5,6 die Ferieninsel Bali, über 500 Todesopfer wurden registriert, über 300 Menschen wurden verletzt; über 85 500 Häuser, 366 Schulen und 236 Tempel wurden zerstört oder schwer beschädigt (Röll 1979). Im Mai 2006 löste ein Seebeben der Stärke 6,3 vor der Küste O-Javas eine riesige Katastrophe aus: In der Region Yogyakarta verloren ca. 6000 Menschen ihr Leben, über 200.000 Menschen wurden obdachlos; die hindustistische Tempelanlage Prambanan aus dem 9. Jh., ein Weltkulturerbe und eine wichtige touristische Attraktivität, wurde beschädigt.
Diese Katastrophen wurden übertroffen von dem am 26.12.2004 durch ein Seebeben der Stärke 9 mit dem Epizentrum vor der Nordwestküste Sumatras ausgelösten Tsunami, der in den Anrainerstaaten des Indischen Ozeans katastrophale Auswirkungen hatte. Die Flutwelle traf zunächst die dem Epizentrum nahe gelegenen Küsten der indonesischen Provinz Aceh und innerhalb von 20 Minuten die indischen Andamanen und Nikobaren sowie die Westküste Thailands mit den Tourismuszentren Khao Lak, Phuket und die Phi-Phi-Inseln (Vorlaufer 2005c, d). In den nächsten Stunden raste der Tsunami über Sri Lanka, die Malediven, die Küsten Indiens und Bangladeshs bis nach Ostafrika und die Arabische Halbinsel. Mehr als 215.000 Menschen in zwölf Ländern verloren ihr Leben, mehrere Millionen Menschen wurden obdachlos, Städte und zahlreiche Dörfer wurden ausradiert; die Fischereiwirtschaft wurde durch die Zerstörung tausender von Booten und Schiffen sowie durch den Tod vieler Fischer hart getroffen; die Tourismuswirtschaft in Thailand und Sri Lanka erlitt hohe Verluste. Die höchsten Verluste hatte die Provinz Aceh mit u.a. ca. 130.000 Toten: Die Katastrophe hat jedoch dazu geführt, dass der seit Jahrzehnten blutige Bürgerkrieg zwischen der Unabhängigkeitsbewegung und der Zentralregierung Indonesiens 2005 beendet werden konnte. Dieser Tsunami bewirkte zwar eine Katastrophe bisher unbekannten Ausmaßes, jedoch war diese Riesenflutwelle kein singuläres Ereignis. 1977 z.B. löste ein Seebeben der Stärke 8,3 mit dem Epizentrum in Nähe der Insel Sumba (Indonesien) einen Tsunami aus, durch den ca. 100 Menschen getötet und weite Küstenabschnitte auf den Inseln Sumbawa und Lombok verwüstet wurden.
Auch die in einer tektonisch unruhigen Zone liegenden Philippinen werden häufig von Tsunamis getroffen. Besonders bedroht ist Mindanao, da hier zwei Tiefseegräben im rechten Winkel auf die Insel treffen und so Seebeben eine stete Gefährdung darstellen: 1976 verloren hier z.B. fast 4000 Menschen ihr Leben durch einen Tsunami.
| Abb. 20 | Wichtige Bodentypen auf Sumatra
Böden
Verbreitungsmuster und Potenziale
Böden entstehen durch das Zusammenwirken von Ausgangsgestein, Klima und Organismen; sie sind Verwitterungsprodukte der obersten Schicht der Erdrinde. Infolge der Vielfältigkeit dieser Faktorenkombinationen in SOA haben sich oft auf kleinstem Raum zahlreiche Bodentypen entwickelt. Bei großräumiger Betrachtung der Erde nach Bodenzonen (Schultz 1995) werden in SOA (nach der Nomenklatur der FAO-UNESCO) nur zwei Zonen ausgewiesen:
◼ Thailand, Laos, Kambodscha, Malaysia, Sumatra, Borneo und Sulawesi sowie der NO Myanmars liegen in der Acrisol-Zone,
◼ die restlichen Inseln Indonesiens, die Philippinen sowie das westliche Myanmar in der Acrisol-Lixisol-Nitisol-Zone.
Acrisole sind demnach dominant (Beispiel Sumatra: Abb. 20); es sind stark verwitterte, saure, kaolinitische Böden mit niedriger Kationenaustauschkapazität und geringer Basensättigung. Fersallitische Böden, Rot- und Braunlehme sind typisch. In der zweitgenannten Zone herrschen zwar auch Acrisole vor, doch treten daneben – z.B. mit den Lixisolen – auch Böden mit hoher Basensättigung auf.
Da Böden von großer Bedeutung für die Landwirtschaft sind, ist eine differenziertere Betrachtung der Böden und ihrer agrarischen Potenziale geboten. Acrisole sind zwar die typischen Böden der wechselfeuchten Tropen, sie kommen aber auch in den immerfeuchten Tropen SOAs vor. Es handelt sich um Böden mit den Hauptbestandteilen Eisen und Aluminium. Infolge intensiver chemischer Verwitterung und starker Auswaschung durch hohe Niederschläge werden leicht lösbare Mineralien stark abgebaut. Weitere für die Bodenfruchtbarkeit wichtige Faktoren sind kaum ausgebildet: Restminerale, wichtige Langzeitdepots vieler Nährstoffe (u.a. Phosphor, Kalium, Magnesium, Natrium) sind weitgehend ausgewaschen. Die Kationenaustauschkapazität, also die Fähigkeit des Bodens, Nährstoffe zu speichern und schnell an Pflanzen abzugeben, ist gering. Der Kationenaustausch wird durch Tonminerale und den Humus bestimmt. Statt der austauschstarken dreischichtigen sind nur die austauschschwachen zweischichtigen Tonminerale (Kaolinit) vorhanden. Auch Humus, zersetztes Material organischer Substanzen und ein wichtiger Nährstofflieferant und -austauscher, ist infolge des schnellen Abbaus des Ausgangsmaterials in den Tropen viel weniger vorhanden als z.B. in den gemäßigten Breiten. Die Humusschicht ist daher im Allgemeinen trotz großen Anfalls toter Biomasse gering: Bei Beseitigung der lebenden Biomasse, z.B. des Waldes, kann der Humus leicht abgeschwemmt werden, was nur bei sorgfältiger Rodung und einem schnellen Wiederbewuchs mit Baum- und Strauchkulturen (z.B. Kaffee, Kakao, Kautschuk, Gewürznelken, Ölpalmen), weniger mit einjährigen Kulturen (Mais, Hirse, Bohnen, Kürbisse usw.) verhindert werden kann. Bodenökologisch sind daher i. d. R. die auf Strauch- und Baumkulturen basierenden Plantagen günstiger als subsistenzorientierte und auf dem Brandrodungsfeldbau basierende Bauernbetriebe. Durch die Ausbringung organischen Materials (Gründüngung, Kompost, Mulch, Stallmist usw.) kann die Humusauflage verbessert werden.
Acrisol-Lixisol-Nitisol-Böden haben jedoch aufgrund ihres Silicium-Gehalts eine größere Fruchtbarkeit als die sonst in den feuchten Tropen vorherrschenden Ferrasole (Scholz 1998). SOA ist daher im Vergleich etwa zum Amazonas- und Kongo-Becken agrarökologisch begünstigt. Diese relative Gunst stellt sich bei kleinräumiger Betrachtung jedoch differenzierter dar. Auf Sumatra z.B. (vgl. Abb. 20) und auf vielen Inseln Indonesiens nehmen Acrisole große Areale ein, daneben sind jedoch Ferrasole weit verbreitet, die ähnliche negative Merkmale wie Acrisole – Lixisole – Nitisole aufweisen, aber kein Silicium mehr enthalten und deshalb weniger fruchtbar sind: Selbst bei Einsatz von Kunstdünger sind aufgrund des Fehlens dieses Minerals die Agrarerträge geringer, da die Fähigkeit der Speicherung von Nährstoffen eingeschränkt wird.
Dieses erst durch eine kleinräumigere Betrachtung der Verteilung von Bodentypen sichtbare bodenökologische Defizit wird jedoch dadurch ausgeglichen, dass namentlich auf den stark vom Vulkanismus geprägten Inseln Sumatra, Java, Bali oder Lombok und der Philippinen die fruchtbaren Andisole weit verbreitet sind. Andisole entstehen durch die Verwitterung des Eruptionsmaterials und liegen vornehmlich vulkanischen Aschen auf. Es sind dunkle, oft mehrere Meter mächtige Böden. Sie haben eine gut entwickelte Humusschicht, Wasserhaltekapazität und Permeabilität. Zumindest im feuchten Zustand sind Andisole sehr erosionsresistent; Terrassen im Bewässerungsfeldbau benötigen daher keine Stützmauern. Andisole sind basisch bis schwach sauer und besitzen eine hohe Kationenaustauschkapazität, d.h., sie können Nährstoffe in austauschbarer Form speichern und den Pflanzen schnell verfügbar machen. Aufgrund dieser guten chemischen und physikalischen Eigenschaften besitzen Andisole ein hohes agrarisches Potenzial. In den feuchten Tropen insgesamt nehmen Andisole nur 1 – 2 % der Böden ein; auf Java, Bali, Sumatra und auf vielen Inseln der Philippinen bedecken sie jedoch weit größere Flächenanteile: Sie sind die Basis für den intensiven Reisanbau z.B. auf Java und Bali und Grundlage sehr hoher agrarischer Tragfähigkeit mit Bevölkerungsdichten im ländlichen Raum von über 1200 EW/km².
Neben den Andisolen kommen jedoch auch grob texturierte junge Böden (Regosole) vor, die u.a. auf dem frischen vulkanischen Lockermaterial der Vulkanhänge liegen und für den Anbau ungünstig sind. Dies trifft auch auf die noch nicht verwitterten vulkanischen Schlacken zu, die oft große Flächen bedecken (z.B. in der Batur-Caldera auf Bali). Auch die u.a. in Sumatra, Borneo und Papua – vielfach unter Regenwald – verbreiteten rotgelben Podsole sind weniger günstig.
In den wechselfeuchten Tropen werden Niederungen oft von Vertisolen bedeckt. Es sind tonreiche, oft schwere und dunkelgraue Böden, die zwar aufgrund beträchtlicher Mineralreserven eine hohe potenzielle Fruchtbarkeit haben, jedoch nur eine mangelhafte Bodendurchlüftung. Ein weiterer Nachteil ist ihre schwere Bearbeitung. Vertisole sind am Ende einer mehrmonatigen Trockenzeit oft steinhart und für die Feldbestellung kaum aufzubrechen. Mit Einsetzen der Niederschläge quellen und weichen die Böden zwar auf, sind dann aber kaum noch zu begehen oder mit Traktoren zu befahren. Im trockeneren N-Java (Leelage) und auf der Nachbarinsel Madura sind sie weit verbreitet.
Auf Sumatra (vgl. Abb. 20), Borneo und in Papua sind riesige Flächen mit Histosolen, mit Moor- und Torfschichten bedeckt. Histosole umfassen die oft mehrere Meter mächtigen Torfschichten in alluvialen Tiefländern. Das agrarische Potenzial dieser Sümpfe wurde früher optimistisch eingeschätzt; Indonesien sah in ihnen in den 1950er-Jahren die zukünftigen Reisschüsseln. Tiefgründige Histosole können jedoch nur über aufwendige Meliorierung und Torfabtragungen einer intensiveren agrarischen Nutzung zugeführt werden: Heute unterliegen sie jedoch infolge der Abholzung der Sumpfwälder einer dramatischen Zersetzung
Morphologie und Bodennutzung: Das Beispiel Thailand
In Berg- und Hügelländern können sich Böden am Ort ihrer Entstehung nur dort bilden, wo Vegetation sie bindet. Obwohl in dem feuchtheißen Klima der Tropen die chemische Verwitterung die Bodenbildung begünstigt, werden die Böden leicht abgetragen, und zwar insbesondere dort, wo der Mensch die Vegetation zerstört. Namentlich durch die vegetationsvernichtende Brandrodung wird eine Bodenabtragung begünstigt. Auf großen Arealen bedeckt daher in den Berg- und Hügelländern nur eine dünne Bodenkrume das anstehende Gestein, selbst Gesteine ohne jede Bodenbedeckung sind häufig. Ohne Terrassen und andere Maßnahmen ist daher hier eine ertragreiche und nachhaltige Agrarproduktion nicht möglich. Die Böden werden hier durch Niederschlagswasser und Fließgewässer in die Ebenen und intramontanen Becken verfrachtet, deren Böden sich aus einer Vielzahl von Tonen, Sanden und Lehmen zusammensetzen.
In Thailand werden z.B. von 21 identifizierten Bodenarten 16 aus Ton, Sand und Lehm gebildet (Pendleton 1962). Der größte Teil der Bangkok-Ebene z.B. wird von schweren, dunklen und für den Reisanbau geeigneten salzfreien Tonböden bedeckt. In den Küstensäumen befinden sich dagegen weithin salzige Tonböden; in diesem amphibischen Bereich stocken vornehmlich Halophyten und Mangroven. Auch die eingedeichten Gebiete der Landgewinnung, z.B. an der östlich von Bangkok gelegenen Eastern Seaboard, weisen diese salzigen Tonböden auf; sie bieten sich nur für nicht agrarische Nutzungen, z.B. für die Anlage von Garnelenbecken, Salzgärten oder als Industriestandorte an. Dort, wo Sandstein das Ausgangsmaterial ist, zum Beispiel auf dem Khorat-Plateau, entstehen sandige Lehme, die zwar silikatreich, aber ohne nährstoffbindende Tone und so weniger fruchtbar sind: Hier liegt auch deshalb das „Armenhaus“ Thailands.
Die Schwemmlandebenen können durch eine Betrachtung der Abfolge ihrer morphologischen Raumtypen vom Meer zu den Vorbergen des Binnenlandes am Beispiel der Zentralebene Thailands in ihrer Struktur und wirtschaftlichen Bedeutung – idealtypisch – veranschaulicht werden. Es können folgende wesentliche Typen herausgestellt werden:
◼ Strand- und Dünenformationen
◼ aktive und frühere, z.T. versumpfte Watten und Haffe
◼ die Schwemmlandebenen der Flüsse, bestehend aus feinkörnigem rezenten Alluvium
◼ untere und höhere, durch Aufschüttungen gröberen Materials entstandene Alluvialterrassen
Durch Wind- und Wasseraktivitäten haben sich an vielen Küsten Sanddünen gebildet. In Thailand jedoch gibt es keinen zusammenhängenden Dünengürtel, obwohl sich v.a. an der Ostküste der Halbinsel eine insgesamt 450 km lange, jedoch immer wieder unterbrochene Dünenkette befindet. Auch an der Westküste Phukets werden einzelne Abschnitte durch Dünen geprägt. Ihre wenig fruchtbaren Sandböden können agrarisch nur für den Kokosanbau genutzt werden. In Touristenorten wurden diese Dünen, hinter denen häufig Strandseen liegen, oft eingeebnet und überbaut, so z.B. auf Phuket. Alarmiert durch den Tsunami vom 26.12.2004 wird jetzt zunehmend die Bedeutung der Dünen (und ihrer vormals weitgehend vernichteten Strandvegetation) für den Küstenschutz erkannt und der Dünenschutz verstärkt.
Der Zentralebene vorgelagert liegen an der Wachstumsfront des Deltas die aktiven Watten, die noch täglich vom Meer geflutet werden; eine landwirtschaftliche Nutzung ist nicht möglich. Bereits etwas höher gelegene Brackwasserablagerungen erstrecken sich in Thailand bis zu 40 km landeinwärts. Sie sind trotz mäßiger natürlicher Drainage nicht mehr versalzen und werden für den Sumpfreisanbau genutzt. Agrarwirtschaftlich bedeutender sind frühere Watten aus alten Brackwasserablagerungen, die sich nördlich von Bangkok mit einer Breite bis zu 160 km ca. 75 km beiderseits des Chao Phraya flussaufwärts erstrecken. Sie werden jährlich während der Monsunzeit für vier bis sieben Monate bis zu einem Meter vom Flusswasser überflutet. Die schlecht drainierten, aber salzfreien Tonböden eignen sich für den Anbau von Reis.
Der nächste Typ einer Ebene befindet sich weiter landeinwärts am oberen Chao Phraya bzw. an seinen „Quellflüssen“ Ping und Yom. Die Zentralebene weist trotz ihres flachen Reliefs sowohl Erhebungen, wie natürliche Uferwälle oder Schwemmkegel, als auch Senken wie Altwasserarme auf. Dörfer, Obst- und Gartenkulturen werden auf den natürlichen Erhebungen angelegt. In den tiefer gelegenen Senken dominiert der Reisanbau.
Den Flussniederungen folgen die unteren Terrassen, die nicht mehr überflutet werden, da sich die Flüsse tiefer eingeschnitten haben und neue tiefer gelegene Flussauen bilden. Auch hier liegen auf den höher gelegenen Terrassenteilen die Siedlungen mit Hausgärten auf Basis des Regenfeldbaus. Die tiefer gelegenen Terrassenteile werden mit Reis bestellt und mit Regenwasser bewässert.
Diesen Schwemmland- und Aufschüttungsebenen schließen sich die bereits dargelegten pedologischen Bedingungen und Probleme der Berg- und Hügelländer an, deren Böden an nicht zu steilen Hängen und auf Verflachungen mit geringer Abtragung für Trockenfeldkulturen genutzt werden. Fast die Hälfte der Landfläche Thailands besteht aus steilen, stark der Bodenabtragung ausgesetzten Bergen, die agrarisch nicht genutzt werden sollten. Soweit noch vorhanden, sollte der natürliche Waldbewuchs erhalten werden. Geschlossene Wälder produzieren in tropischen Bergländern viel mehr Biomasse als Ackerbau. Ein geschlossener tropischer Waldökotop kann den Nährstoffverlust durch Bodenauswaschungen niedrig halten. Die verschiedenen Stockwerke des Waldes reduzieren die Erosionswirkung starker Niederschläge. Das dichte Wurzelwerk hält nicht nur die Humusschicht fest, sondern vermag durch Verwitterung des Gesteins entstandene oder durch verrottetes Vegetationsmaterial entstehende Mineralien im Boden zu binden. So entsteht ein geschlossener Nährstoffkreislauf, der die (scheinbare) Fruchtbarkeit tropischer Waldböden bedingt.