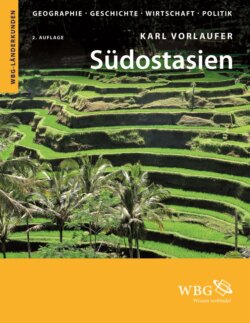Читать книгу Südostasien - Karl Vorlaufer - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Klima: Ausprägung, Potenziale, Risiken
ОглавлениеTropische Klimate
SOA liegt bis auf einen kleinen Teil im äußersten N Myanmars zwischen den Wendekreisen, es fällt nach den Kriterien der Jahreszeitenklimate von Troll Paffen (1964) daher fast vollständig in die Tropenzone, für die sechs Jahreszeitenklimate ausgewiesen werden können (Abb. 21). Nur das nördlichste Nordvietnam liegt in der warmgemäßigten sommerfeuchten Subtropenzone. Das Klima der Tropen ist bei großräumiger Betrachtung hinsichtlich der Temperaturen gleichwohl durch eine große Gleichförmigkeit gekennzeichnet. Die durchschnittlichen monatlichen Temperaturen liegen, nur modifiziert durch die Höhenlage, über alle Monate konstant bei ca. 26 – 28° C. Tag und Nacht sind ganzjährig mit angenähert zwölf Stunden jeweils gleich lang, die Dämmerungsphasen sind kurz. Es herrscht ein Tages- statt ein Jahreszeitenklima, d.h., die Temperaturamplitude eines Tages ist größer als die eines Jahres. Von ca. 26° C am Tage kann die Temperatur nachts um bis zu 10° C fallen. Trotz der riesigen Ausdehnung von den nordhemisphärischen äußeren Tropen über die Äquatorialzone bis zu den äußeren Tropen der Südhemisphäre kann SOA dynamisch-klimatologisch zwar als Einheit gesehen werden (Weischet Endlicher 2000), die großräumige atmosphärische Zirkulation und das Relief bedingen jedoch eine stärkere kleinräumige Differenzierung v.a. hinsichtlich der Niederschläge.
Bis etwa 5° beiderseits des Äquators liegt die immerfeuchte Zone der Tropen mit hohen Niederschlägen und hoher relativer Luftfeuchtigkeit in allen Monaten (Stationen Padang, Manokwari, Singapur, Abb. 22). Die hohen Niederschläge fallen als Zenitalregen; die saisonalen Regenmaxima folgen den höchsten Sonnenständen. Da die Sonne im Jahr zweimal über dem Äquator im Zenit steht, gibt es zwei – allerdings nur schwach ausgebildete – Regenspitzen: im April und im Oktober. Auch in den anderen Monaten fallen – wenngleich reduziert – hohe Niederschläge, da die feuchten Tropen ganzjährig unter dem Einfluss der Innertropischen Konvergenzzone (ITC) liegen. Die mittleren Temperaturen liegen in den Tiefländern konstant bei 26 – 28° C; die durchschnittlichen monatlichen Schwankungen betragen weniger als 3° C. Im Gebirge und an Einzelbergen fallen mit zunehmender Höhe auch in den inneren Tropen die Temperaturen, und bis zu einer Höhe von ca. 1500 m nehmen infolge aufsteigender Luft vielerorts die Niederschläge zu (Steigungs-, Stauregen). Die Höhen zwischen ca. 700 – 2000 m weisen daher hinsichtlich der Temperaturen in der gesamten Tropenzone ein gemäßigtes, sonst in höheren Breiten vorherrschendes Klima auf. Dies ermöglicht den Anbau „europäischer“ Gemüse- und Obstarten (u.a. Kohl, Kartoffeln, Lauch, Karotten, Erdbeeren) sowie – mit steigender Bedeutung infolge wachsender Nachfrage durch eine an „westlichen“ Vorbildern orientierte Mittel- und Oberschicht – von Blumen, die im Tiefland nicht gedeihen. Zudem ergeben sich in dieser Höhenstufe im Zusammenwirken mit der intensiveren Sonneneinstrahlung günstige Bedingungen für den Anbau z.B. von hochwertigem Tee und (Hochland-, Arabica-)Kaffee: Diese Strauchkulturen haben als ursprüngliche Pflanzen der tropischen Bergwälder hier günstige Standortbedingungen. Höhenstufen mit gemäßigten Temperaturen dienten in der Kolonialzeit zudem als Standorte von Höhenkurorten, der Hill Stations (vgl. Temperaturen Manila/Baguio; Singapur/Cameron Highlands, vgl. Abb. 22; s. Kap. „Mittelpunktsiedlungen, Städte und Urbanisierung/Historisch-genetische Phasen der Stadtentwicklung/Stadtentwicklung in der kolonialen Phase“, S. 82/S. 90). Die große bioklimatische Gunst ergibt sich aus dem Fehlen der drückenden Schwüle des Tieflandes und der größeren Temperaturamplitude am Tage: Von 20 – 25° C kann das Thermometer nachts auf bis zu 5° C fallen. Auf relativ kurzer Distanz sind die klimatischen Gegensätze zwischen Tief- und Hochland eklatant.
| Abb. 21 | Jahreszeitenklimate und mittlere jährliche Niederschlagsmenge in Südostasien nach Großräumen
Der größte Teil SOAs wird durch Monsune geprägt. Namentlich für das Festland sind sie klimabestimmend. Keine andere Erdregion wird so nachhaltig durch das Zirkulationssystem der jahreszeitlich wechselnden Monsune beeinflusst. Die Luftdruckverhältnisse werden durch die Verteilung von Land-(Kontinental-) und Wasserflächen sowie durch den wechselnden Sonnenstand bestimmt. In den nördlichen Subtropen liegt die asiatische Landmasse, in den südlichen Subtropen der australische Kontinent. Dazwischen befindet sich SOA mit großen Meeresflächen. Im Nordsommer, im Juli/August, entsteht mit der Nordwanderung des höchsten Sonnenstandes, der ITC, in den asiatischen Subtropen ein Hitzetief, während über Australien hoher Luftdruck herrscht. Im Dezember/Januar, im Südsommer, liegt das Hitzetief über Australien, das kontinentale Kaltlufthoch über Asien. Es besteht somit zwischen den beiden Räumen jahreszeitlich ein großes Druckgefälle, das eine den Äquator querende Ausgleichsströmung auslöst. Im Nordsommer dominiert der S-Monsun infolge des Gegensatzes zwischen dem Druck in der Antizyklone am Nordrand Australiens bis zu den Kleinen Sundainseln einerseits und dem Hitzetief über dem südlichen Asien andererseits. Durch Reibung und die Corioliskraft werden die vom Druckgefälle ausgelösten Luftströmungen von der Gradientenrichtung abgelenkt. Der S-Monsun z.B. stößt als SW-Monsun auf das Festland (Abb. 23). Bei ihrem Weg über das Meer hat die Luftströmung viel Feuchtigkeit aufgenommen, die mit Eintritt in das Hitzetief abregnet.
| Abb. 22 | Klimadiagramme ausgewählter Klimastationen Südostasiens
| Abb. 23 | Die atmosphärische Zirkulation über Südostasien im Nordsommer/Südwinter und im Nordwinter/Südsommer
Im Nordsommer steht das nordhemisphärische SOA daher unter dem Regime des S-Monsuns, es ist Regenzeit. Diese Strömungsverhältnisse kehren sich im Südsommer mit der Verlagerung der ITC zum S um. Nördlich des Äquators herrscht jetzt die Trocken-, südlich die Regenzeit. Das Klima der äußeren Tropen SOAs, die Zone ca. 5° nördlicher und südlicher Breite, wird dementsprechend von winterlichen Trocken- und sommerlichen Regenzeiten bestimmt. Genetisch wird nördlich des Äquators die Strömungsrichtung des SW- bzw. Sommermonsuns von den äquatorialen Westwinden, der NO- bzw. Wintermonsun vom NO-Passat bestimmt. Aufgrund der spezifischen Eigenschaften dieser beiden Windsysteme ist der SW-Monsun regenreich, der NO-Monsun dagegen relativ trocken. Die Inseln von Zentraljava bis Timor stehen im Nordsommer unter dem Einfluss des SO-Passats, der – aus dem trockenen Australien kommend – sehr wenig Regen bringt (Stationen Denpasar, Kupang/Timor, vgl. Abb. 22). Mehrmonatige Trockenzeiten sind typisch. Von Mai bis September kann z.B. auf den Kleinen Sundainseln und im südlichen Sulawesi auf den im Lee gelegenen Inselteilen (z.B. N-Bali) nur eingeschränkt Regenfeldbau betrieben werden. Diese sog. Trockenzeit ist jedoch die beste Zeit für einen Badeurlaub auf Bali. Die Insel hat somit einerseits den Vorteil, dass sie in dieser Zeit einmal für Besucher aus dem dann winterkalten Australien und zum anderen für Touristen aus den gemäßigten nördlichen Breiten attraktiv ist, die die Sommerferien für eine Fernreise nutzen möchten. Andererseits konkurriert Bali auf den Märkten des Nordens dann mit „Sonnenzielen“, die z.B. für Europäer schneller und kostengünstiger erreichbar sind (z.B. der Mittelmeerraum).
Die hygrischen Auswirkungen werden zudem durch das Relief beeinflusst. An den Westhängen der Gebirge, an der Luvseite, sind die Niederschläge wesentlich höher als auf den im Regenschatten, im Lee, gelegenen Ostseiten. Ein Beispiel: An der Küstenkette des bis zu 3000 m hohen Arakan-Gebirges in Myanmar fallen über 5000 mm (Station Akyab, Abb. 22), auf der Ostseite des Gebirges nur 1500 – 2000 mm. In den Längstalfurchen der Gebirge können sogar während des Sommermonsuns ausgesprochene „Trockeninseln“ liegen. So erhält die Stadt Mandalay am Irawadi nur ca. 800 mm Niederschlag; einzelne Räume am mittleren Irawadi sogar nur ca. 500 mm: Hier ist die Dornstrauch-savanne die natürliche Vegetation. Ähnliche „Trockeninseln“ treten abgeschwächt auch am oberen Chao Phraya und Mekong auf. Der Irawadi und der Mekong sind dann aufgrund des Niedrigwassers nur noch bedingt schiffbar. Bei Berücksichtigung der hohen Verdunstung infolge hoher Temperaturen bedeutet dies, dass in diesen intramontanen Trockenräumen Regenfeldbau nur eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich ist. Die Bewässerungswirtschaft ist eine Voraussetzung für die in diesen Räumen entstandenen frühen Staaten (s. Abb. 2 – 4). Anlage und Unterhalt großer Bewässerungssysteme sind nur in straff organisierten Gesellschaften möglich: Die in den Räumen relativer Trockenheit entstandenen frühen Staaten basierten so – in der Terminologie Wittfogels (Wittfogel 1962) – auf hydraulischen Gesellschaften. In den regenreichen Räumen und insbesondere in den feuchten Tropen begünstigen demgegenüber die hohen Niederschläge zwar die Landwirtschaft, doch in den Bergländern sind die hohen Niederschläge mit bis zu 6000 mm an den Luvseiten auch im Tiefland oft so heftig, dass Bergrutsche entstehen und starke Bodenabtragungen auch auf ebenen Flächen eintreten. Die Niederschläge fallen zudem oft als Wolkenbrüche, sodass der Boden die Feuchtigkeit nicht aufnehmen kann. Der schnelle Oberflächenabfluss ist für die Landwirtschaft nicht günstig. Überschwemmungen sind daher – insbesondere an den Unterläufen der Flüsse – häufig. Die für weite Räume typischen Pfahlbauten sind Ausdruck des Bemühens der Menschen, sich vor diesen Fluten zu schützen. Auch regenreichere Stationen erhalten jedoch nicht in jedem Jahr die langjährige durchschnittliche Regenmenge (Beispiel Bangkok, Abb. 24). Diese Variabilität kann dazu führen, dass unerwartete Trockenphasen oder sogar Dürren eintreten.
| Abb. 24 | Aktuelle jährliche Niederschlagssummen in Bangkok, bezogen auf das 55-jährige Jahresmittel (1528 mm) im Beobachtungszeitraum 1951 – 2005
2004 erhielten z.B. weite Räume Thailands so wenig Niederschläge, dass in einigen Provinzen der Wassernotstand ausgerufen werden musste. Viele Stauseen hatten einen so geringen Wasserstand, dass die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung und die Hydroenergieerzeugung eingeschränkt waren. Katastrophal war die 1997 durch das El Niño/Southern Oscillation-Phänomen (ENSO) ausgelöste lang anhaltende Dürre, die weite Teile SOAs und insbesondere die Regenwälder Borneos und Sumatras betraf: Durch Unachtsamkeit der Menschen entstanden in den „trockenen“ Wäldern riesige Waldbrände. Eine gigantische Rauchwolke trieb auf das Festland und verursachte hier u.a. große gesundheitliche Schäden infolge extremer Luftverschmutzung (Sastry 2002). Weltweit stiegen die CO2-Emissionen und trugen zum Treibhauseffekt bei.
Der hygrische Gegensatz zwischen Luv- und Leeseite ist auch für den (v.a. Bade-)Tourismus von großer Bedeutung. Die auf der Westseite der Malaiischen Halbinsel gelegene Ferieninsel Phuket erhält im Nordsommer durch den SW-Monsun hohe Niederschläge (vgl. Abb. 22) und eignet sich dann nicht für den Badetourismus; die Insel Samui im Golf von Thailand in Leelage erhält dann viel weniger Niederschlag und ist deshalb in dieser Zeit touristisch noch attraktiv. Die Ostküstenstadt Surat Thani ist hierfür ein Beispiel. Demgegenüber stößt im Nordwinter der dann herrschende und trockenere NO-Monsun nach seinem Weg über den Golf zunächst auf Samui und erst dann auf die die Halbinsel teilende Zentralkordillere. Obwohl Samui relativ flach ist, regnet ein kleinerer Teil der Feuchtigkeit des Monsuns bereits auf dieser Insel und schließlich fast vollständig an der Ostküste ab, während Phuket – jetzt im Lee der Kordillere gelegen – viel weniger Niederschlag erhält. Die Hauptsaison für Phuket liegt daher im Nordwinter, in einer Zeit großer Nachfrage der Touristen aus den „kalten“ höheren Breiten – etwa aus Europa und Japan – nach Reisezielen mit „schönem“ Wetter. Samui hat demgegenüber den Vorteil, dass es z.B. auch im Nordsommer, der Zeit langer Schulferien in Europa (und relativ niedriger Temperaturen in Australien) noch ein attraktives Reiseziel ist. Zudem erhält Samui auch im Nordwinter durch den dann über die Insel strömenden NO-Monsun vergleichsweise so geringe Niederschläge, dass ein Badeurlaub hier noch möglich ist. Dieser hygrische O-W-Gegensatz prägt auch und noch stärker als in Thailand die südliche Malakkahalbinsel. Im Nordsommer erhält die Westküste Malaysias durch den SW-Monsun starke, die Ostküste viel geringere Niederschläge. Auch hier wirkt die Kordillere als Klimascheide. Für den Tourismus bedeutet dies, dass an der Westküste mit ihren Tourismusinseln Pinang und Langkawi die Hochsaison im Nordwinter, an der Ostküste mit ihren Tourismuszentren wie u.a. Kuantan und die Insel Tioman der Nordsommer die attraktive Reisezeit ist (Stationen Pinang/Penang, Kuantan, vgl. Abb. 22). Volkswirtschaftlich ist dieser für den Tourismus relevante hygrische O-W-Gegensatz insgesamt positiv: Zu keiner Jahreszeit bricht die Nachfrage nach einem Badeurlaub vollständig ein. Andere, vom Klima weniger abhängige, jedoch oft mit einem Badeaufenthalt kombinierte Tourismusarten (z.B. Städte-, Kulturtourismus) werden daher ganzjährig nachgefragt.
Das El Niño/Southern Oscillation-Phänomen (ENSO)
Die für die feuchten Tropen atypischen, in SOA regelmäßig im Abstand von einigen Jahren auftretenden Trockenperioden oder Dürren werden wesentlich durch das ENSO-Phänomen verursacht, mit dem spezifische atmosphärisch-ozeanische Abläufe zwischen der Westküste Südamerikas und dem südostasiatischen Raum verbunden sind. In normalen Jahren weht der SO-Passat in Äquatornähe vom O zum W und treibt kühles Oberflächenwasser in den Westpazifik, wo es sich erwärmt. Über dem warmen Oberflächenwasser vor Indonesien und den Philippinen steigt die Luft auf; es entsteht ein Tiefdruckgebiet mit starken Regenfällen. Die Luftmassen aus dem Tief strömen in Normaljahren durch den Westwind in großer Höhe in das vor Peru liegende stabile Hochdruckgebiet.
Im Zusammenwirken mit der Southern Oscillation, einer episodisch auftretenden Luftdruckschwankung im tropischen Pazifik, bewirkt der im Durchschnitt alle vier Jahre und vornehmlich um die Weihnachtszeit auftretende El Niño (span. Christkind) eine Umkehrung der ansonsten regelmäßigen Feuchtigkeits- und Trockenperioden im pazifischen Raum. Der Luftdruck über SOA und dem westlichen Pazifik erhöht sich, während er im östlichen Pazifik sinkt – der „normale“ Druckgegensatz über dem Pazifik schwächt sich ab, wodurch wiederum eine Schwächung der Passatwinde erfolgt. Der dadurch bedingten Trockenheit in SOA (und Australien) stehen sintflutartige Regenfälle an der Westküste Südamerikas gegenüber, wo jetzt anormal hohe Meeresoberflächen-temperaturen auftreten. Diese jeweils 12 – 22 Monate dauernde Klimaanomalie trifft v.a. Indonesien und die Philippinen, weniger das Festland SOAs (Caviedes 2005).
Auch die Philippinen werden hinsichtlich der Niederschlagsverteilung in einen Westseiten- (I) und einen Ostseitentyp (II) gegliedert. Infolge der quer zu den Hauptwindrichtungen und von N nach S verlaufenden Gebirge erhalten die Westhälften von Luzon, Mindoro, Negros, Palawan und Panay (Station Manila, vgl. Abb. 22) ihre stärksten, sehr hohen Niederschläge durch den SW-Monsun vom Juli bis September. Während des Regimes des NO-Monsuns (Nordwinter) bzw. des Passats erhält der Westseitentyp (I) aufgrund seiner Leelage kaum Niederschläge. Es herrscht Trockenzeit. Der Ostseitentyp (II) – v.a. auf SO-Luzon, Samar, O-Leyte, O-Mindanao – hat demgegenüber keine Trockenzeiten (Station Davao); er ist immerfeucht, da auch während des SW-Monsuns die Leeseite noch hohe Niederschläge erhält.
Die Philippinen sind ein weiteres Beispiel für den großen Einfluss von Exposition und Relief auf die kleinräumige Differenzierung der hygrischen Verhältnisse; die Höhenstufen bewirken zudem eine Differenzierung der Temperaturen.
| Tab. I | Die Auswirkungen von Naturkatastrophen auf Bevölkerung und Wirtschaft finden Sie auf der Produktseite unter www.wbgwissenverbindet.de.
| Abb. 25 | Taifune mit ihren heftigen Niederschlägen verursachen oft große Überflutungen, wie hier in Manila.
Tropische Wirbelstürme
Während die Westküsten Hinterindiens im Nordsommer unter dem Regime des SW-Monsuns stehen, dominiert an den nördlichen Ostküsten der SO Monsun, d.h., die lange Ostküste Vietnams liegt im Luv der Strömung, die hohe Niederschläge bringt: Vietnam hat ein Ostküstenklima (Station Hanoi, vgl. Abb. 22). Die über das Südchinesische Meer strömenden feucht-warmen Luftmassen erwärmen das Wasser auf über 25° C: Dies ist eine Voraussetzung für die Entstehung von Zyklonen und Taifunen. Vietnam wird im Spätsommer häufig von diesen Orkanen heimgesucht. Dies trifft auch auf die Philippinen zu (Abb. 26), die im Vergleich zum sonstigen nordhemisphärischen SOA einige klimatische Besonderheiten aufweisen. Aufgrund seiner Lage inmitten großer warmer Meere wird der nördliche und der zentrale Teil des Archipels von häufigen tropischen Zyklonen berührt. Von Juni – Dezember dauert die Taifun-Saison. Von 1945 bis 2000 haben z.B. 338 Taifune die Philippinen und davon 61 % Luzon überquert (Fuchs 2002, Abb. 27). Viele (sog. Killer-)Taifune erreichen auf einzelnen Zugbahnabschnitten mehr als 200 km/h: Von 1980 bis 2000 kamen durch Taifune ca. 16.000 Menschen ums Leben. Im Herbst 2013 und 2014 rasten zwei Killertaifune über die zentralen Philippinen, die Stadt Tacloban wurde weitgehend zerstört. Starke Niederschläge bis zu 750 mm/Tag verursachen dann Erdrutsche und Überschwemmungen, wichtige Verkehrslinien werden durch Bergstürze zerstört, Schifffahrt und Flugverkehr werden eingestellt, dicht besiedelte Räume sind über Wochen vom Wirtschaftsleben abgeschlossen, die Elektrizitätsversorgung bricht zusammen; Industriebetriebe müssen für Wochen ihre Produktion einstellen. Manila z.B. steht in jedem Jahr 1 – 1,5 m unter Wasser.
| Abb. 26 | Die jährliche Zahl der Taifune und deren monatliche Verteilung (1945 – 2005) in den Philippinen
| Abb. 27 | Zugbahnen der „Killer“-Taifune (Windgeschwindigkeiten > 200 km/h) der Jahre 1945 – 2005 und die Einwohnerdichte in den Provinzen (2000) der Philippinen
Im Unterschied zu den nördlichen und zentralen Philippinen wird Mindanao selten von Taifunen überquert, da in Äquatornähe die Corioliskraft zu schwach ist, um die Zyklone auf die Insel zu fegen. Zwar werden auch die Ostküsten Hinterindiens noch von diesen Orkanen heimgesucht, jedoch nicht mit dieser Häufig- und Heftigkeit wie die Philippinen. Tropische Wirbelstürme (Zyklone) rasen jedoch in der Monsunzeit vom Indischen Ozean etwa an die Küsten Burmas: Im Mai 2008 fegte der Zyklon Nargis mit anschließender Flutwelle über das Irawadi-Delta und die Metropole Yangon: Über 100.000 Menschen wurden getötet, ca. 1,5 Mio. obdachlos. Die unterschiedlichen Auswirkungen von Naturkatastrophen auf Bevölkerung und Wirtschaft zeigt die Tabelle I (im Internet). Damit werden die wesentlichen Faktoren für die heutigen Disparitäten hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung deutlich.