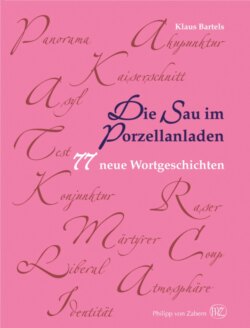Читать книгу Die Sau im Porzellanladen - Klaus Bartels - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[Menü]
Coup
Was ist ein Coup? Da sprechen die Lexika von einer frischgewagt bis geradezu tolldreist angelegten, überraschend lancierten und jedenfalls erfolgreich durchgeführten Unternehmung: Ein Coup, der fehlschlägt, ist ein Coup gewesen. Der Griechengott des großen Coups ist der so ingeniös diebische wie ingeniös erfinderische junge Hermes: Ein nächtlicher Banküberfall à la Rififi mit zweistelliger Millionenbeute ist ein Coup so gut wie eine über Nacht bekanntgewordene Bankenfusion mit zweistelligem Milliardengewinn. Aber was reden wir da von Millionen und Milliarden? Eigentlich ist ein Coup eine Ohrfeige.
Der jeder Eindeutschung und damit jeder Rechtschreibreform spottende „Coup“ ist unverkennbar zunächst französischer Herkunft. Ein mittelalterlicher französischer colp aus dem 11. Jahrhundert und ein gleichfalls mittelalterlicher lateinischer colpus in der Bedeutung eines derben Schlages oder Hiebes weisen uns noch ein gutes Jahrtausend weiter in die klassische Antike zurück: zu einem leichthin latinisierten colaphus und schließlich zu einem griechischen kólaphos in der Bedeutung des derben Schlages, den wir im Deutschen eine „Ohrfeige“ nennen. Die weitere Stammverwandtschaft und damit die Grundbedeutung des griechischen Wortes bleiben im Dunkeln; nur eines ist sicher: Ein „Ohr“ oder eine „Feige“ schauen da nicht heraus.
Von der griechischen und Jahrhunderte später von der römischen Komödienbühne schallt unter diesem Stichwort ein ohrenfälliges Knallen zu uns herüber: Im 5. Jahrhundert v. Chr. hat der sizilische Komödiendichter Epicharm einem Sporttrainer den sprechenden Spitznamen Kólaphos, „Ohrfeige“, gegeben, und über die lateinischen Versionen griechischer Komödien ist das Wort im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. aus dem Griechischen ins Lateinische übergewechselt. Bei dem gröberen Plautus klagt ein Schmarotzer, ohne colaphi, ohne „Ohrfeigen“, gehe es in seiner Profession nun einmal nicht ab, und selbst bei dem feineren Terenz jammert ein Kuppler einmal lautstark über die „reichlich fünfhundert colaphi“, der er in der Nacht zuvor bezogen habe.
In unserem „Überraschungsschlag“ und im militärischen „Handstreich“ schlägt die ursprüngliche Bedeutung des „Coup“ noch vernehmlich durch, und nicht von ungefähr stellt unsere Bildersprache auch den ordentlich verbal am Konferenztisch und durchaus nicht irgendwie brachial hinter den Kulissen ausgehandelten Coup noch drastisch vor Augen: Einen politischen oder wirtschaftlichen Coup kann man im Deutschen „von langer Hand“ vorbereiten, zu einem Coup kann man „weit ausholen“, einen Coup kann man zu guter Letzt glücklich „landen“ – nur dass der anvisierte Landeplatz jetzt nicht mehr die linke oder rechte Backe eines Ohrfeigengesichts, sondern die erste Meldung in der abendlichen Tagesschau oder die Titelseite einer Tageszeitung ist.
Gleich nach dem überraschenden coup de chance serviert uns das französische Lexikon noch eine perlend überschäumende coupe de champagne, den von langer Hand vorbereiteten und schließlich glücklich gelandeten Überraschungstreffer nun auch gebührend zu feiern. Aber das ist lediglich eine Zufallsbegegnung im Alphabet: Hinter dieser coupe de champagne, diesem einen allzu rasch geschlürften Dezi Champagner, das der Schweizer Dialekt auch liebevoll als ein „Küpli“ anspricht, steht eine lateinische cupa, ursprünglich ein „Fass“ und schließlich ein „Becher“, und damit sind wir hier weit jenseits aller handgreiflichen und sonstwie ausgehandelten Landemanöver bei dem versöhnlichen Happy End dieser Wortgeschichte von schallenden Ohrfeigen und anderen Handstreichen angelangt: bei knallenden Sektkorken und klingenden Anstoßmanövern.