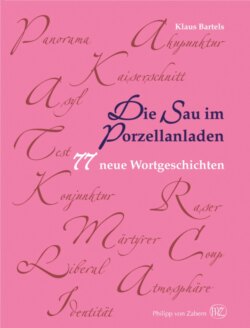Читать книгу Die Sau im Porzellanladen - Klaus Bartels - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[Menü]
Akupunktur
So wenig wie die klassischen, schon vor Jahrhunderten eingeführten Chinawaren, das Papier und das Porzellan, so wenig hat die jüngste Einfuhr aus dem Reich der Mitte, die Akupunktur, ihren ursprünglichen chinesischen Namen beibehalten können. Die allgemeine Regel, dass der Import der Wörter mit dem Import der Waren einhergehe, scheint für China nicht zu gelten, und so stammt denn auch die „Akupunktur“ aus dem unerschöpflichen Namensfundus der Alten Sprachen. Dazu haben die europäischen Importeure das lateinische Substantiv acus mit dem Genitiv acūs, „Spitze, Nadel“, und die von dem Verb pungo, „stechen“, abgeleitete punctura, das „Stechen“, zusammengesetzt: Die „Akupunktur“ ist ein „Nadelstechen“, und damit sind wir mit unserem Latein vorerst am Ende: fertig, basta, Punktum!
Punktum? Noch nicht so bald; denn anders als ein mathematischer Punkt ohne Länge, ohne Breite, ohne Tiefe hat dieses „Punktum“ doch immerhin historische Tiefe: Hinter dem lateinischen punctum, dem „Punkt“ in seinen vielerlei Bedeutungen, steht eine griechische stigmé, und dahinter wieder das Verb stízein, dessen Sprachverwandtschaft mit unserem „Stechen“ ja sogleich ins Ohr sticht. Die beiden davon abgeleiteten Substantive stígma und stigmé, eigentlich „Stich“, bezeichnen ursprünglich die Tätowierung eines Menschen, insbesondere zur Kennzeichnung eines Sklaven, dann auch die Brandmarkung eines Stücks Vieh, dann auch die Zeichnung auf der Haut einer Schlange oder im Gefieder eines Vogels. Durch die seit alters so genannten stígmata, die „Wundmale“ Christi, ist das griechische Wort in der heiligenden „Stigmatisation“ bis in die Neuzeit geläufig geblieben; im Anschluss an jene Tätowierung von Sklaven sprechen wir heute von einem brandmarkenden „Stigma“ und der „Stigmatisierung“ eines Einzelnen oder einer Gruppe.
Die Stich an Stich, Punkt an Punkt setzende „pointillistische“ Technik des Tätowierens hat früh zu Übertragungen vom markierenden Einstich auf den markierten Punkt geführt. Da ist zunächst die mathematische stigmé, der zuerst im 4. Jahrhundert v. Chr. bei Aristoteles genannte mathematische „Punkt“, und sodann die orthographische stigmé, der zuerst im 3. Jahrhundert v. Chr. von Aristophanes von Byzanz eingeführte „Punkt“ am Ende eines jeden und so auch dieses Satzes. Die eine wie die andere stigmé erscheint im Lateinischen in der Lehnübersetzung punctum und danach im Deutschen als „Punkt“. Entsprechend ist aus einer stigmé chrónu im Lateinischen ein punctum temporis und im Deutschen der „Zeitpunkt“ hervorgegangen, samt der Uhrzeit „Punkt zwölf“ und der so merkwürdig benannten Tugend der „Pünktlichkeit“; und geradeso ist aus der blutroten stigmé im Weißen eines angebrüteten Eies, in der Aristoteles das „springende“, klopfende Herz erkannte, erst ein lateinisches punctum saliens und dann bei uns der geflügelte „springende Punkt“ geworden.
Auch in unseren Nachbarsprachen lebt dieses lateinische punctum munter fort; aus dem Französischen ist die zugespitzte „Pointe“ und das à point gebratene Entrecôte, aus dem Englischen der Point of no Return und neuerdings der Point of Sale zu uns herübergekommen. In diesen neusprachlichen „Punkten“, „Pointen“ und Points erkennen wir immerhin noch ein lateinisches punctum, und das medizinische „Punktieren“ und „Akupunktieren“ mit der einen und der anderen Nadel und das ziselierende „Punzen“ mit Punze und Hammer ist ja wirklich noch ein „Stechen“ im alten Sinne des Wortes. Aber wer, der’s nicht weiß, würde in einem vielfältigen „kunterbunten“ Festprogramm, in dem Blasmusik und Festreden für die Großen, Blindekuh und Sackhüpfen für die Kleinen in buntem Wechsel aufeinander folgen, gleich einen vielstimmigen „Kontrapunkt“ erkennen, in dem die eine gestochene Note gegen die andere gesetzt ist? Aber so ist es tatsächlich, und allen Lesern, denen es mit diesem „kunterbunt“ hier zum Schluss doch gar zu bunt wird, sei ernsthaft versichert: Das ist eine wortgeschichtlich hieb- und stichfeste Pointe, und damit nun endgültig: fertig, basta, Punktum!