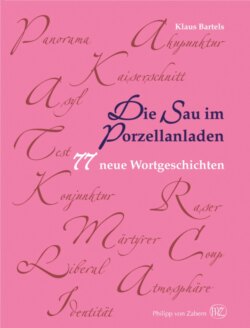Читать книгу Die Sau im Porzellanladen - Klaus Bartels - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[Menü]
Devisen
„Diviser pour régner“ – das war die Herrschaftsdevise König Ludwigs XI. von Frankreich, die zu jener Zeit, im späteren 15. Jahrhundert, ihre seither geläufige, ja geflügelte lateinische Fassung „Divide et impera!“ gefunden hat, schulmäßig wörtlich übersetzt: „Teile und herrsche!“ oder deutlicher mit Goethe: „Entzwei’ und gebiete!“ Hier können die Wörter im Vorübergehen ein fröhliches Augenzwinkern wechseln: Nicht nur das französische diviser in dieser machtpolitischen Devise, auch die „Devise“ selbst in diesem Sinne eines Leitworts oder Wahlspruchs geht auf das geläufige lateinische Verb dividere, „teilen, einteilen, aufteilen“, zurück, das diviser auf geradem Weg, die „Devise“ um drei Ecken, und bei den „Devisen“ im Sinne der fremdländischen Währungen ist es sogar noch eine mehr.
Dieses lateinische dividere hat in unserem Euro-Wortschatz ein paar offenkundige Verwandte. Aus der divisio, der „Teilung“, ist bereits in der Spätantike die arithmetische „Division“ im Sinne der vierten Grundrechenart und dann im 18. Jahrhundert die militärische „Division“ im Sinne einer Heeres-„Abteilung“ hervorgegangen. Und zu dem alten „Dividenden“, der „zu teilenden“ Zahl in der Rechenstunde, hat sich gleichfalls im 18. Jahrhundert die „Dividende“, der „zu verteilende“ Unternehmensgewinn an der Aktienbörse gesellt. Dabei ist aus dem französischen – männlichen – dividende im Deutschen eine – weibliche – „Dividende“ geworden und aus der gesamten „zu verteilenden“ Summe der pro Aktie ausgeschüttete Bruchteil.
Die „Devise“ im Sinne eines Leitspruchs oder eines Wahlspruchs und mit ihr die „Devisen“ im Sinne fremdländischer Scheine und Münzen stehen im Lexikon ein paar Seiten weiter vorn, und wenn es nicht gerade um das geflügelte „Divide et impera!“ geht, ist da von einem „Teilen“ nicht mehr viel herauszuhören. In der heraldischen „Herolds“- oder Wappenkunst der frühen Neuzeit bezeichnete die französische devise zunächst einen „abgeteilten“ Platz in der oberen oder unteren Hälfte, der linken oder rechten Seite des Schildes und danach den dort eingesetzten meist lateinisch lapidar gefassten Sinnspruch. Ein spätlateinisches divisare und dann devisare und ein frühfranzösisches deviser, durchweg in der Bedeutung „teilen“, markieren den Weg jenes alten dividere zu diesen „Devisen“ auf den Wappenschildern der Renaissance und in der Sinnbildkunst des 16. und 17. Jahrhunderts.
In der Regel gilt: ein Wappenschild – ein Wappenspruch, und so blieb der Plural frei zu weiterer Verwendung. Folgen wir der geläufigen Erklärung, so haben die Devisen in fremder Währung ihren Namen von den lebensklug mahnenden und abmahnenden klassischen Zitaten, mit denen humanistisch angehauchte Bankiers der späten Goethezeit ihren Wechselvordrucken ein höheres Ansehen gaben. Statt eines herrscherlichen „Divide et impera!“ stand da nun vielleicht ein dem Bankgeschäft entsprechendes geflügeltes „Fide, sed cui, vide!“ Aber auch Wörter sind Wechsel, und auch für sie gilt dieses „Trau, schau, wem!“ Wer weiß: Möglicherweise hat jenes frühfranzösische deviser, dessen Bedeutungsentwicklung erst vom Einteilen zum Anordnen und dann vom Anordnen zum Verfügen führte, diese Wechsel auch ohne alle Leitworte und Wahlsprüche ganz unbildlich zu „Devisen“ im Sinne von Zahlungs-„Verfügungen“ gemacht.
Weiter hinten im Lexikon, unter dem negierenden „In-“, gibt sich das lateinische dividere nochmals ein Stelldichein: mit dem „Individuum“, eigentlich dem „unteilbaren (Einzelnen)“. Die ursprünglich Ciceronische Lehnübersetzung individuum (corpus), „unteilbarer (Körper)“, für das griechische átomon (sóma), das – Leukippische und Demokritische – „Atom“, hatte sich in der Antike nicht durchsetzen können. Doch neuerdings hat sie erst bei den Biologen für das einzelne Lebewesen und dann bei den Soziologen für die einzelne Person Verwendung gefunden und ist schließlich mit dem „Individualisten“ und dem „individuellen Service“ auch in unserer Alltagssprache geläufig geworden.
Wenn heute ein Polizeirapport drei verdächtige Individuen vor einem Atomkraftwerk registriert, so wäre da schon wieder solch ein fröhliches Augenzwinkern unter alten Bekannten fällig, und hätte Cicero mit seiner Lehnübersetzung des griechischen „Atoms“ damals nachhaltigen Erfolg gehabt, so hätten da vielleicht sogar umgekehrt drei verdächtige Atome vor einem Individualkraftwerk polizeilichen Verdacht erregt – wenn auch gewiss nicht den, dass sich da etwa griechische Atome als lateinische Individuen oder lateinische Individuen als griechische Atome vermummt hätten.