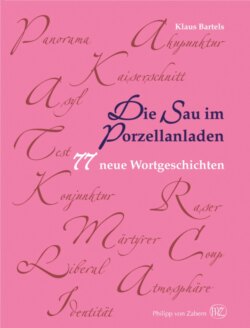Читать книгу Die Sau im Porzellanladen - Klaus Bartels - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[Menü]
Demokratie
Zu erklären, dass die Demokratie griechischen Ursprungs ist und einen griechischen Namen hat, hieße ja wohl Eulen nach Athen tragen. Vorneweg geht da das Substantiv démos, „Volk“, und hinterdrein kommt da das Verb krateín, „herrschen“, das im Griechischen eine den Gegner überwältigende, unterkriegende, mit dem bildkräftigen schweizerischen Dialektwort: den Gegner „bodigende“ Überlegenheit bezeichnet. In den Olympischen Spielen der Antike hieß der Catch-as-catch-can-Ringkampf, bei dem außer Beißen und Kratzen alles erlaubt war, pankrátion, drastisch wörtlich: das „All-Bodigen“. Die „Demokratie“ bezeichnet die Staatsform, in der sich die „Vielen“, wie man damals oft auch sagte, oder dann der démos, das „Volk“, gegenüber dem Führungsanspruch eines Einzelnen oder einer Gruppe durchsetzt.
In der „Demagogie“, der „Demographie“ und der „Demoskopie“ ist das Volk dann nicht mehr Subjekt, sondern Objekt. Die „Demagogie“, die „Volksverführung“, hat sich bezeichnenderweise von allem Anfang an, vom 5. Jahrhundert v. Chr. an, der „Demokratie“ beigesellt; die „Demographie“, die das Volk statistisch erfasst und „beschreibt“, und die „Demoskopie“, die dem Volk in Herz und Seele „schaut“, sind moderne Retortenwörter. Aus klassischer Zeit stammt dann wieder die „Epidemie“, die ursprünglich den Aufenthalt eines „beim Volk“, in der Stadt gastierenden Star-Sophisten oder Star-Rhetors bezeichnet; im Titel der Hippokratischen „Epidemien“ ist das Wort früh auf die unwillkommene Einkehr einer „beim Volk“, in der Stadt sozusagen gastierenden, grassierenden Krankheit übertragen worden.
Ihren ersten Auftritt hat die so zusammengesetzte „Demokratie“ im 5. Jahrhundert v. Chr. in Herodots Geschichtswerk, im 6. Buch, im 43. Kapitel. Da vermeldet der griechische Historiker der Perserkriege als ein „höchst verwunderliches“ Faktum das Folgende: Ausgerechnet der persische Feldherr Mardonios, der Schwiegersohn des Perserkönigs Dareios, habe auf seinem Feldzug gegen Griechenland von 492 v. Chr. die Tyrannenherrschaften in den ionischen Griechenstädten allesamt ablösen und stattdessen – man höre und staune – demokratíai, „Demokratien“, einrichten lassen. Der Perser meinte wohl, derlei griechische „Volksherrschaften“ mit ihren häufigen Wahlkämpfen und ihrem dauernden Parteienstreit ließen sich leichter niederhalten als die zuvor dort etablierten Tyranneien.
Die griechischen Politologen des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. haben dieser „Herrschaft der Vielen“ oder „des Volkes“ eine königliche oder tyrannische monarchía, eine „Monarchie“, wörtlich: die „Herrschaft eines Einzelnen“, und eine aristokratische oligarchía, eine „Oligarchie“, wörtlich: die „Herrschaft der Wenigen“, gegenübergestellt. In diesen beiden anderen Staatsformen ist statt des brachialen griechischen krateín das weniger gewaltträchtige Verb árchein, „anfangen, der Erste sein, herrschen“, zum Zuge gekommen. Aus der Sicht der Antike ist eine neuzeitliche Demokratie ja allemal eine „gemischte Verfassung“: ein fein abgestimmter Verfassungs-Cocktail mit einem Schuss Monarchie, einem Schuss Oligarchie und einem Schuss Demokratie darin – jeweils mal mehr, mal weniger von dem einen oder anderen.
Mit der Erinnerung, dass die nach dem geläufigen Muster von „Info“ und „Memo“ salopp verkürzte „Demo“ eigentlich eine „Demonstration“ ist und mit der „Demokratie“ sprachlich nicht das Geringste zu tun hat, tragen wir schon wieder Eulen nach Athen oder jetzt Gänse aufs Kapitol. Aber es ist hübsch zu sehen, wie diese griechischen und lateinischen Namensvettern einander heute in der demokratisch garantierten Demonstrationsfreiheit über den Weg laufen, und wir können uns freuen, dass wenigstens die hehre „Demokratie“ nicht auch noch zur „Demo“ zusammengeschnurrt ist. Mit dem – gleichfalls lateinischen – destruktiven „Demolieren“, wörtlich einem „Abreißen, Einreißen“, hat diese „Demo“ glücklicherweise wieder nicht das Geringste zu schaffen.