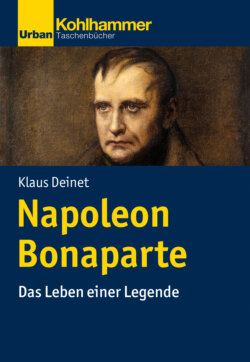Читать книгу Napoleon Bonaparte - Klaus Deinet - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Junge aus Ajaccio (1769–1788) Franzose – Italiener – Korse
ОглавлениеWar Napoleon Franzose? Über diese Frage ist viel gestritten worden. Zumal von französischen Historikern wurde sie vehement bejaht. Es sei »noch niemals dagewesen, daß die Franzosen sich einem Manne hingaben, der nicht wenigstens von irgendeiner Seite her zu ihrem eigenen Lande gehört hätte«, erklärte kategorisch Jacques Bainville.1 Nüchterner, aber mit der gleichen Schlussfolgerung, liest es sich bei einem seiner jüngsten britischen Biografen, Andrew Roberts, für den er ein »Korse mit italienischen Wurzeln« war, aus dem »die Erziehung in Frankreich einen Franzosen gemacht hat.«2 Gegen das Hauptargument der Gegenseite, dass er nach Sprache und Herkunft ein Fremder war, wetterte Louis Madelin mit den Worten:
»Ob der Mann, so wie er sich der Welt präsentierte, an den Ufern der Loire, der Seine, des Rheins, der Donau oder der Elbe geboren wurde: wir nennen ihn einen ›Römer‹ durch seinen Charakter, das sagt alles.«3
Damit zielte er auf die spezifisch französische Definition von Nationalität, die jeden, der der ›citoyenneté‹ angehört oder diese aus freien Stücken angenommen hat, unabhängig von seiner Herkunft, Sprache und Hautfarbe als Franzosen ansieht.
Doch es bleibt ein leiser Vorbehalt. Auch wenn Napoleons Vita das Musterbeispiel einer gelungenen Assimilation darstellte, ist es zweifelhaft, dass das Franzose-Sein ihm jemals zur selbstverständlichen Natur geworden ist. Bainvilles Bemerkung, dass die Eindrücke an der Militärakademie in Brienne ihn befähigt hätten, »Frankreich zu verstehen und zu ihm zu sprechen«,4 bestätigt ungewollt diesen Verdacht. Denn um ein Land zu verstehen und »zu ihm zu sprechen«, muss man außerhalb desselben stehen. Selbst in der Art und Weise, wie Napoleon später, zuletzt in seinem Testament, von dem »französischen Volk« gesprochen hat, das er »so sehr geliebt« habe und inmitten dessen er begraben sein wollte, kommt die Distanz desjenigen zum Ausdruck, der von außen gekommen war und der Frankreich als einem Gegenüber begegnete, dem er sich anverwandelte.5
Was aber, wenn nicht Franzose, war er dann? Auch diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Im Jahr von Napoleons Geburt gehörte Korsika gerade seit zwei Jahren zu Frankreich, das die Insel offiziell noch im Namen Genuas verwaltete. Doch hatte die administrative und kulturelle Inbesitznahme schon begonnen und die französische Regierung ließ erkennen, dass sie nicht daran dachte, Korsika jemals wieder den hochverschuldeten Genuesen zurückzugeben. Alles, die militärische Inbesitznahme und die Umwandlung in ein pays d’état – also eine halbautonome Ständeprovinz nach dem Vorbild der Guyenne oder der Bretagne – deutete vielmehr auf eine entschlossene, wenn auch bedachtsame Inkorporierung Korsikas in den französischen Staatskörper hin.
War Napoleon also Italiener? Seine Vorfahren fühlten sich lange Zeit als solche. Sie hatten sich von der Seerepublik Genua, zu der ihre ursprüngliche Heimat Sarzana gehörte, durch Steuervergünstigungen und Aufstiegschancen auf die Insel locken lassen. Hier haben sie es zu einem beachtlichen Wohlstand gebracht, der mit einem Adelstitel einherging. Die vom Festland stammenden Familien bildeten eine schmale Elite in den von Genua kontrollierten Hafenstädten, während das Inselinnere weitgehend sich selbst und seinen archaischen Normen überlassen blieb. Die Angehörigen dieser Familien – die Pozzo di Borgo, Paravicini, Saliceti, Ramolino – heirateten untereinander, solange sie an Ansehen einander ähnelten. Napoleons Vater hatte das Glück gehabt, eine Tochter aus dem Clan der Ramolino, die erst vierzehnjährige Laetitia, zu ehelichen, obwohl der Stern der Buona Parte zu dieser Zeit wegen misslungener Bodenspekulationen schon im Sinken begriffen war.
Aber Napoleon als Italiener zu bezeichnen, wäre ebenso falsch, wie ihn wie selbstverständlich zum Franzosen zu erklären. Gewiss, die Intellektuellen unter seinen Verwandten studierten zumeist auf dem Festland, in Florenz, Pisa oder Neapel, und bedienten sich des Italienischen als einer dem eigenen Idiom nahen Lehnsprache. Aber Napoleon kam erst 1797 als General einer französischen Armee nach Italien und sah sich durchaus nicht als Italiener – auch nicht 1805, als er sich im Dom von Mailand die langobardische Krone aufsetzte. Seine Familie mochte sich im Verlauf seiner Eroberungen und auch noch nach seiner Abdankung allmählich wieder der ursprünglichen Heimat assimilieren. Er selbst tat dies nicht. Kaum etwas brachte ihn später so sehr in Rage, als wenn sein Name italienisch – Buonaparte – buchstabiert wurde. Geschah dies noch dazu mit französischer Aussprache des »u« als »ü«, wie es Chateaubriands berühmtes Pamphlet von 1814 suggerierte, kochte er vor Wut.6