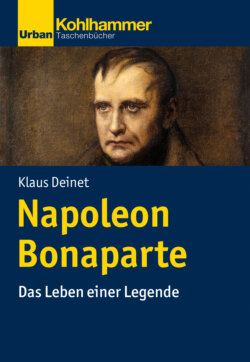Читать книгу Napoleon Bonaparte - Klaus Deinet - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Trittbrettfahrer der Revolution (1789–1793) Frühe Erfahrungen
ОглавлениеFür die eigenartige Rolle, die Korsika in der frühen Biografie Napoleons spielte, hat einer seiner jüngsten Biografen, Patrice Gueniffey, eine kluge Formel gefunden. Gueniffey vergleicht seine innere Entwicklung mit der von Einwandererkindern der zweiten und dritten Generation, die sich, obwohl gänzlich in der neuen Heimat akkulturiert, anders als ihre Eltern wieder dem ursprünglichen Herkunftsland zuwenden. Gueniffey gelangt dabei zu der erstaunlichen Erkenntnis, Napoleon »liebte den Franzosen nicht, der er geworden war, und er bemühte sich, der Korse zu werden, der er nicht mehr war.«20 Gueniffeys Bemerkung trifft die zwiespältige Beziehung, in der Napoleon zu beiden ›Vaterländern‹ stand, vergleichbar der Zerrissenheit, die heutige Immigrantenkinder in ähnlicher Lage empfinden.
Diese eigenartige Doppelbindung, die zu einer lebenslangen Ambivalenz zu werden drohte, geriet durch die Revolution in Bewegung, sodass es nicht einfach ist, in Napoleons Äußerungen eine klare Linie zu erkennen. Zwei grundlegende Tatsachen sind zu beachten: Zum einen projizierte er alle Ergebnisse der Revolution auf seine Heimat. Er beurteilte die Französische Revolution also vor allem in Bezug auf Korsika. Zum anderen muss bei den Äußerungen Napoleons zur Revolution gefragt werden, ob er sie als bloßer Zeitgenosse oder als Augenzeuge traf, der quasi beruflich in die Vorgänge involviert war. Dann urteilte in ihm nicht der Fortschrittsgläubige, als der er sich gab, sondern der Militär. Für alle frühen Urteile Napoleons über die Französische Revolution ist aber die persönliche Distanz kennzeichnend, die er zu den Geschehnissen erkennen lässt. Man hätte ihn für einen ausländischen Beobachter halten können.
So erkannte er völlig richtig die Bedeutung der am 8. August 1788 verkündeten Entscheidung des Königs, für den Mai des folgenden Jahres die Generalstände einzuberufen. Denn er hatte begriffen, dass damit für Korsika eine Gelegenheit geschaffen wurde, die bestehende französische Administration loszuwerden. Auch befürwortete er die Bewerbung seines Bruders Joseph als eines der Vertreter Korsikas für die Abordnung zu den Generalständen in Versailles. Zugleich bedauerte er, dass die allgemeine Verunsicherung dem Erfolg »unserer Angelegenheit« – gemeint war die von seinem Vater mit viel Aufwand betriebene Maulbeerbaumschule – hinderlich war.21
Vor Ort, in Auxonne, versah er derweil ohne Bedenken die ihm zugewiesene militärische Aufgabe, nämlich Ordnung zu schaffen und Aufruhr zu verhindern. So auch im April 1789, als er für mehrere Wochen in das Städtchen Seurre abkommandiert wurde, wo er zusammen mit einem anderen Offizier revoltierende Kleinbürger »zur Raison rief«, die verhindern wollten, dass die Getreidevorräte von Wucherern weggeschafft wurden. Seiner Mutter schrieb er:
»Das Volk hat einen Aufstand gemacht und sich gegen seine städtischen Beamten erhoben, es hat Getreidemagazine geplündert, die die Wucherer nach Lyon bringen wollten. Deshalb sind wir als Hundertschaft ausgerückt, um dem Einhalt zu gebieten.«22
Die Motive der Aufständischen waren Napoleon also bekannt, aber er verwandte kein Wort des Verständnisses darauf, sondern erhoffte sich die Lösung der Probleme allein von der Versammlung in Versailles, wobei er nicht mit düsteren Farben sparte:
»Der Augenblick der Stände naht. Man spürt es allenthalben. Die Unruhen in den Städten, den Dörfern, auf dem Land nehmen überhand. Gebe der Himmel, dass diese Flamme des Patriotismus Bestand hat, und dass sich die Dinge nicht verschlimmern. Das fürchte ich. Sie wissen ja, dass sich kurz vor dem Tod immer eine Besserung einstellt.«23
Als die Generalstände schließlich am 5. Mai 1789 zu ihrer Eröffnungssitzung in Versailles zusammentraten, interessierte ihn daran hauptsächlich die Frage, ob er deshalb die Veröffentlichung seines Buches über Korsika verschieben sollte. Die vorausgegangenen Réveillon-Unruhen in Paris, bei denen über hundert Personen zu Tode gekommen waren, streifte er nur mit lässiger Geste. In einem Brief an seinen Bruder Joseph schreibt er etwa:
»Man musste Truppen heranführen, um den Pöbel zu beruhigen, man hat zehn oder mehr von ihnen gehängt und getötet, vielleicht zwanzig, vielleicht dreißig Personen, die Berichte darüber waren übertrieben.«24
Von der ›juristischen‹ Revolution, die sich in den folgenden Wochen in Versailles vollzog, verfolgte er im Wesentlichen nur den äußeren Ablauf, nämlich dass der leitete Minister Necker, der ihm imponierte, gegen das Reformprogramm Ludwigs XVI. vom 23. Juni 1789 opponierte und deshalb zurücktreten musste. Ob er zu diesem Zeitpunkt bereits begriff, welcher Stellenwert dem Ballhausschwur und dem folgenden Nachgeben des Königs gegenüber der nun als ›Assemblée nationale‹ firmierenden Ständeversammlung zukam, ist jedoch mehr als fraglich. Er verfolgte, wie Ludwig XVI. unter dem Eindruck der fortgesetzten Unruhe in Paris das unzuverlässig gewordene Militär aus der Hauptstadt abzog und dadurch den Bastillesturm erst ermöglichte, dessen Dynamik er anschließend nur dadurch dämpfen konnte, dass er die Ergebnisse der Verfassungsrevolution in Versailles anerkannte und den beliebten Minister zurückrief. Diese neuerliche Volte der Regierung scheint der junge Napoleon als das gesehen zu haben, was sie in den Augen eines Soldaten war: als Einknicken vor dem Druck der Straße infolge des Versagens der militärischen Führung und mangelnder Konsequenz in der Haltung des Königs.25
Abb. 2: Europa zu Beginn der Französischen Revolution 1789
Im kleinen Maßstab bekam er Ende Juli 1789 die Gelegenheit, es besser zu machen. Bei den Unruhen, die im Gefolge der ›Grande peur‹ auch die Bourgogne erfassten, sprang er für einen von der Situation überforderten 75-jährigen General ein, schloss sich mit der neugegründeten Bürgerwehr von Auxonne kurz und ließ 35 der Unruhestifter festsetzen. »In einem Monat«, meinte er zu seinem Bruder, würde »alles erledigt sein«.26 Und über die Opfer der Unruhen in ganz Frankreich urteilte er nun, ganz im Sinne der offiziellen Lesart:
»Das war das unreine Blut der Feinde der Freiheit und der Nation, das sich seit langem schon auf ihre Kosten mästete.«27
Von den Männern der Nationalversammlung, die sich daran machten, dem Land eine Verfassung zu geben, hielt er allerdings nicht allzu viel. »Sie kommen langsam voran und schwätzen zu viel«. Insgesamt überwog ein Gefühl gebremster Erleichterung. »Alles das ist brillant, aber es existiert vorerst nur auf dem Papier.« Dass Ludwig zum »Wiederhersteller der französischen Freiheit« gekürt und auf einer Medaille verewigt worden war, ließ er unkommentiert. Ob er ihn damals noch als seinen König ansah – wenn er dies jemals getan haben sollte –, sagen seine Briefe nicht und ist mehr als zweifelhaft. Die Widmung an Necker, die er seinem Buch über Korsika voranstellen wollte, begann mit den Worten:
»Im Namen Ihres Königs.«28
Ganz anders wurde sein Ton, wenn Korsika ins Spiel kam. Als Beleg dafür dienen den Biografen der Brief an seinen Paten und das Schreiben an Paoli. Man muss aber in Rechnung ziehen, dass es sich hier um Schreibübungen eines Jünglings handelt, der sich für einen angehenden Literaten hielt und dem Sprachgestus seiner Vorbilder nacheiferte. Dem Paten, der gleichzeitig Schriftführer der korsischen Stände war und zu einer vorsichtigen Reform neigte, wollte er vor Augen führen, dass der Moment für eine Abschaffung der französischen Administration – »das dreifache Joch des Soldaten, des Richters und des Steuereintreibers« – günstig war und nicht verpasst werden durfte.
»An einem korrupten Hof besitzt die Wahrheit wenig Reize; aber heute hat sich die Bühne gewandelt, man muss auch sein Verhalten ändern. Wenn wir diesen Augenblick versäumen, werden wir für immer Sklaven sein.«29
Der Brief an Paoli begann gleich mit einem verbalen Paukenschlag à la Rousseau:
»Ich ward geboren, als das Vaterland unterging. 5000 an unsere Küsten gespiene Franzosen ertränkten den Thron der Freiheit in Strömen von Blut, dieses ruchlose Schauspiel umfing als erstes mein Blick.«30
Er ging dann zu der schon im anderen Brief gegeißelten Trias über (»unter der dreifachen Kette des Soldaten, des Legisten und des Steuereintreibers leben meine verachteten Landsleute dahin«), um zu seinem eigentlichen Anliegen zu kommen:
»Eine seit geraumer Zeit begonnene Studie in französischer Sprache, die sich aus langem Anschauen speiste, sowie die Auswertung von Erinnerungen, die ich in den Taschen meiner Mitbürger fand, ließ mich auf einen gewissen Erfolg hoffen.«31
Es handelte sich hierbei um die Briefe über Korsika (Lettres sur la Corse), ein etwa 140 Seiten umfassender Extrakt seiner Studien zur Geschichte Korsikas, der den Bogen von der Antike zur Gegenwart spannte. Dabei stellt er die zeitgenössische Unfreiheit einer ruhmvollen Geschichte entgegen, um damit für die Befreiung vom französischen »Joch« aufzurufen. Napoleon hatte das Elaborat seinem Lehrer Dupuy in Valence vorgelegt, der ihm jedoch dringend von einer Veröffentlichung abriet. Daraufhin widmete er es dem Abbé Raynal, den er für seine kritischen Schriften über das Ancien Régime inzwischen mehr bewunderte als Rousseau. Durch die Revolution allerdings hatte dieses Manuskript sein eigentliches Angriffsobjekt verloren, sodass er die Veröffentlichung einstweilen auf Eis legte. Stattdessen wollte er nun aktiv bei der Veränderung Korsikas mitwirken und beantragte – zur Besserung seiner Gesundheit – einen viermonatigen Heimaturlaub, der ihm postwendend gewährt wurde. Seine Abwesenheit sollte sich nach einer abermaligen Verlängerung des Urlaubs inklusive dessen Überziehung bis zum Frühjahr 1791 hinziehen.