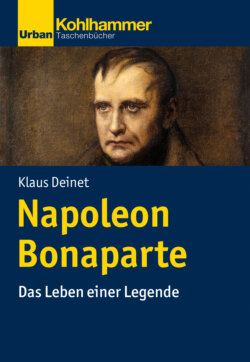Читать книгу Napoleon Bonaparte - Klaus Deinet - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Paris im Sommer 1792
ОглавлениеDie Monate in Paris, wo Napoleon auf seine weitere Verwendung wartete, führten ihn in das Zentrum der Krise. Es war klar, dass der König den Krieg nicht aus vollem Herzen wünschte, auch wenn er sich dafür ausgesprochen hatte. Ja, er behinderte vielmehr die Gesetze, die dessen energische Führung ermöglichen sollten, durch sein Veto. Die Nationalversammlung besaß jedoch keine Handhabe, ihm dies zu verwehren, denn das aufschiebende Veto war dem Monarchen in der Verfassung ausdrücklich erlaubt. Es blieb nur der Weg der Gewalt, vor dem die neuen Abgeordneten allerdings zurückschreckten. Sie versuchten, den Druck der öffentlichen Meinung auf den König derart zu erhöhen, um ihn zum Einlenken zu bewegen, damit die von der Nationalversammlung eingebrachten Gesetze gegen die eidverweigernden Priester sowie für den Aufbau einer Freiwilligenarmee umgesetzt werden konnten.
So ergaben sich einige groteske Szenen, deren Augenzeuge Napoleon wurde. Die erste ereignete sich am 20. Juni 1792, als eine lärmende Menge in die Tuilerien eindrang und die königliche Familie bedrängte. Allerdings legte sich der Unmut, als Ludwig sich eine Jakobinermütze aufsetzen ließ und mit den Eindringlingen auf das Wohl des Vaterlands anstieß. Es ist keine Frage, was den jungen Offizier an dieser Szene am meisten aufgebracht hat: Es war der offensichtliche Verlust seiner Würde, den Ludwig XVI. vor aller Augen akzeptierte und den er sich selber sogar als taktischen Erfolg anrechnete. Gewiss, indem er die beschämende Situation drei Stunden lang durchstand, hatte er die verbalradikalen, aber vor der Gewalt zurückschreckenden Volksvertreter auflaufen lassen und ihnen das politische Patt demonstriert, in das sie sich selbst manövriert hatten. Aber für Napoleon wie für manchen wohlgesonnenen Beobachter hatte Ludwig dadurch den Rest an Achtung, den er ihm noch entgegengebracht hatte, verloren. Als er den unglücklichen Monarchen mit der Jakobinermütze auf dem Kopf in einem Fenster des Schlosses erblickte, soll er nach Aussage Bourriennes einen »kräftigen italienischen Fluch« ausgestoßen haben.36
Noch abstoßender allerdings als diese Geste der Anbiederung empfand er das lärmende Volk. »Wie war es möglich, dieses Gesindel hereinzulassen«, soll er zu Bourrienne gesagt haben. »Man sollte vier- bis fünfhundert mit Kanonen niederschießen, die übrigen würden dann schon davonlaufen.« Nachhaltig empörte er sich über die Abgeordneten, die die Szene danach kleinredeten oder sich gar zu Fürsprechern der Menge aufwarfen. »Diejenigen, die zu sagen haben, sind arme Menschen«, schrieb er seinem jüngeren Bruder Lucien.
»Wenn man das aus der Nähe sieht, muss man zugeben, dass es die Völker nicht wert sind, dass man sich solche Mühe macht, um ihnen zu willfahren. […] Man muss dabei gewesen sein, um zu empfinden, dass der Enthusiasmus nichts als bloßer Enthusiasmus ist und die Franzosen ein überaltertes Volk sind, ohne Vorurteile, aber auch ohne Bindungen.«37
Es sollte noch schlimmer kommen. Nachdem die Nationalversammlung sich als unfähig erwiesen hatte, die Krise zu lösen, riss ein selbsternannter Gemeinderat die Initiative an sich, und am 10. August 1792 stürmten Teile der Pariser Nationalgarde zusammen mit den aus Marseille herbeigeeilten Föderierten unter hohen Opfern das von der Schweizergarde verteidigte Schloss. Es kam zu einem Massaker unter den Verteidigern, von denen einige Hundert ihr Leben verloren. Dem Augenzeugen Napoleon, der am selben Abend den Schreckensort besuchte, bot sich ein erschütternder Anblick, der ihn noch auf Sankt Helena rückblickend zu außerordentlichen Worten greifen ließ:
»Niemals hat mir später eines meiner Schlachtfelder auch nur annähernd den Eindruck so vieler Leiden gemacht, wie es mir hier bei der Menge der toten Schweizer der Fall zu sein schien.«38
Es war aber nicht nur die Angst vor den Taten eines entfesselten Pöbels, die Napoleon überkam und die ihn nie mehr losließ. Er gewahrte auch mit Schrecken, was geschah, wenn die Macht plötzlich den Staatsorganen entglitt. Am Morgen hatte er beobachtet, wie der König mit seiner Familie, vor den Kämpfen fliehend, die Tuilerien verließ und sich unter den Schutz der Nationalversammlung begab. Für Napoleon war dieses Verhalten Defaitismus. Der König hatte das Schlimmste getan, was ein militärischer Führer tun konnte – er hatte seine Getreuen im Stich gelassen und sie der Rache der Feinde ausgeliefert. Dabei erschien ihm der Ausgang des Tages keineswegs von Anfang an entschieden. »Wenn Ludwig XVI. sich zu Pferde gezeigt hätte«, erklärte er noch am gleichen Tag seinem Bruder, »wäre der Sieg gewiss sein gewesen, so erschien es mir wenigstens bei dem Geist, der das Volk noch am Morgen beseelte.«39
So aber erschütterte diese Revolution erneut die Gesellschaft in ihren Grundfesten. Der König dankte ab und wurde mit seiner Familie verhaftet, die Nationalversammlung proklamierte die Republik und beschloss ihre eigene Selbstauflösung. Sie warf damit die erst ein Jahr alte Verfassung über den Haufen und schrieb Wahlen zu einem Konvent aus, dessen Aufgabe es sein sollte, dem Land eine neue, nicht-monarchische Verfassung zu geben. Alle Reformen der Vorjahre waren somit wieder auf Null gestellt, die Departements-, Distrikts- und Kommunalverwaltungen fungierten nur noch kommissarisch und harrten der Dinge, die da kommen würden. Zugleich wurde durch die Einführung des allgemeinen Männerwahlrechts die Zahl der Wähler um das Dreifache erweitert.