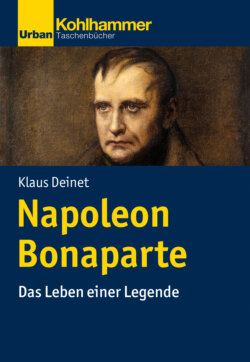Читать книгу Napoleon Bonaparte - Klaus Deinet - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der 13. Vendémiaire
ОглавлениеDoch ein viel dringenderer Auftrag kam dazwischen. Weder in der Vendée, noch am Rhein, noch in Italien oder im Orient sollte Napoleon seine nächste Aufgabe finden, sondern in Paris. Dort stand ein Aufstand sogenannter »moderater« Sektionen bevor, die unter den Einfluss verkappter Monarchisten und rachedurstiger ehemaliger Girondisten standen. Die Verkündung des Zwei-Drittel-Dekrets hatte die Hoffnungen dieser Leute auf eine legale Rückeroberung der Macht vernichtet und sie auf den Weg der Gewalt verwiesen, den sie mit Hilfe ihnen ergebener Teile der Nationalgarde verfolgten. Dabei griffen sie wie ihre sansculottischen Vorgänger zum Mittel des Marsches auf den Konvent. Von beiden Seiten der Seine her sollten sich Marschsäulen, die dieses Mal aus den begüterten Vierteln im Westen kamen, dem Konvent nähern und die »Immerwährenden« verjagen.
Die tonangebenden Männer des Wohlfahrtsausschusses wussten, dass im Falle eines Erfolgs dieser Insurrektion dem Drang zur Restauration Tür und Tor offenstand. Es war zu erwarten, dass Frankreich sich dann wie England nach dem Ende von Cromwells Protektorat rasch in eine Monarchie zurückverwandelte. Die überlebenden »Königsmörder« – also alle, die im Konvent für den Tod Ludwigs XVI. gestimmt hatten – mussten damit rechnen, wie ihre Vorgänger in England im 17. Jahrhundert hingerichtet zu werden. Unter den Männern, für die es um das Überleben ging, befanden sich prominente Personen wie Barras, Fréron, Tallien und Fouché. Diese Perspektive und eine gewisse Routine im Umgang mit Pariser Aufständen, die die Revolution ihnen beigebracht hatte, gab der Gruppe die nötige Energie, um der erwarteten Großdemonstration beherzt und unter Aufbietung militärischer Gewalt entgegenzutreten. Dazu brauchten diese Männer der Feder und des Wortes einen Militär, der genug Entschlusskraft aufbrachte und ohne minuziöse Anweisungen rasch und eigenständig zu handeln in der Lage war und der dabei aber von eigenem politischem Ehrgeiz möglichst frei und zu seinem Fortkommen ganz auf ihre künftige Protektion angewiesen sein sollte.
Abb. 4: Napoleon bezwingt den royalistischen Aufstand vor der Kirche Saint Roch (Stich von Charles Monnet; Erscheinungsjahr unbekannt)
Barras fiel der korsische Hauptmann ein, den er während der Belagerung von Toulon kennengelernt hatte. Er brachte seine Kollegen dazu, Napoleon als seinen Adjutanten mit der Verteidigung des Konvents zu beauftragen. Und dieser handelte, wie man es von ihm erwartete: Er sammelte ein paar verlässliche Teile der Nationalgarde um sich und ließ im Tuileriengarten und vor der Kirche Saint Roch einige Kanonen auffahren, die auf die Treppe und die Eingangstüren des Gotteshauses gerichtet waren. Als sich die von dem unerwarteten Widerstand irritierten Demonstranten der nördlichen Marschsäule hier versammelten – die südliche war gar nicht über die Seine gekommen – und der an sie ergangenen Aufforderung sich zu zerstreuen keine Folge leisteten, sondern zu wüsten Beschimpfungen übergingen, gab Napoleon seinen Kanonieren den Feuerbefehl. Zahlreiche Personen sanken innerhalb von Sekunden auf den Treppenstufen nieder, die anderen zerstoben in alle Richtungen, viele starben. Der Aufstand war zu Ende, bevor er richtig begonnen hatte.
Die Wirkung der Tat war zwiespältig. Zwar war der Sieg des Konvents unbestritten und die Propagandamaschinerie bemühte sich, die Aufständischen als eine Horde von ehemaligen Aristokraten und Königsanhängern zu verunglimpfen. Doch die Brutalität, mit der Napoleon auf die Menge hatte feuern lassen, rief Empörung hervor. Auch die Sansculotten hatten bei ihren Märschen auf den Konvent Kanonen mitgeführt – jedoch mehr als Drohung denn als militärisches Mittel. Die Kanonen hatten lediglich bei heftiger Gegenwehr gefeuert, etwa beim Sturm auf die Bastille oder bei der Eroberung der Tuilerien. Das war nun jedoch nicht der Fall gewesen. Die siegreiche Revolution hatte zum ersten Mal gegen unbewaffnete und zum Teil unbeteiligte Bürger die Artillerie eingesetzt – ganz so, als ob es sich um Feinde handelte, die sich zu einer Feldschlacht stellten. Insofern bedeutete der 13. Vendémiaire eine weitere Stufe der Brutalisierung des inneren Krieges und der Name Napoleons verband sich unvermeidlich mit dieser Erfahrung.
Auch diese Tat wurde als zweite Ruhmestat in den Kanon der Versatzstücke des Legendenbildes Napoleons aufgenommen. Allerdings spielte der 13. Vendémiaire eine weniger herausragende Rolle als »Toulon«. Während seine späteren Bewunderer aus dem linken Spektrum das Niederkartätschen einer, wenn auch von rechts motivierten, Volksmenge schamhaft herunterspielten, suchten die Vertreter der ›Schwarzen Legende‹ die Tat für ihr Bild des menschenverachtenden Militärherrschers auszuschlachten. Beides überzeugt nicht. Napoleon selbst hat sich später dem moralischen Urteil gestellt und die Tatsache, dass er anfangs mit Kugeln geschossen und nicht nur Warnschüsse gegen die Volksmenge abgefeuert hatte, mit dem Argument des kleineren Übels gerechtfertigt.
»Es ist eine übelverstandene Menschlichkeit, in einem solchen Augenblick nur Pulver zu gebrauchen, und anstatt das Leben der Menschen zu retten, schließlich eine unnöthige Verschwendung an Menschenblut zu verursachen.«49
Die Schonung kostete immerhin zwischen 200 und 400 Aufständische das Leben. Es war das arithmetische Vernunftargument des Militärs, das hier den Ausschlag gab.50