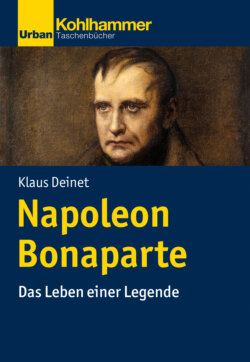Читать книгу Napoleon Bonaparte - Klaus Deinet - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einführung
ОглавлениеIm Jahr 1855, mitten im Krimkrieg, besuchte die britische Monarchin Queen Victoria mit ihrem Gemahl Prinz Albert und deren Sohn Edward die französische Hauptstadt. Es war der erste Staatsbesuch eines britischen Throninhabers seit der Französischen Revolution. Zu den Feierlichkeiten, mit denen Napoleon III. und seine Gemahlin Eugénie die Besucher beeindrucken wollten, gehörte neben den gewaltigen Abriss- und Neubaumaßnahmen, die der Präfekt Georges-Eugène Haussmann durchführte, der Besuch des Invalidendoms. Dorthin hatte der Sohn Louis Philippes die Gebeine des Korsen von der Insel Sankt Helena im Herbst 1840 gebracht. Vor dem Sarkophag Napoleons I. verharrten die Monarchen in Schweigen; Queen Victoria hatte im Vorfeld sogar dafür gesorgt, dass ihr Sohn, der Prinz von Wales, das Knie vor dem großen Gegner beugte, den sein Urgroßvater auf eine abgelegene Atlantikinsel verbannt und ohne ausreichende ärztliche Hilfe hatte sterben lassen.
Seitdem wurde der Napoleon-Sarg im Invalidendom zu einem internationalen Wallfahrtsort, einem notwendigen Bestandteil einer jeden Parisreise. »Paris […], wo tief in seinem Sarkophage / In Deinem Schoß von seinen Adlern überwacht / Der Kaiser schläft […]« dichtete der expressionistische deutsche Dichter Georg Heym in einem »Sehnsucht nach Paris« betitelten Gedicht, das im Jahr 1913 entstand. Auch heute umkreisen Besucher aus aller Welt den erstaunlich kurzen Marmorsarg, der an zentraler Stelle unter der Kuppel des Invalidendoms auf einem Podest steht, und lesen die dort eingetragenen Namen der siegreichen Schlachten »Austerlitz«, »Iéna«, »Wagram«, »La Moskawa«. Diese letztere, die Schlacht von Borodino, war ein grausames Ringen, bei dem beide Seiten an die 70 000 Mann verloren und an deren Ende die Grande Armée der Weg nach Moskau offenstand. In Moskau hielt Napoleon bis zum Oktober 1812 aus, um dann seinen fatalen Rückzug aus Russland anzutreten.
Was zeigt dieser kurze Blick auf sein Nachleben? Wie bei Alexander dem Großen und wenigen anderen großen Gestalten der Geschichte hat sich der Gegenstand der Verehrung so sehr von seiner historischen Realität gelöst. Napoleons tatsächliche historische Hinterlassenschaft wird in dem Maße überschätzt, wie die seines Neffen unterbewertet wird. Von seinen Zeitgenossen und den nachfolgenden Historikern wurde er zur Überfigur verzeichnet, oft im Bösen, dann im Guten, manchmal in beidem. Das mag daran liegen, dass er – anders als andere große Gewaltmenschen der Geschichte – noch die Möglichkeit hatte, sein Leben zur Legende zu verklären und damit den künftigen Biografen die Feder zu führen. Viele sind ihm darin gefolgt, einige haben sich an seinen Erinnerungen gerieben und liefen Gefahr, ihn zum Vorläufer der Diktatoren des 20. Jahrhunderts zu verzeichnen. Beides war er nicht. Sein Regime beruhte nicht auf Angst, sondern auf Konsens; er wusste sich mit einer aus der Revolution hervorgegangenen Elite zu umgeben, die aus jugendlichen Heerführern und Verwaltungsfachleuten bestand; und er besaß eine gewinnende Persönlichkeit, die auch Widerspruch zuließ. Hans-Ulrich Thamer hat das Rätsel seiner Wirkung zuletzt mit dem Weber’schen Begriff des Charismas einzufangen versucht.1 Ob er das Rätsel damit gelöst hat, muss allerdings dahingestellt bleiben.
Auf jeden Fall erfreut sich die Gestalt des Korsen einer ungebrochenen Attraktivität bei den Historikern. Allein in den letzten Jahren erschienen, um die Jahrestage seiner Geburt und seiner markantesten Siege und Niederlagen herum gruppiert, mehrere neue Biografien. Adam Zamoyski und Günter Müchler beschreiben ihn als eine Art ›stupor mundi‹, dessen Lebensleistung nicht an ihrem politischen Ergebnis gemessen, sondern als Erlebnis seiner schieren Außergewöhnlichkeit goutiert werden sollte. Volker Hunecke und Patrice Gueniffey versuchen ihm dadurch gerecht zu werden, dass sie sein Leben in eine ›gute‹ und eine ›schlechte‹ Hälfte teilen (mit der Kaiserkrönung als Wasserscheide), wobei letzterer sich auf die erste Lebenshälfte beschränkt, die er dafür umso ausführlicher schildert. Alle vermeiden eindeutige Verurteilungen oder Glorifizierungen, laufen aber dabei Gefahr, dass ihnen die Einheit der Persönlichkeit entgleitet.
Wenn wir dieser stolzen Reihe eine neue, relativ schlanke Biografie hinzufügen, so gilt es vorab, sich vor mehreren Fehlern zu hüten.
1. Napoleon ist nicht en bloc zu fassen, wie es früher häufig geschehen ist. Man wird ihm weder als ›Retter‹ noch als ›Verderber‹ der Französischen Revolution gerecht. Er war nicht der Schlachtengott, dessen militärisches Genie ihn vor jeder politischen Bewertung feit, weil er sich menschlichen Maßstäben entzieht. Und umgekehrt – wie ihn Freiherr vom Stein sah – war er auch nicht die Verkörperung des Bösen, dem beizukommen es der größten Kraftanstrengung bedurfte, die Europa sich je auferlegt hat.
2. Die 15 (bzw. rechnet man die Direktorialzeit mit: 20) Jahre seines politischen Wirkens sollten aber auch nicht in Schubladen zerlegt werden (wie ›das militärische Genie‹, ›der Bändiger der Revolution‹, der ›Neuordner Europas‹ usw.), so als stünden sie unverbunden nebeneinander. Das Phänomen Napoleon ist vielmehr als Prozess zu begreifen. Ein Prozess, der von kometenhaftem Aufstieg über einige wenige Jahre der Mäßigung und des Wiederaufbaus einer von der Revolution erschütterten Nation bis hin zum Übermaß, zur Überdehnung der menschlichen Ressourcen und zu einem ebenso jähen Abstieg führt. Daraus ergibt sich für unsere Erzählung ein chronologisches Fortschreiten, wobei sich das Augenmerk auf die Frage richtet, ob es in diesem Ablauf Punkte gab, wo ein rechtzeitiger Verzicht auf eine weitergehende Expansion alternative Verläufe zugelassen und Frankreich und Europa weitere Opfer erspart hätte.
3. Die Konstante in allen Verästelungen dieses Entwicklungsbogens, dessen schiere Dramatik die Zeitgenossen ebenso in ihren Bann schlug wie die Nachwelt, ist Napoleons Persönlichkeit. Die in seinem Charakter angelegten Impulse erklären nicht nur den frühen Aufstieg, sondern auch das maßlose Weiterschreiten und die Verbohrtheit beim Abstieg. Insofern sind die genannten Versuche, seine Karriere in die erste Hälfte eines ›guten‹ und die andere eines ›schlechten‹ Diktators zu teilen, ebenso wenig überzeugend, wie die Entscheidung Gueniffeys, seine Lebenserzählung einfach im Jahre 1804 abzubrechen und der Biografie den Titel Bonaparte zu geben – gerade so, als hätte der spätere Kaiser Napoleon I. den Bonaparte in sich betrogen und aus dem Revolutionsvollender den Gewaltherrscher gemacht, dessen Leben und Wirken zu erzählen sich nicht mehr lohnte.
Aus dem Genannten ergibt sich: Napoleon Bonaparte ist nur in seiner gesamten Entwicklung, also chronologisch, zu begreifen und in seiner Person als eine Einheit aufzufassen. Deshalb wird Wert auf die frühen Jahre gelegt, in denen sich bestimmte Züge seines Charakters ausgebildet haben, die auch in den Zeiten des Ruhms, als an seinen Entscheidungen das Leben Zehntausender hing, zum Zuge kamen. Wichtig ist angesichts des Übermaßes der zeitgenössischen Zeugnisse, die teilweise in extenso und ohne allzu viele Bedenken ausgebeutet wurden, eine Beschränkung auf verlässliche Quellen. Dabei haben die Selbstzeugnisse, die nunmehr in einer mustergültigen Form vorliegen, keineswegs einen geringeren Aussagewert als die Beobachtungen derer, die mit ihm zu tun hatten und sich dabei oft selbst in ein entsprechendes Licht rücken wollten.2
Eine wenig beachtete, aber nicht zu vernachlässigende Quelle bilden die Zeugnisse deutscher Zeitzeugen, die den jungen Bonaparte aus der Nähe beobachteten – so vor allem Konrad Engelbert Oelsner und Gustav von Schlabrendorf, die beide das Egomanische seines Wesens früh erkannt haben. Für die spätere Zeit ist Armand de Caulaincourt ein Hauptzeuge, dessen von Gabriel Hanotaux edierte Memoiren dem Menschen Napoleon Bonaparte in seiner psychischen Unmittelbarkeit sehr nahekommen. Caulaincourt war nämlich bei der mehrtägigen Rückreise aus Russland im Dezember 1812 der einzige Gesprächspartner Napoleons. Der französische Aristokrat war ein kritischer Verehrer Napoleons und ein glühender Patriot, der bis zur Preisgabe des eigenen Lebensglücks die Interessen Frankreichs und die Charaktereigentümlichkeiten Napoleons miteinander zu versöhnen trachtete: ein hoffnungsloses Unterfangen, bei dem er von Metternich ebenso manipuliert wurde, wie er an Napoleons Starrsinn scheiterte.
Methodisch muss eine kurze Biografie auf viele Details verzichten, die sich in den umfangreichen Werken (von Thiers über Kircheisen bis zu Madelin) in oft langatmiger Fülle ausgebreitet finden. Es geht vielmehr darum, die Scharnierstellen herauszuarbeiten, die zeigen, dass die skizzierte Linie von Auf- und Abstieg kein zwangsläufiges Geschehen war, sondern auf Entscheidungen beruhte, die vielfach – nicht immer – Napoleon selbst traf. Es sollte deutlich werden, dass ihm bis 1813 Handlungsräume zur Verfügung standen, aus denen er Alternativen hätte auswählen können. Der Aspekt ›Deutschland und Napoleon‹, der um das Jubiläumsjahr 2004 herum sehr breit behandelt wurde, wird dagegen im Rahmen des chronologischen Fortschreitens der Erzählung nur gestreift. Ebenso können die zahlreichen Schlachtverläufe, die bis heute das gesteigerte Interesse der Geschichtsschreibung finden, nur kursorisch verfolgt werden, auch wenn sich gerade hier das vielgepriesene Genie des Korsen ebenso zeigte wie die Schattenseiten seines Charakters. Von einzelnen Skizzen wie im Falle von Austerlitz, Aspern-Essling und Waterloo abgesehen, verzichten wir auf detaillierte Schlachtbeschreibungen, verweisen aber auf die akribischen Studien vor allem angelsächsischer Historiker. Nicht durch Detailfülle, sondern durch kritische Akzentuierung soll die vorliegende Biografie die Verzeichnungen und Defizite, die zumal das Bild Napoleons in Frankreich immer noch prägen, aufzeigen und geraderücken.