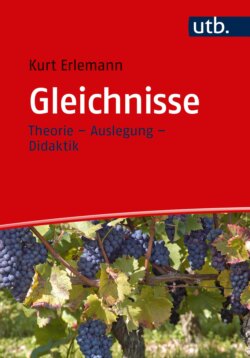Читать книгу Gleichnisse - Kurt Erlemann - Страница 39
1.5.6 Fiktionalität und Appellstruktur
ОглавлениеGleichnisse sind fiktionale Kurzerzählungen, das heißt erfundene Kurzgeschichten, die das, worum es geht, plausibel machen sollen. Der Weg über die Fiktionalität erleichtert es, sich als Hörer auf die Argumentation des Textes einzulassen.
Rezipienten lassen sich zugleich ‚nur‘ spielerisch und ‚in gewisser Weise‘ ernsthaft auf fiktionale Texte ein.1
Frank Zipfel beschreibt fiktionales Erzählen als kulturell institutionalisierte Praxis, über deren Regeln es zwischen Autor und Adressaten Einvernehmen gibt:
Der Autor produziert einen Erzähltext mit nicht-wirklicher Geschichte, die von einem Erzähler dargestellt wird, und der Autor tut dies mit der Intention, dass der Rezipient diesen Text mit der Haltung des make-believe aufnimmt bzw. in der Haltung des fiktiven Adressaten, und der Rezipient erkennt diese Absicht des Autors und lässt sich aus diesem Grunde darauf ein, den Erzähl-Text unter den Bedingungen eines make-believe-Spiels zu lesen.2
Fiktionalität ist demnach kein Täuschungsversuch, sondern eine konsensuelle Form des Erzählens. Ihr Sinn und Zweck besteht darin, ein bestimmtes Argument gleichsam spielerisch zu plausibilisieren. Der damit verknüpfte ‚metaphorische Prozess‘ verläuft spielerisch, da die Fiktionalität den Rezipienten einen pragmatischen Freiraum lässt.3 Konstitutiv ist der Bezug auf bestimmte Aspekte der Wirklichkeit (eine philosophische, moralische oder politische Position), die durch die Erzählung neu gesehen werden sollen.4 Realistik, selbst wenn sie sich als Pseudo-Realistik entpuppt, ist für das Gelingen der fiktionalen narratio entscheidend.5 Gleichnisse sind ein prominentes Beispiel für diese rhetorische Strategie.
Die Fiktionalität der gleichnishaften narratio zielt über die Information auf Gefühle und praktisches Handeln. Gleichnisse sind appellativ auf aktives Hören und Handeln angelegt (Mk 4,3.9: ‚Wer Ohren hat zu hören, der höre!‘; Lk 10,37: ‚Geh hin und tu desgleichen!‘).6 Gleichnisse (auch Metaphern) fordern zu einer fälligen Entscheidung oder zu einer Kurskorrektur auf. Motivierend wirken die Ansage der Zuwendung Gottes und seiner Herrschaft sowie die Entlarvung der Alltagswirklichkeit mit ihren Wertmaßstäben als zu überwindendes Provisorium.
Definition: Fiktionalität ist das rhetorische Mittel einer erfundenen, in sich schlüssigen narratio, mit deren Hilfe ein bestimmtes Argumentationsziel, etwa die Plausibilisierung einer neuen Wirklichkeitssicht, spielerisch erreicht werden soll.