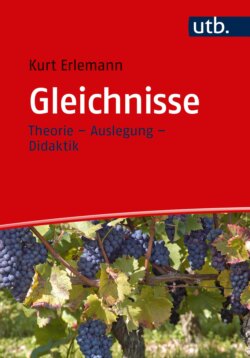Читать книгу Gleichnisse - Kurt Erlemann - Страница 69
g) Ästhetische Autonomie
ОглавлениеDie existenziale Interpretation verweist auf zeitunabhängige, unmittelbar einsichtige Existenzialien wie Angst, Freude, Hoffnung, Liebe, Furcht vor dem Tod etc. Die Gleichnisbotschaft erscheint dadurch unabhängig von ihrem historischen Verstehenszusammenhang. Sinngebend sind, so die Vertreter einer ‚ästhetischen Autonomie‘ der Gleichnisse, das Ensemble der einzelnen Erzählelemente und die jeweiligen Rezipienten. Diese deuteten das Gleichnis als Kunstwerk, das jenseits der Autorintention, autonom sein Wirkungspotenzial entfaltet, mithilfe eines eigenen ‚hermeneutischen Entwurfs‘.1 Die ästhetische Autonomie der Texte verdanke sich vor allem ihrer Kürze und ihrer narrativen Geschlossenheit.2
Die Wirkung des Kunstwerks auf die Betrachter bestehe in einer durch Dramaturgie und Geschlossenheit ermöglichten, ästhetischen Erfahrung, die die Sicht auf den Alltag nachhaltig verändere. Transfersignale und überhaupt die Frage nach einer Deutungsebene spielen in diesem Ansatz keine Rolle. Die Deutung sei ausschließlich auf der Erzählebene selbst zu suchen und zu finden. Nicht die basileía Gottes sei der Bezugsrahmen, sondern eine unmöglich erscheinende Möglichkeit der Existenzführung.3 François Vouga definiert die Gleichnisse als
dramatische Geschichten mit einer oder mehreren Personen, charakterisiert durch die Klarheit ihrer Handlung, durch die Univozität ihrer Sprache und durch die Unabhängigkeit von jedem Kontext.4
Wolfgang Harnisch verbindet das Konzept mit Erkenntnissen der Theaterwissenschaften und der Fabeltheorie. Jülichers Postulat eines Gleichnis-Idealtyps wird aufgegriffen und modifiziert: Eine bestimmte Figurenkonstellation sowie eine Szenenfolge in drei Akten, mit dem erzählerischen Schwerpunkt auf dem dritten, dialogisch angelegten Akt der narratio sei typisch für die Gleichnisse im Munde Jesu. Dieses Arrangement verleihe ihnen eine einzigartige Sprachkraft: Die Adressaten würden wie in einem gelungenen Bühnenstück in den Handlungsverlauf verwickelt. Das führe zur Entdeckung einer überraschend möglich erscheinenden, befreienden Existenzweise, welche in einem metaphorischen Prozess mit der Gottesherrschaft verknüpft werde.5 Merkmale dieser neuen Existenzmöglichkeit seien unbedingte Liebe, unbegrenzte Freiheit und maßlose Hoffnung. In der performance des Gleichnisses werde die Möglichkeit verwirklicht (Sprachereignis). Das textpragmatische Ziel des Gleichnisses formuliert Harnisch so:
Der Hörer, dem Jesu Erzählung als eine ihn treffende Anrede widerfährt, soll sich im Akt der Rezeption zu einem Glauben ermutigen lassen, der das sprachlich Eröffnete als eine ihm extra se ipsum zukommende, verdankte und damit auf Gott verweisende Möglichkeit wahrnimmt, zu einem Glauben also, der die Sphäre des Möglichen mit der Gottesherrschaft identifiziert.6
Harnisch bindet seine Theorie an die mündliche Idealform der Gleichnisse, die noch frei von (zentrifugal wirkenden) Transfersignalen sei. In dieser Form begegneten die Rezipienten den Gleichnissen mit einer Unvoreingenommenheit, die den genannten ‚metaphorischen Prozess‘ allererst ermögliche. Die Verschriftlichung der Texte und die damit einhergehende Anreicherung mit nach außen ablenkenden Transfersignalen (Allegorisierung) wertet Harnisch als ‚Sprachverlust‘, in dem das Sprachereignis in ein rhetorisches Argument umgewandelt werde. Jülichers Missverständnis- bzw. Verfälschungstheorie lebt damit modifiziert weiter (weiter zum Gleichnis als Bühnenstück → 2.2.6e).