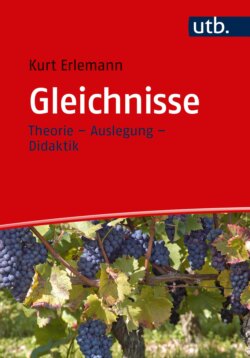Читать книгу Gleichnisse - Kurt Erlemann - Страница 76
1. Allegorese
ОглавлениеDie Allegorese ist ein antikes, bis in die Neuzeit verbreitetes Auslegungsverfahren, das zwischen dem wörtlichen Sinn eines Textes und einem weiteren, tieferen bzw. allegorischen Sinn unterscheidet. Diese Unterscheidung ermöglicht es, auch schwer verständlichen Bibeltexten einen (aktuellen) Sinn abzugewinnen. Texte gelten dabei generell als mehrschichtig und damit als bewusste Herausforderung, den eigentlichen Sinn, die geistliche Tiefendimension, zu entdecken. In diesem Sinne betrieb bereits Philo von Alexandrien (ca. 15 v. – ca. 50 n. Chr.) systematisch Allegorese. Auf diese Weise erschloss er philosophisch gebildeten Nichtjuden in Alexandria den (philosophischen) Sinn biblischer Texte.
Beispiel: Entgegen dem ursprünglichen Textsinn von Gen 16-21 deutet Paulus in der Allegorese Gal 4,21-31die beiden Erzmütter Sara und Hagar auf den neuen bzw. den alten Bund. Allein die soziale Konstellation der beiden Frauen genügt Paulus, sein Thema hierin abgebildet zu sehen. Die bekannte, anschauliche Erzmüttergeschichte ist für den Apostel ein geeignetes Medium, um die eher unanschauliche Rede vom alten und neuen Bund begreiflich zu machen.
Das Beispiel zeigt, dass Allegorese argumentativen Zwecken und zugleich der Aktualisierung des Erzmüttertexts dient. Von der Alten Kirche bis in die Neuzeit wurde die Allegorese weiter verfeinert (Unterscheidung mehrerer Schriftsinne bei Origenes, Augustin u. a.). Das Verfahren wird pneumatologisch legitimiert: Der Autor aller Bibeltexte sei der Heilige Geist, der sie wie einen Teppich zusammengewoben habe. So seien alle Texte miteinander unsichtbar verknüpft; diese Verknüpfungen gelte es offenzulegen – eine frühe Form von Intertextualität!1
Mit dem Aufkommen der historisch-kritischen Bibelauslegung wurde die Allegorese mehr und mehr in Frage gestellt. Nicht eine unhistorische, geistliche Tiefendimension stand nunmehr im Fokus der Exegese, sondern der vom Textautor intendierte, historische Textsinn. Bezugspunkt ist dabei die Semantik des Textes.
Beispiel: Das ‚Kalb‘ im Gleichnis vom verlorenen Sohn könnte, allegorisch gedeutet, auf den gekreuzigten Christus hinweisen, der für die Vergebung der Sünden ‚geschlachtet‘ wird. Eine solche Deutung wird jedoch der ursprünglichen Intention des Lukas nicht gerecht: Erstens, das ‚Kalb‘ ist ein dekorativer Nebenzug des Gleichnisses, der nicht nach Auslegung ruft; zweitens, ‚Kalb‘ als christologische Metapher ist weder bei Lukas noch sonst irgendwo im Neuen Testament zu finden (im Gegensatz zu ‚Lamm‘).
Für die historisch-kritische Methode verbietet sich Allegorese; das ist bis heute common sense der wissenschaftlichen Textauslegung, zumindest in der westlichen, vor allem durch den Protestantismus geprägten, Auslegungstradition. Der vorliegende Entwurf plädiert für eine Enttabuisierung der Allegorese (→ 2.5.5d).